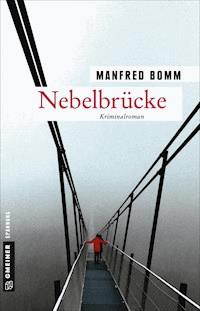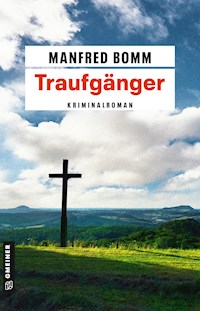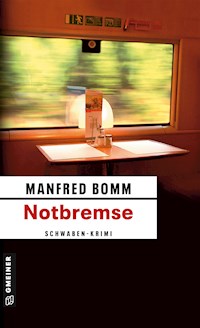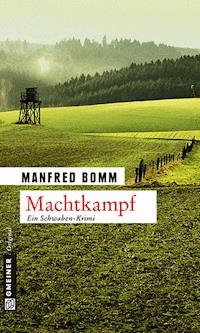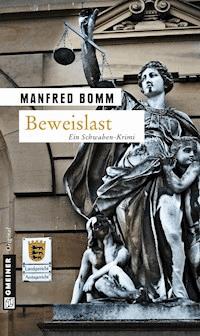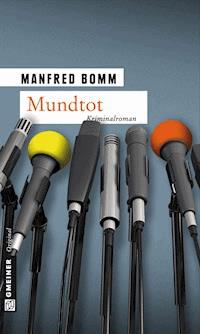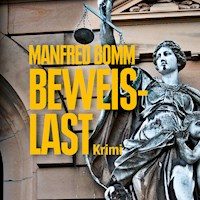Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Deutschland muss 2006 im eigenen Land Fußballweltmeister werden! Dass man dies nicht dem Zufall überlassen darf, darüber sind sich einige Wirtschaftsbosse und Politiker in Berlin längst einig. Im Hintergrund werden Fäden gesponnen, die bis in die schwäbische Provinz reichen. So findet sich auch Kriminalkommissar August Häberle bei seinen Ermittlungen um einen mysteriösen Mordfall in einem Geflecht aus Erpressung und Intrigen wieder. Als er das persönliche Umfeld des Ermordeten und dessen Freunde genauer unter die Lupe nimmt, muss er feststellen, dass diese alle eines gemeinsam haben: Sie kennen den Fußballbundestrainer Jürgen Klinsmann noch aus seiner Zeit, als er Jugendspieler im schwäbischen Geislingen an der Steige war. Wenige Monate vor der Fußball-WM scheint dieser in äußerster Gefahr zu sein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Schusslinie
Der fünfte Fall für August Häberle
Zum Buch
Deutschland muss 2006 im eigenen Land Fußballweltmeister werden! Dass man dies nicht dem Zufall überlassen darf, darüber sind sich einige Wirtschaftsbosse und Politiker in Berlin längst einig. Im Hintergrund werden Fäden gesponnen, die bis in die schwäbische Provinz reichen.So findet sich auch Kriminalkommissar August Häberle bei seinen Ermittlungen um einen mysteriösen Mordfall in einem Geflecht aus Erpressung und Intrigen wieder. Als er das persönliche Umfeld des Ermordeten und dessen Freunde genauer unter die Lupe nimmt, muss er feststellen, dass diese alle eines gemeinsam haben: Sie kennen den Fußballbundestrainer Jürgen Klinsmann noch aus seiner Zeit, als er Jugendspieler im schwäbischen Geislingen an der Steige war. Wenige Monate vor der Fußball-WM scheint dieser in äußerster Gefahr zu sein …
Manfred Bomm war bis zu seinem Ruhestand als Journalist für Polizei und Justiz zuständig, lebt am Rande der Schwäbischen Alb, dort wo sein Kommissar August Häberle ermittelt, und hat über seine Serienfigur bereits 20 Kriminalromane geschrieben. Vieles, was er in seinen Romanen verarbeitet, hat sich so oder in ähnlicher Weise zugetragen. Das Vorbild für die Figur des Häberle ein leibhaftiger Kommissar aus Göppingen ist ab 1982 tatsächlich sein gesamtes Berufsleben lang mit dem in »Die Gentlemen-Gangster« thematisierten Verbrechen konfrontiert gewesen. Manfred Bomm fühlt sich eng mit Land und Leuten verbunden, liebt die Natur, das Wandern, Reisen und Radeln. Wichtig ist ihm, so gut wie alle beschriebenen Schauplätze selbst aufgesucht zu haben.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © sxc.hu
ISBN 978-3-8392-3226-2
Widmung und Dank
Gewidmet allen, denen ein
Sieg der Herzen mehr bedeutet,
als Macht, Einfluss und Gewinn.
Denn wahre Größe zeigt sich darin,
mit ehrlicher Arbeit die Zukunft zu gestalten.
Mögen wir alle erkennen,
welch große Chancen vor uns liegen.
Wir müssen nur bereit sein, sie zu ergreifen.
Und jede Niederlage ist auch ein Gewinn:
Sie bringt uns die Erkenntnis,
etwas daraus gelernt zu haben.
Mein Dank gilt
Marika Barth von »Agapedia«
(Jürgen Klinsmann Stiftung)
und
MdB Klaus Riegert sowie
den vielen anderen,
die mich beraten und unterstützt haben.
*
Ein Großteil der Handlung und die meisten Namen sind frei erfunden. Nicht aber die Schauplätze. Wer den Spuren von Kommissar Häberle folgen will, kann dies tun.
1
»Und welche Befugnisse haben wir?« Der Mann behielt sein Gegenüber fest im Auge. Einige Sekunden lang schauten sie sich wortlos an. Nur der Verkehrslärm drang in das Büro im achten Stockwerk, hoch überm Potsdamer Platz, zu ihnen herauf. Durch die engmaschigen Vorhänge der Fensterfront zeichnete sich das Sony-Center ab. Gegen die Scheiben peitschte Regen. Der Angesprochene griff zu seinem Krawattenknoten und versuchte ein zaghaftes Lächeln. Obwohl es kühl war, schwitzte er. »Befugnisse«, wiederholte er langsam. »Ich denke, Ihnen ist die Tragweite dieses Auftrags bewusst.« Er lehnte sich in dem wuchtigen weißen Ledersessel zurück und verschränkte die Arme. Der Fragesteller, der jenseits des Glastischchens saß, hatte sich ebenfalls ein Lächeln abgerungen. Auch ihm war heiß geworden. Am liebsten hätte er sein Jackett ausgezogen und den Krawattenknoten gelöst. Doch das geziemte sich nicht, solange der Gastgeber an der Kleiderordnung festhielt. Seit zwei Stunden saßen sie in diesem Büro, dessen weiße Wände nur durch ein riesiges, buntes und abstraktes Gemälde aufgelockert wurden. Sie hatten angestrengte Gespräche geführt, sich konzentriert und gegenseitig respektiert.
Vor ihnen auf der Glasplatte lagen einige Schnellhefter. Ihren Inhalt waren sie ausführlich durchgegangen, Punkt für Punkt, hatten Notizen gemacht, Termine abgestimmt und Namen genannt. Die schweren Kristallgläser waren leer, das Mineralwasser getrunken. Wieder trat eine dieser peinlichen Pausen ein, wie so oft, wenn er, der an Jahren deutlich jüngere Besucher, eine Antwort erwartete. Dann war nur das monotone Rauschen der Klimaanlage zu hören, bis plötzlich vier Signaltöne eine SMS-Botschaft ankündigten. Der Gastgeber zögerte einen Augenblick, griff dann aber in die Innentasche seines Jacketts und holte ein silbern glitzerndes Handy heraus. Er drückte einige Tasten und las mit versteinertem Gesicht, was auf dem Display stand: »Ich brauch dich noch heute.« Der Mann verzog keine Miene, drückte die Nachricht weg und steckte das Handy wieder ein.
Sein Gegenüber hatte die Szene wortlos verfolgt, knüpfte dann aber an das vorausgegangene Gespräch an: »Sie dürfen mir glauben, Herr Gangolf, dass ich mir der Tragweite bewusst bin.« Er zögerte. »Gerade deshalb stellt sich mir die Frage nach den Befugnissen.«
Der Ältere schlug bedächtig die Beine übereinander. »Lassen Sie es mich so formulieren«, begann er im Stil weltmännischer Diplomatie, »wenn man im Sinne einer guten Sache handelt, braucht man bei allem, was man tut, kein schlechtes Gewissen zu haben.«
Der Gast versuchte, die Nervosität zu verbergen. »Und was gut ist …« Er sprach langsam und betont, »… was gut ist, entscheiden Sie?«
Pause. Wieder diese Stille, das Rauschen der klimatisierten Luft. Irgendwo hupte ein Auto.
»Gut ist, was uns allen dient«, erwiderte Ministerialdirektor Harald Gangolf schließlich und bekräftigte: »Was uns und der Allgemeinheit dient.« Er überlegte. »Viel zu lange ist dieses Land in Lethargie erstarrt. Nun liegt es tatsächlich an Ihnen, eine Chance zu ergreifen, die uns sozusagen der Himmel beschert. Und die es für uns beide kein zweites Mal geben wird.«
Der Jüngere fühlte sich nun doch geschmeichelt. »Ich werde mein Bestes geben. Aber ohne die vielen anderen bin ich machtlos.« Gangolf nickte und wurde noch ernster: »Sie sollten aber eines nicht vergessen, Herr Liebenstein – Sie haben zwar alle Rückendeckung dieser Welt. Alle.« Der Mann legte seine Arme auf die ausladenden Sessellehnen und verzog sein Gesicht zu einer drohenden Miene. »Sollte aber irgendetwas an die Öffentlichkeit dringen, wird Sie nach außen hin niemand unterstützen. Ich nicht, der Kanzler nicht, der Innenminister nicht und schon gar nicht der Justizminister – und auch keiner der Funktionäre. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.« Nach kurzer Pause fügte er hinzu: »Egal, wer bis dahin hier an der Regierung ist.« Tatsächlich deutete alles darauf hin, dass es nach dem Wahldebakel der Rot-Grünen in Nordrhein-Westfalen vorletzten Sonntag eine unerwartet schnelle Änderung in der politischen Landschaft geben würde.
Der junge Mann schluckte. Ihm wurde plötzlich klar, was diese wenigen Worte bedeuteten: Man würde ihn intern zwar schützen, doch wenn es notwendig sein sollte, musste er als Bauernopfer herhalten. Alle anderen wollten sich die Hände in Unschuld waschen.
Durch den Stuttgarter Hauptbahnhof blies ein kalter Wind. Über Nacht hatte es abgekühlt und geregnet. Vermutlich war die Schafskälte, wie sie für Anfang Juni erwartet wird, bereits jetzt, am 30. Mai, ins Land gezogen. Von den angrenzenden Bahnsteigen kroch die Kälte bis in die große Halle hinein. Es war kurz nach ein Uhr und in dem Gebäude herrschte an diesem Montag die alltägliche Hektik. Lautsprecherdurchsagen, gestresste Menschen mit Aktenkoffern, Schüler und Reisende, die gelangweilt auf ihre Weiterfahrt warteten.
Leonhard Lanski hatte hier sein Ziel erreicht. Er war aus Dortmund gekommen, um sich um 13.30 Uhr mit seinen Gesprächspartnern zu treffen. Den Stuttgarter Hauptbahnhof hatten sie gewählt, weil er von allen Teilnehmern des Meetings am besten zu erreichen war. Die meisten hatten nicht mal umsteigen müssen. Und nach der Veranstaltung konnten sie entweder sofort wieder zurückfahren oder weiterreisen nach München, wo über zwei Tage hinweg die Einweihung des neuen Fußballstadions stattfinden würde, das den Namen Allianz-Arena erhalten sollte.
Lanski, der einen schwarzen Aktenkoffer in der rechten Hand hielt, fröstelte, als er inmitten des Menschengedränges von den Bahnsteigen in die quer verlaufende Halle eilte. Er blieb bei einer Buchhandlung stehen, um sich zu orientieren. Doch dann sah er rechts drüben, genau so, wie es ihm am Telefon beschrieben worden war, den Eingang zum Intercity-Hotel.
Lanski ging entschlossenen Schrittes quer durch die Halle, wich Menschengruppen aus und war in wenigen Minuten in der ersten Etage des Bahnhofshotels. Hinweistafeln wiesen ihm den Weg zur Veranstaltung ›Sport-Management‹. Sie fand im Konferenzraum mit dem Namen ›Ulm‹ statt.
Ein halbes Dutzend korrekt gekleideter junger Männer stand diskutierend vor der offenen Tür, vier weitere hatten drinnen bereits an den u-förmig angeordneten weißen Tischen Platz genommen. Lanski nickte den Personen freundlich zu, sagte ›Hallo‹ und betrat den kleinen Konferenzsaal. Dort sprang bei seinem Anblick einer der Männer auf und kam ihm entgegen.
»Willkommen in Stuttgart, Herr Lanski«, lächelte der Endfünfziger.
»Ist mir doch ein außerordentliches Vergnügen, Herr Beierlein«, erwiderte Lanski, der wohl nur wenig jünger war als sein Gegenüber.
»Wir haben Tischkärtchen aufgestellt«, deutete der Gastgeber auf einen der Plätze. Dann stellte er die drei anderen, deutlich jüngeren Männer vor. Sie kamen aus Italien, der Schweiz, Österreich und Frankreich.
Lanski glaubte, einige der Namen schon einmal gehört zu haben. Er setzte sich und schenkte sich Mineralwasser ein.
Zehn Minuten später waren auch die anderen, die vor der Tür diskutiert hatten, in den Raum gekommen – und mit ihnen noch zwei weitere Männer, die eher der Altersgruppe von Lanski und des Gastgebers angehörten. Sie setzten sich zu ihm an die Querseite der Tischformation.
»Meine Herren«, erhob sich Stefan Beierlein, »seien Sie noch einmal ganz herzlich hier in Stuttgart begrüßt und beglückwünscht, dass Sie zu den 47 Auserwählten gehören. Dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, ist für uns ein Zeichen großer Wertschätzung.« Er lächelte und schaute in die Runde. »Und es zeigt uns, dass wir alle dasselbe Ziel verfolgen. Ich brauche nicht extra zu erwähnen, dass unser heutiges Treffen allergrößter Diskretion unterliegt.« Noch einmal blickte er die Männer, die vor ihm saßen, nacheinander an. Sie nickten ihm mit ernsten Gesichtern zu. »Um keine Zweifel aufkommen zu lassen«, fuhr der Vorsitzende fort, »meine drei Kollegen und ich werden im Ernstfall jederzeit behaupten, niemals mit Ihnen zusammen gewesen zu sein.« Die Älteren an seiner Seite verzogen keine Miene.
»Was hier gesprochen wird«, erklärte Beierlein weiter, »unterliegt absoluter Verschwiegenheit. Betrachten Sie es als ein Staatsgeheimnis, wenn Sie so wollen. Sie wissen: Es hat seinen Grund, dass wir von den 47 Auserwählten gerade Sie hierher gebeten haben. Sie sind Männer, die durch energisches Auftreten bisher bewiesen haben, dass Sie in der Lage sind, einer Herausforderung mit weit reichender Bedeutung gerecht zu werden. Einer Bedeutung, die nationale Interessen berührt. Was wir heute also besprechen, meine Herren, muss Gültigkeit haben und ist wie ein besiegelter Vertrag. Wir werden selbstverständlich keinerlei Schriftstücke anfertigen, das werden Sie verstehen. Aber was wir beschließen, gilt so fest und sicher, wie es Männer seit jeher mit einem Handschlag besiegeln können.«
Einige der Zuhörer lächelten.
»Ich möchte für alle, die sie noch nicht kennen, meine beiden Kollegen hier vorstellen«, fuhr er fort. »Links von mir, das ist Herr Michael Rambusch. Er ist für das Finanzielle zuständig und gehört unserem …« Beierlein suchte nach der passenden Bezeichnung. »… unserem Organisationsteam schon seit über einem Jahr an. Seine Connections zu Sponsoren und Interessenvertretern sind geradezu legendär.« Rambusch stand kurz auf und lächelte.
»Ganz rechts außen, das ist Herr Leonhard Lanski. Sein Name dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein. Er ist sozusagen der Mann aus der Praxis. Er weiß, wovon er spricht.«
»Zu meiner Rechten sitzt Harry Obermayer, der Manager, der das Unmögliche möglich macht.« Er hielt kurz inne, als der Genannte aufstand und sich verbeugte. »Herr Obermayer hat phänomenale Beziehungen in politische Kreise. Es gibt kaum einen Politiker, ob in der Regierung oder in der Opposition, den er nicht duzt. Diese Flexibilität ist seit dem vorletzten Sonntag mehr denn je angebracht. Heutzutage bedarf es persönlicher Kontakte, geschickter Strategien …« Er nickte, als wolle er sich damit selbst bestätigen. »Ja, geschickter Strategien, meine Herren. Früher haben wir über die südlichen Länder gelächelt, auch über Italien …« Er schaute zu dem von dort angereisten schnauzbärtigen Kollegen. »Aber inzwischen, liebe Kollegen, inzwischen ist Deutschland die größte Bananenrepublik weit und breit geworden. Korruption, Bestechung, machtbesessene und geldgierige Politiker, raffgierige Unternehmer. Gewerkschaften, die sich unterbuttern lassen. Glauben Sie mir …« wieder legte er eine Pause ein, »… wenn Sie Einblick in die Politik und in die Wirtschaft haben, wenn Sie sehen, mit welchen Mitteln gelogen, betrogen, getrickst und bestochen wird, dann werden Sie merken, dass wir bei allem, was wir zu arrangieren versuchen, geradezu Waisenknaben sind.«
2
Ministerialdirektor Harald Gangolf vom Wirtschaftsministerium der Bundesrepublik Deutschland war zufrieden. Er hatte das Büro des ›Instituts für kommunikative Zusammenarbeit‹ in einem der hoch aufragenden Gebäude am Potsdamer Platz wieder verlassen. Als er in der Tiefgarage in den silberfarbenen S-Klasse-Daimler gestiegen war, steckte er das Handy in die Halterung und fuhr in den regengrauen Nachmittag hinaus. Dabei drückte er einige Tasten, worauf sich gleich eine Frauenstimme mit ›Hallo‹ meldete.
»Ich bin’s. Danke, Schatz, für deine Botschaft.« Er fuhr langsam auf der Alten Potsdamer Straße hinter einem Bus her, der die schmutzige Nässe aufwirbelte.
»Hat’s so lange gedauert?«
»Endlos, war aber auch notwendig. Aber ich denke, Liebenstein ist der richtige Mann dafür. Einer, der weiß, worauf es ankommt. Und ganz wichtig: Er will’s noch zu was bringen. Er wird darauf bedacht sein, keinen Patzer zu machen.«
»Schön für dich, Bärchen«, hauchte die Stimme im Lautsprecher, »und wann hast du heut Abend Zeit für mich?«
Gangolf runzelte die Stirn. Er konnte nicht überholen und fuhr nach links in die Ebertstraße hinein. Der Regen wurde immer stärker. »Ich bin jetzt auf dem Weg ins Ministerium. Zwei Termine stehen noch an, Schatz.« Sein Blick fiel auf die Uhr im Armaturenbrett. Kurz nach drei schon. »Außerdem …« Er stockte, weil er sich auch auf den Verkehr konzentrieren musste, »… außerdem hab ich dir doch gesagt, dass ich heut Abend …«
Gangolf konnte den Satz nicht zu Ende bringen, weil ihn die Stimme unterbrach: »Weiß schon – natürlich. Besuch einer Wirtschaftsdelegation. Du musst repräsentieren.« Es klang enttäuscht und der Mann erwiderte nichts, sondern atmete schwer. Rechts zogen die dunklen Steinblöcke des Holocaust-Denkmals vorbei, weiter vorne erhob sich im tristen Grau des Himmels das Brandenburger Tor und dahinter die Kuppel des Reichstags. »Schatz«, begann Gangolf langsam, »wir werden demnächst zusammen nach Stuttgart reisen, du und ich – und ein traumhaftes Wochenende auf der Schwäbischen Alb verbringen. Ich kenn da ein herrliches Wellness-Hotel im Stauferland. Weißt du überhaupt, wo das ist?« Er versuchte, sie abzulenken.
»Das glaub ich erst, wenn wir dort sind«, kam es schnippisch zurück.
»Okay«, sagte er und gab wieder Gas, weil sich die Kolonne in Bewegung setzte, »ich meld mich aber heut noch mal.«
»Und ich? Wann erfahr ich, was meine Aufgabe ist? Oder bin ich nur das Betthäschen, wenn der Herr Ministerialdirektor ein paar besondere Stunden erleben möchte?«
»Ich bitt dich, Schatz, das darfst du nicht sagen. Du weißt genau, wie aufregend ich dich finde – aber nicht nur das.«
»Ja, wenn ich im Ledermini die Sekretärin des Herrn Politikers spiele und ihn derart durcheinander bringe, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen kann.«
Er wusste, worauf sie anspielte. Vor einigen Wochen, als er sie bei einem Galaempfang als seine Sekretärin vorgestellt hatte, war sie derart betörend gekleidet gewesen, dass er beim üblichen Smalltalk völlig aus dem Konzept kam. Jetzt fuhr er am Lehrter Bahnhof vorbei, um wenig später, beim Invalidenpark, in die Scharnhorststraße einzubiegen, wo sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit befand.
»Wir reden heut Abend drüber, bitte, Schatz«, bat er und beendete das Gespräch. Er durfte sie nicht verärgern, denn die Aufgabe, die sie übernehmen musste, war bereits klar umrissen. Außerdem wusste sie schon verdammt viel, dachte Gangolf.
Das Lokal bot einen traumhaften Blick über die Rebenhänge ins Neckartal hinunter, auch wenn dort heute dünne Nebelfetzen hingen. Auf einem Hügel, der ›Württemberg‹ genannt wurde, thronte die Grabkapelle jenes Adelsgeschlechts, das von dieser Landschaft stammte. Das Örtchen Rotenberg schien sich an den schmalen Ausläufer des Schurwaldes zu klammern, der hier das Neckar- vom nördlichen Remstal trennte. Im Rotenberger ›Weingärtle‹, einem beliebten und renommierten Ausflugslokal, hatten sich an diesem letzten Montag im Mai vier Herren getroffen, die nicht nur der herrlichen Aussicht wegen, die man aus dem Wintergarten genießen konnte, hierher gekommen waren. Sie hatten den etwas abgeschiedenen Ort bewusst gewählt, um sich in Ruhe ihren Plänen widmen zu können.
Der Tisch, an dem sie saßen, stand in einer Ecke, sodass sie keine Angst zu haben brauchten, ihre Gespräche könnten von den Touristen belauscht werden, die mit einem Omnibus gekommen waren.
Vor den vier Männern lagen Schnellhefter und Notizzettel, dazwischen standen Rotweingläser.
»Gut vorbereitet«, lobte der Wortführer. Er kratzte sich mit der Kugelschreiber-Rückseite an der Schläfe. »Später wird man vielleicht sagen, alles habe an diesem Mainachmittag des Jahres 2005 begonnen.« Er lächelte und sah in freudig-gespannte Gesichter.
»Wenn es derzeit den Versuch gibt, Deutschland aufzurütteln, es wieder zu dem zu machen, was es einmal war, dann sind wir es, die an allererster Stelle stehen«, stellte er fest. »Ich habe es bereits dargelegt«, fuhr er mit gedämpfter Stimme fort, »wir können es uns unter keinen Umständen leisten, weiter in die Negativschlagzeilen zu geraten. Dieses Land …« Wieder schaute er sich vorsichtig um, doch es gab niemand, der hätte mithören können, »… dieses Land ist mit Politikergeschwätz nicht mehr zu retten. Die Wahl in NRW hat’s gezeigt. Genau so wenig nützen Appelle an die Wirtschaft, im Inland zu investieren. Das tut längst keiner mehr. Wer nicht begriffen hat, dass der Zug Richtung Osten abgefahren ist, hat den Blick für die Realität verloren.«
Seine Zuhörer nickten. Es waren drei Männer mittleren Alters, die ihre Jacketts lässig über die Stuhllehnen gehängt und die Krawattenknoten gelöst hatten. Der Wortführer verschaffte sich nun auf dieselbe Weise Luft.
»Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Pfisterer«, meldete sich ein ziemlich glatzköpfiger Mann zaghaft zu Wort, »es ist aber, wenn ich Sie richtig verstehe, trotzdem daran gedacht, auch noch eine Politikerrunde einzuberufen?«
»Richtig«, entgegnete Pfisterer und rückte sein Jackett auf der Stuhllehne zurecht, »auf den Zeitplan komme ich nachher zu sprechen, Herr Doktor Rollinger. Allerdings müssen wir flexibel bleiben, wenn der Kanzler bei seiner Ankündigung bleibt, bereits im September Neuwahlen anzuberaumen.« Er öffnete einen Aktenkoffer, den er neben sich auf dem Boden stehen hatte, und brachte einige Kopien zum Vorschein, die er seinen Zuhörern vorlegte. »Punkt eins«, dozierte er dann, »dabei möchte ich über die allgemeine Struktur referieren, Punkt zwei behandelt die Finanzierung und Punkt drei die praktische Umsetzung.«
»Nehmen Sie bitte noch einen Punkt vier auf«, bat der Mann, der dem Wortführer gegenübersaß, »wir sollten auch gleich abklären, wie unsere Handlungsweise sein wird, falls etwas an die Öffentlichkeit dringen sollte – falls plötzlich die Medien Wind davon kriegen und ein Riesenspektakel losgeht.«
Der Angesprochene nickte wortlos und notierte diesen Vorschlag.
»Dann lassen Sie uns zur Sache kommen«, wurde er wieder offiziell, »es geht um die allgemeine Struktur. Unser Ziel wird es sein, innerhalb der nächsten drei Monate, also während der Sommerpause, so viel wie möglich Vertraute zu gewinnen. Das kann nur in Einzelgesprächen erfolgen, diskret und vertraulich. Es sollte möglich sein, nach Art des Schneeball-Systems vorzugehen. Jeder kontaktet weitere Personen seines Vertrauens.« Pfisterer räusperte sich und nahm einen Schluck. Dabei sah er auf die vernebelten Rebenhänge hinaus. »Wenn ich von ›Kontakten‹ rede, meine ich Gespräche unter vier Augen. Also keine schriftlichen Vorgänge, keine Mails und keine Telefonate.«
Die Zuhörer nickten.
»Denken Sie an Ihre persönlichen Beziehungen«, fuhr Pfisterer fort, »an Geschäftspartner, an Ihre Freunde im Golf- oder Segelclub.« Er blickte in die Runde. Zumindest von Rollinger, der links von ihm saß, wusste er, dass er irgendwo auf der Alb ein begeisterter Golfspieler war.
»Vielleicht gehören Sie den Rotariern oder den Lions an – oder Sie sind Mitglied im Klub Kochender Männer, ist ja, wie ich weiß, in unseren Kreisen inzwischen auch sehr beliebt. Überall können Sie bei einem Gläschen gutem Württemberger Rotwein dezent unser Anliegen zur Sprache bringen. Eine Empfehlung sei hier gegeben: Sollten Sie spüren, dass Ihr Gesprächspartner Ihnen mit Skepsis begegnet, dann tun Sie das Angesprochene als kleines Späßchen ab. Niemals, ich sage: Niemals sollten Sie penetrant sein. Das könnte Argwohn wecken.«
Zwei der Männer machten sich Notizen. Von den weiter entfernt stehenden Nebentischen drang Gelächter herüber.
»Natürlich ist Vorsicht geboten, allergrößte Vorsicht«, erklärte Pfisterer weiter, »gefragt ist Ihre Menschenkenntnis, Ihr Geschick im Umgang mit den Menschen. Vielleicht ist es dienlich, erste Kontakte bei der Vergabe eines Auftrags zu knüpfen. Aber denken Sie daran: Ein Irrtum kann fatale Folgen haben. Um nicht zu sagen verheerende Folgen. Sollte auch nur die kleinste Kleinigkeit nach außen dringen, wird es einen Skandal ungeahnten Ausmaßes geben. Dessen müssen wir uns bewusst sein.«
Eine weitere kurze Pause nutzte der Mann, der an dem kleinen quadratischen Tisch rechts von Pfisterer Platz genommen hatte, um das Gesagte mit ernstem Gesicht zu bekräftigen: »Alles, was nach außen dringt, kann tödlich sein, meine Herren.«
Der Vierte in der Runde meinte süffisant: »Geld und Macht – und dann noch Politik. Fürwahr ein explosives Gemisch.«
»Das wird einen Aufschrei geben«, stellte Ute Siller fest. Die attraktive Mittvierzigerin im dunkelblauen Hosenanzug hatte sich in dem schwarzen Ledersessel zurückgelehnt. Als Leiterin der Finanzabteilung des Unternehmens war sie von ihrem Chef bereits frühzeitig in das Vorhaben eingeweiht worden. Nun saß sie ihm und dem Leiter der Abteilung Produktion gegenüber. Sie hatten sich im kleinen Konferenzraum getroffen, dessen schneeweiße Wände von großformatigen Fotografien dominiert wurden, die Großaufnahmen von Metallpräzisionsteilen zeigten.
»Wir müssen jetzt an die Öffentlichkeit«, stellte Matthias Nullenbruch fest, angegrauter Geschäftsführer des Metallteile-Unternehmens, das seit Jahrzehnten eines der größten Zulieferer für die Automobilbranche war. Wie viele Betriebe im Großraum Stuttgart, so war auch ›Nubru‹ letztlich auf die Aufträge vom ›Daimler‹ angewiesen, wie man hier zu sagen pflegte. Allerdings hatte man sich im Laufe der Zeit auch ein zweites Standbein geschaffen und Kontakte zu anderen Fahrzeugherstellern geknüpft.
Wolfgang Meckenbach, Produktionsleiter und von überaus sportlicher Erscheinung, kniff die flinken Augen zusammen und löste seine Krawatte: »Ich seh es wie die Kollegin«, gab er zu bedenken, »es wird einen Aufschrei geben. Die Belegschaft wird mit Warnstreiks reagieren – und die Gewerkschaft veranstaltet einen Riesenwirbel.«
Nullenbruch, für seine einsamen Entschlüsse bekannt und gefürchtet, verzog keine Miene. »Wir werden uns von nichts und niemandem beirren lassen. Jetzt sind die Zeiten des Wandels gekommen – jetzt müssen wir Zeichen setzen. Schauen Sie doch nach Nordrhein-Westfalen! Auch für uns ist die Zeit reif, überreif. Wir berufen für morgen, nach der Mittagspause, eine Betriebsversammlung ein – und dabei werde ich bekannt geben, was zu sagen ist.« Seine Stimme klang energisch.
Meckenbach legte die Beine übereinander und blickte durch die große Fensterfront zu den wolkenverhangenen Bergen der Schwäbischen Alb hinüber. Der Firmenkomplex befand sich in einem dieser Gewerbeparks, wie sie in den vergangenen Jahren überall im Großraum Göppingen entstanden waren, sozusagen vor den Toren Stuttgarts, rund 40 Kilometer von der baden-württembergischen Landeshauptstadt entfernt.
»Wenn ich mir den Hinweis erlauben darf«, begann Ute Siller irritiert, ohne aber den festen Klang in ihrer Stimme zu verlieren, »noch bestünde keine Notwendigkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, die Sache wird erst in eineinhalb Jahren spruchreif.«
Nullenbruch schaute sie finster an, doch sie hielt seinen Blicken stand, wie immer. »Ich will nicht, dass es Gerüchte gibt«, sagte er, »Sie kennen die Stammtischparolen, das Hetzgeschwätz der Gewerkschaftsfunktionäre und dieser Betriebsräte. Sie kennen das«, wiederholte er scharf, »ich hab mich entschlossen – und jetzt werden Zeichen gesetzt.« Auf Nullenbruchs hoher Stirn begannen sich Schweißperlen zu bilden. Im Raum war es stickig.
Meckenbach spielte mit einem goldbesetzten Füllfederhalter. »Die Medien werden natürlich auch Fragen stellen«, warf er ruhig und sachlich ein. Sofort traf ihn ein missbilligender Blick des Geschäftsführers. »Natürlich werden sie das«, erwiderte er leicht gereizt, »aber Sie werden doch nicht glauben, verehrter Herr Meckenbach, dass Unternehmensentscheidungen von den Medien beeinflusst werden? Ich bitte Sie, wie lange sind Sie jetzt im Geschäft?« Die Frage war eher rhetorischer Natur. »Nein«, meinte er und lehnte sich in seinem Sessel zurück, »wer ein Unternehmen führt, darf sich nicht von populistischen Kommentaren beeinflussen lassen. Weder von den Medien, noch von der Politik, falls es so etwas wie verlässliche Politik in dieser Republik überhaupt noch gibt.« Seine Stimme hatte einen verächtlichen Unterton angenommen.
»Die Auswirkungen auf unsere Auftraggeber sollten wir auch bedenken …«, machte Meckenbach vorsichtig weiter und musste sofort erkennen, dass der Geschäftsführer darüber wenig erbaut war.
»Denen haben wir doch zu einem Großteil unsere heutige Misere zu verdanken«, sagte er schnell, »Kostensenkungen jahrein, jahraus, das wissen Sie doch. Um jeden Cent wird gerungen. Hier billiger, da billiger – und wenn wir nicht mithalten, mein Gott, das wissen Sie doch«, er schaute seine beiden Gesprächspartner vorwurfsvoll an, »dann drohen sie mit den Billigbuden im Südosten. Und dann?« Er holte tief Luft. »Dann wird von uns allen hier nichts mehr übrig bleiben. Nichts mehr.«
Die Finanzverwalterin wusste, dass Nullenbruch in seiner Entscheidung nicht mehr umzustimmen war. Dennoch wagte auch sie einen Einwand: »Ich gebe Ihnen natürlich Recht, aber wir, die wir uns in der Betriebswirtschaft auszukennen glauben, müssen doch mit gewisser Sorge die Entwicklung verfolgen. Wer soll denn hierzulande eines Tages die billig im Ausland produzierten Waren noch kaufen – wenn die Menschen hier zuhauf arbeitslos sind?«
Nullenbruch winkte verärgert ab. »Bitte Frau Siller«, schüttelte er geradezu angewidert den Kopf, »wir sind hier bei keiner Gewerkschafterkonferenz! Alles, was Sie hier einwenden, haben nicht wir, die Unternehmer, zu verantworten, sondern diese Regierung in Berlin. Aber nicht erst seit diese Rot-Grünen ihr Unwesen treiben, nein, die Wurzel für dieses Übel liegt tief, sehr tief. Und das Schlimmste ist, meine Herrschaften, dass es keinerlei Aussicht auf Änderung gibt. Egal, wer in Berlin das Sagen hat, es geht nur um Macht und Geld, um Einfluss und Schönreden.« Nullenbruch sah, dass Meckenbach Anstalten machte, etwas einzuwenden. Um dies zu verhindern, sprach er schnell weiter: »Manche in diesem Lande predigen in ihren Sonntagsreden davon, wie wichtig es sei, dies und jenes zu veranlassen, weil sonst der Karren an die Wand fahre. Doch diese Traumtänzer haben noch gar nicht bemerkt, dass der Karren bereits in Trümmern vor der Wand liegt. Weil er ungebremst, ja sogar noch bewusst mit Vollgas, dagegen gekracht ist. Und zwar bereits gestern.«
Meckenbach wollte nun nichts mehr sagen. Er war insgeheim froh, dass in diesem Moment das Telefon auf dem Glastischchen summte. Nullenbruch nahm ab und meldete sich nur mit einem kurzen »Ja?«
Er lauschte und gab seinen beiden Besuchern mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass die Konferenz damit beendet sei. Sie standen nickend auf und verließen den Raum. »Okay, Leo«, sagte Nullenbruch einigermaßen verärgert und schaute auf seine Armbanduhr, »hab ich verstanden. Sagen wir 22.45 Uhr?« Nullenbruch nickte. »Ich weiß, wo das ist.«
3
Die Wälder an den Berghängen der Schwäbischen Alb waren von Nebelschwaden verhüllt, als sei es November. Eine Kaltfront war der Grund und die hatte das frische Grün der Hänge in ein tristes Grau gehüllt. Wer jetzt nicht raus musste, blieb an so einem Tag in der beheizten Wohnung.
In den Sportanlagen im Eybacher Tal herrschte trotzdem reger Betrieb, denn die Fußballer trainierten für die letzten Spiele der Saison. Hier, am Rande der Kleinstadt Geislingen/Steige, gerade mal 30 Kilometer von Ulm entfernt, befanden sich die Stadien einiger Vereine. Dazu zählte auch die Anlage des Sportclubs Geislingen, dessen Fußballer sich einstens rühmen konnten, die Besten der Amateure zu sein. Das war damals, 1984, als sie den Hamburger Sportverein aus dem Pokal geschossen hatten – mit einem legendären 2:0, was in allen Fernsehsendern für Aufsehen gesorgt hatte. Auch jetzt noch, so lange Zeit danach, galt der SC Geislingen deshalb als HSV-Killer.
Die jungen Kicker von heute freilich kannten diese glorreiche Zeit nur noch vom Hörensagen. Sie mühten sich in der Landesliga ab und waren froh, einen Mittelplatz zu halten. Ein paar hundert Meter weiter, im Stadion der Turngemeinde, zogen an diesem Abend trotz des Nieselregens noch einige Leichtathleten ihre Runden. Und auch die Reitsportler, deren Anlagen sich talaufwärts anschlossen, trotzten der Witterung.
Nur der Waldweg, der an den Sportanlagen entlang führte, lag verlassen. An lauen Abenden war er bei Spaziergängern und Joggern beliebt – nicht aber heute bei dieser unwirtlichen Witterung.
Auch die Terrasse der Sportclub-Gaststätte wirkte einsam und trist. Auf regennassen Tischen und Stühlen spiegelte sich der graue Himmel. Während es im beheizten Innern des Lokals kaum noch einen freien Platz gab, hatten sich drei Männer in den dunklen Vereinsraum zurückgezogen, der sich im angrenzenden Tribünen-Komplex befand. Der Gastgeber war voraus durchs dunkle Treppenhaus geeilt und ein bisschen außer Atem geraten. Auf seinem nahezu kahlen Kopf hatten sich trotz der Kühle Schweißperlen gebildet. Nachdem er den Besuchern Plätze angeboten hatte, öffnete er ein Fenster, um die vor Tagen angestaute warme Luft aus dem holzgetäfelten Raum entweichen zu lassen. Die Wände waren ringsum mit Regalen versehen, auf denen sich silbern glitzernde Pokale jeder Größe stolz präsentierten.
»Etwas zu trinken?«, fragte der Gastgeber, der sich als ehemaliger Vereinsfunktionär in den Räumlichkeiten auskannte. Er holte das gewünschte Mineralwasser aus einem Kühlschrank und schenkte ein. »Nun, dann also nochmal herzlich willkommen im Eybacher Tal«, kam er schließlich zur Sache und lächelte den Besucher an. »Wir – ich meine, unser Vorstandsmitglied Dieter Funke und ich, wir freuen uns immer, wenn sich erfolgreiche Männer wieder an den Ort ihrer Anfänge besinnen. Mein Gott, was waren das für Zeiten!« Er blickte zu den Pokalen hinauf. »Noch heute redet eine ganze Generation vom HSV-Spiel. Das Eybacher Tal hat gebebt. Tausende waren da – sogar auf den Felsen da oben sind sie gestanden.«
Der Besucher lächelte und nickte. »Danke für die herzliche Begrüßung, Heini.«
Dieter Funke, wesentlich jünger und damals noch im frühesten Jugendalter, erinnerte sich ebenfalls an dieses legendäre Spiel gegen den Hamburger Sportverein. »Das wird noch in hundert Jahren in der Vereinschronik nachzulesen sein«, meinte er. Von draußen drang ein kühler Luftzug herein. Es hatte zu dämmern begonnen und Funke knipste das Licht an.
»Unser Club «, meinte Heini, der mit Nachnamen Heimerle hieß, »hat viele große Namen hervorgebracht. Den Allgöwers-Karl, der später bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB gespielt hat – dich …« Er lächelte. »Und natürlich den Klinsi, den Jürgen Klinsmann, der hat noch, das weißt du, nach deiner Zeit bei uns gespielt, von 74 bis 78. Wer hätte damals gedacht, dass der mal Bundestrainer wird – und dies sogar zur Weltmeisterschaft?« Heimerle nahm einen Schluck Mineralwasser, sodass sich eine geradezu andächtige Stille einstellte. »Aber Klinsi hat was drauf. Der ist keiner von denen, die nur schwätzen und eine große Klappe haben. Nein, Klinsi ist ein echter Schwabe. Ärmel aufkrempeln, zupacken.« Und er fügte hinzu: »Einer, genau wie du, Leonhard. Wir freuen uns, dass auch du es zu was gebracht hast.«
Leonhard Lanski nahm ebenfalls einen Schluck Mineralwasser. »Danke für das Kompliment, liebe Freunde. Ich fühl mich hier nach wie vor zu Hause.« Dann wandte er sich an Heimerle: »Ich hab dir am Telefon gesagt, dass ich in Stuttgart zu tun hatte und mal wieder einen Abstecher hierher machen wollte …«
»Du wolltest aber nur mich sprechen …« stellte der Ex-Funktionär vorsichtig fest, »… mich und Dieter.«
Lanski lehnte sich auf dem gepolsterten Stuhl zurück. »Den Dieter auch deshalb, weil er sich in der Branche auskennt«, erklärte er zögernd und schaute seinen beiden Gegenüber fest in die Augen.
»Du meinst den Fußball?«
Lanski lächelte und nickte. »Ja, was sonst auch – und dich, Heini, hab ich als ehrlichen Kumpel geschätzt. Das heißt, ich tu’s noch immer.« Und an Funke gewandt, meinte er: »Dich kenn ich noch, als du in der A-Jugend gespielt hast. Inzwischen hab ich viel von dir gehört.« Der Angesprochene fühlte sich geschmeichelt.
Lanski schaute zur geschlossenen Tür hinüber, um sich zu vergewissern, dass niemand mithören konnte. »Freunde, ich hab mir lange überlegt, was ich tun soll. Sehr lange. Soll ich zu einem Rechtsanwalt gehen? Oder stillhalten? Dann hab ich mich entschieden, meine Freunde zurate zu ziehen. Auch wenn ich euch damit womöglich in Gefahr bringe.«
Heini Heimerle schluckte. Instinktiv griff er nach einem Bierdeckel, um ihn nervös zwischen den Fingern zu drehen. Funke schenkte sich noch ein Glas Mineralwasser ein.
»Ich bin gekommen, weil ich jemanden brauche, mit dem ich darüber reden kann. Ihr müsst mir allerdings schwören, versteht ihr: schwören, dass nichts davon an die Öffentlichkeit dringt.«
Die beiden Männer hörten schweigend zu und spürten, welche Bedeutung das kurzfristig anberaumte Treffen haben würde. Lanski hatte erst gestern bei Heimerle angerufen und ihn um ein Gespräch gebeten, das unter sechs Augen stattfinden sollte, ohne zu sagen, worum es ging.
»Wir sind hier abhörsicher?«, fragte Lanski und blickte sich um.
Heimerle, in dessen Glatze sich das Licht der schweren, sechsflammigen Lampe über dem Tisch spiegelte, war irritiert. Mit so einer Frage war er noch nie konfrontiert worden. Funke nahm sie zum Anlass, das Fenster zu schließen und die Vorhänge zuzuziehen. Ehe er zum Tisch zurückkam, öffnete er die Tür und vergewisserte sich, ob draußen im Treppenhaus jemand lauschte. Doch da war niemand.
»Wir sind ganz unter uns«, stellte Heimerle dann fest. »Ach ja, wollt ihr jetzt lieber ein Bier?«
Die beiden Männer nickten und verlangten ein Weizen.
Funke holte es aus dem großen Kühlschrank und mühte sich ab, das stark schäumende Getränk in die Weizenbiergläser zu gießen.
»Wir können in aller Ruhe sprechen«, meinte Heimerle.
Lanski war froh, auf verständnisvolle Zuhörer getroffen zu sein. Er hatte auch nichts anderes erwartet.
»Ich weiß nicht, was wir tun können, aber wenn keiner was tut, findet die größte Sauerei statt, die es in diesem Land jemals gegeben hat.«
Heimerle und Funke saßen wie elektrisiert auf ihren Stühlen.
»Naja«, räumte Lanski mit einem gezwungenen Lächeln ein, »zumindest, was bisher bekannt geworden ist. Was sonst so hinter den Kulissen läuft und nie an die Öffentlichkeit kommt, wissen wir ja nicht.«
»Wir können dir schwören, dass alles, was hier drin heut Abend gesprochen wird, unter uns bleibt«, versprach Heimerle.
»Ich danke euch. Dann will ich erzählen, was mich belastet. Aber, wenn die, um die es hier geht, auch nur den geringsten Verdacht hegen, was ich euch erzähle, dann könnten wir alle sehr in Gefahr kommen. Wisst ihr, was mir Sorge bereitet?« Die Zuhörer schwiegen, sodass sich Lanski selbst die Antwort gab: »Ich hab wirklich Angst, dass auch Klinsi da reingerät.«
Das Hotel ›Slovan‹ war das größte in der Stadt, auch, was die Zahl der Stockwerke anbelangte. Es markierte den Beginn der Hauptgeschäftsstraße in Košice, die Hlavnaulicá, und stammte noch aus jenen Zeiten, als der Ostblock als ›Reich des Bösen‹ abgetan worden war. Nach der Wende hatte sich in dieser slowakischen Stadt, unweit der Hohen Tatra und der Grenze zur Ukraine, gleich reges Geschäftsleben gerührt. Und wie überall hatten auch hier sofort die großen Handelsketten Fuß gefasst und der einst tristen Innenstadt ein buntes Erscheinungsbild verliehen, ohne alte Strukturen zu zerstören. Ganz im Gegenteil. Den Kommunalpolitikern war es gelungen, die liebenswerten alten Fassaden zu restaurieren und sogar historisch wertvolle Funde zu erhalten. Das ›Slovan‹ reckte sich als Überbleibsel sozialistischer Prunkhotels in den Himmel, war jedoch inzwischen dem modernen Standard angepasst worden. Viel schlimmer wirkten hingegen die mehrstöckigen Plattenbauten, die an den Stadträndern wie ein böser Albtraum die Anhöhen verunstalteten – als seien’s Stein gewordene Zeugen jener Jahre, in denen Wohnkasernen Fortschritt symbolisierten.
Das ›Slovan‹ war beliebter Treffpunkt der Geschäftsleute und Geschäftemacher aus dem Ausland. Hier, in dem weitläufigen, nur mit Kunstlicht erhellten Foyer, an das die Polstergruppen der angegliederten Bar grenzten, wurden seit der politischen Wende unzählige Kontakte geknüpft – und wie man den Eindruck gewinnen konnte, nicht nur geschäftlicher Art.
In jener Ecke, die am weitesten von dem großen Tresen der Bar entfernt war, saßen an diesem Abend drei hochgewachsene, junge Frauen, die immer wieder die Blicke der überwiegend männlichen Gäste auf sich zogen. Die hellblonden Damen waren äußerst sommerlich angezogen und ihre Kleidchen so kurz, dass wirklich nur das Allernötigste bedeckt wurde. Sie hatten bereits ihre bestellte Cola serviert bekommen und schienen in Gespräche vertieft zu sein und sich zu amüsieren. Als eine von ihnen zur Toilette stöckelte, wozu sie sich einen Weg durch die Reihen der Sitzgruppen suchen musste, um dann abseits der Rezeption zu verschwinden, hingen die Augen der Männer geradezu gierig an ihr. Sie war sich dieser Wirkung bewusst, weshalb sie umso provokativer mit den Hüften schwang.
Auch die beiden Männer, die gerade durch die automatisch aufschwenkende Glastür gekommen waren, hatten ihr für einen Moment hinterher geschaut. Dann aber ließen sie ihre Blicke über die Sitzgruppen der Bar streifen und erkannten, wo ihr Ziel sein würde. Die beiden Blondinen waren schließlich nicht zu übersehen gewesen.
Sie lächelten den Frauen schon von weitem zu. Sie sprachen slowakisch, begrüßten sich mit einem Küsschen auf die Wangen und nahmen an dem ovalen Couchtisch Platz. Einer der Männer streichelte den Oberarm einer der Frauen. Sie schien es zu genießen. Der andere Mann machte eine charmante Bemerkung, die schallendes Gelächter hervorrief. Unterdessen näherte sich bereits die Bedienung. Ihr Gesichtsausdruck verriet Missmut. Die Männer bestellten Bier, als die dritte Dame von der Toilette zurückstöckelte und sich nun ebenfalls mit Küsschen begrüßen ließ.
Sie unterhielten sich eine Viertelstunde, während der die Damen immer wieder kicherten. Schließlich deutete eine von ihnen auf zwei Männer, die langsam und offenbar suchend an den äußeren Sitzgruppen dieser Bar entlang gingen. Der eine war weißhaarig und korpulent, der andere schlank und jünger.
Die Slowaken drehten sich um und hoben kurz die Arme, um sich gegenüber den Neuankömmlingen bemerkbar zu machen. Augenblicke später hatten die beiden Gäste den Tisch erreicht und die drei lächelnden Blondinen und deren männliche Begleiter mit Handschlag begrüßt.
»Welcome in Košice«, begrüßte sie einer der Slowaken und verzog dabei sein Gesicht zu einem strahlenden Lachen. Auf seinem kahlen Kopf, den nur ein schmaler Haarkranz umgab, hatten sich feine Schweißperlen gebildet. Der andere Mann, ein sportlich ergrauter Sechziger, wirkte souverän und vornehm, trug Jeans, Strickpulli und Turnschuhe. »Ich heiße Sie auch herzlich willkommen«, sagte er, ohne seine amerikanische Herkunft verleugnen zu können. »Wie war die Reise?«
Der weißhaarige Deutsche gab sich energisch. »Was nimmt man nicht alles in Kauf, wenn man solche Nachrichten erhält?« Mit einem eher gekünstelten Lächeln versuchte er, die Schärfe seiner sonoren Stimme zu mildern.
»Wir hätten uns einen angenehmeren Aufenthalt hier vorstellen können«, ergänzte sein Begleiter, dessen blondes Haar offenbar seit der Abfahrt in Deutschland nicht mehr gekämmt worden war.
Die Männer zogen sich zwei freie Polsterstühle von Nebentischen heran und bestellten Bier, als die Beine der Bedienung in ihr Blickfeld kamen.
»Die Damen hier«, begann der Amerikaner langsam und deutete lächelnd auf die Begleiterinnen, »sind unsere Sekretärinnen. Sie sind über alles informiert. Sie wickeln den Schriftverkehr ab.«
»There ist no problem, no problem«, ergänzte der rundliche Slowake, den sie Jano nannten. Er schien ebenfalls um eine lockere Atmosphäre bemüht zu sein. Als das Bier serviert wurde, prosteten sie den Gästen aus Deutschland und den Damen zu.
Der Weißhaarige genoss das erfrischende Getränk, blickte aber den Gastgebern kritisch in die Augen. »Um es klar zu sagen«, begann er eine Spur zu laut, weshalb er seine Stimme sofort dämpfte, »wir sind nicht zum Amüsieren hergekommen, sondern, weil wir uns große Sorgen machen.« Sein Kollege nickte.
»Yes«, entgegnete der Amerikaner, dem nachgesagt wurde, ein erfolgreicher Geschäftsmann in den Staaten zu sein. Jano war sein Schwager und eigentlich auch erfolgreich – nur schien bei ihm jetzt etwas kräftig daneben gegangen zu sein. »Es hat Probleme gegeben«, fuhr der Amerikaner sachlich fort, »große Probleme.«
Jano, der gerade erst das Gegenteil behauptet hatte, schwieg. Ob er Deutsch verstand, war den beiden Gästen auch bei vorausgegangenen Besuchen nie ganz klar geworden. Möglicherweise, so hatten sie einmal gemutmaßt, war er der deutschen Sprache durchaus mächtig, hielt dies aber verborgen, um seine Geschäftspartner in Sicherheit zu wiegen. Jano war nicht nur ein gerissener Businessman, sondern auch ein Schlitzohr. Er hatte bei seinem Schwager in den USA bereits vor der politischen Wende gelernt, womit eine Menge Geld zu machen ist.
Der Weißhaarige, der einen hünenhaften Oberkörper hatte, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. Sein jüngerer Begleiter schlug die Beine übereinander, während die drei Damen gespannt von einem Mann zum anderen schauten.
»Es ist alles ganz gut gelaufen«, machte der Amerikaner mit dem typischen US-Akzent weiter, »sehr gut. Doch vor einem Jahr kam der Augenblick, dass Jano die Zinszahlungen an Sie hat einstellen müssen.«
»Das haben wir gemerkt«, kommentierte der Weißhaarige säuerlich-grinsend. Sein Gesicht war hochrot geworden.
»Deshalb bin ich jetzt rübergeflogen«, erklärte der Geschäftsmann und begann, mit einem Kugelschreiber zu spielen, »Jano hat meine Hilfe gebraucht.« Der Amerikaner schaute sich vorsichtig um, nahm die Personen an den anderen Tischen ins Visier und beugte sich nach vorne, um leiser weiterreden zu können: »Jano ist in Schwierigkeiten geraten.« Sein Schwager tat tatsächlich so, als verstünde er kein Wort. »Wir haben sehr viel Geld bezahlen müssen, weit mehr als hunderttausend Euro«, erklärte der Amerikaner und kam den anderen noch ein Stück näher: »Sie haben gedroht, Jano umzubringen.«
Die beiden Deutschen runzelten die Stirn, wollten ihren Gesprächspartner aber nicht unterbrechen. Der wusste auch so, was sie interessierte. »Die Mafia«, flüsterte er.
Lanski fühlte sich erleichtert. Das ehemalige Vorstandsmitglied des Vereins, in dem er einmal Fußball gespielt hatte, war ein weitsichtiger Mensch – ebenso der junge Dieter Funke, ein Sportfunktionär, der etwas von der Branche verstand. Sie hatten ihm zugehört, aufmerksam, ungläubig, voll Entsetzen – und sie versprachen schließlich, ihm zu helfen, obwohl keiner von ihnen wusste, was dies letztlich bedeutete. Sie wollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und mit niemandem darüber reden.
Die drei Männer hatten fast drei Stunden diskutiert, sich gegenseitig Fragen gestellt und Zweifel geäußert. Funke war mehrfach vor die Tür gegangen, um sich zu vergewissern, dass es keine heimlichen Lauscher gab. Doch die Stimmen und Tritte im Treppenhaus gehörten zu Sportlern, die aus der Halle unter der Tribüne kamen.
Lanski atmete tief durch, als er allein das Gebäude verließ. Er schwitzte und genoss die Abkühlung, die ihm unter der Tür entgegenschlug. Es nieselte. Auf der Terrasse brannten einsam die Laternen und spiegelten ihr Licht in den Pfützen. Durch ein schräg gestelltes Fenster der Gaststätte drangen Gelächter und Musik heraus. Lanski eilte an der Eingangstür vorbei und war insgeheim froh, dass er niemanden traf. Er wäre nicht in der Stimmung gewesen, sich jetzt noch mit einem alten Bekannten zu unterhalten.
Denn er hatte noch einen zweiten, wichtigen Termin an diesem Abend. Es war kurz vor halb elf und das Tal längst dunkel, als er mit seinem schwarzen Aktenkoffer das beleuchtete Gelände des Sportclubs verließ und die nur mäßig erhellte Zufahrtsstraße betrat, die sich hier in verschiedene Richtungen gabelte. Er nahm den Weg durch die Unterführung unter der Landstraße, um auf der anderen Seite die zweihundert Meter bis zum vereinbarten Treffpunkt zu gehen, vorbei an einigen Häusern, die sich an die alte Landstraße reihten. Er spürte, wie sich der Nieselregen auf seine Kleidung legte. Schon nach wenigen Minuten hatte er den Parkplatz hinter den Gebäuden einer Bauunternehmung erreicht, die sich direkt an den steilen Damm der Eisenbahn-Hauptlinie Stuttgart-Ulm schmiegte, hinter dem das eigentliche Stadtgebiet lag. Dessen Lichterflut erhellte den nebligen Himmel.
Lanskis Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, sodass er die Silhouetten der Betriebsgebäude und des Bahndamms deutlich erkannte. Er sah auch das geschlossene Metalltor und die asphaltierten Freiflächen davor. Enttäuscht stellte er fest, dass dort kein Auto stand. Vermutlich war er noch einige Minuten zu früh. Er verlangsamte seinen Gang und schlenderte an dem Metallzaun entlang, während sich das Rattern eines Güterzugs näherte.
Lanski hatte endlich Zeit, über alles nachzudenken. Dieser Treffpunkt hier, daran bestand gar kein Zweifel, war ungewöhnlich. Denn ihm wäre es lieber gewesen, den Termin im Hotel ›Krone‹ stattfinden zu lassen, wo er ohnehin telefonisch ein Zimmer gebucht hatte. Doch sein Gesprächspartner war bereits bei einem Telefongespräch vor drei Tagen darauf bedacht gewesen, einen neutralen Ort zu wählen. »Kein Lokal, man würde mich kennen – am besten irgendwo in freier Natur«, hatte er energisch gebeten.
Nachdem Lanski erklärt hatte, dass er in Geislingen zu tun haben würde, war es ihm überlassen geblieben, einen geeigneten Treffpunkt vorzuschlagen. Angesichts der Tatsache, dass er seine Sportsfreunde im Eybacher Tal besuchen wollte und er auf ein Taxi angewiesen war, hatte er den Firmenparkplatz unweit des Fußballstadions vorgeschlagen. Hier kam, von Hundebesitzern vielleicht abgesehen, die ihren Vierbeiner Gassi führten, mit Sicherheit niemand vorbei. Niemand konnte ihnen zuhören, niemand Mikrofone und Sender installieren. Lanski hatte ja nicht ahnen können, dass das Wetter derart mies sein würde, jetzt Ende Mai.
Lanski ertappte sich immer häufiger bei dem Gedanken, er würde bespitzelt. Nie zuvor hatte er seine Umwelt so kritisch und aufmerksam verfolgt, wie seit einigen Monaten. In Gesprächen achtete er auf jede Formulierung, auf jede Bemerkung – und er selbst legte inzwischen jedes Wort, ehe er es aussprach, auf die Goldwaage. Er hatte längst erkannt, dass die Sache mehr war als ein Spiel. Viel mehr. Unweigerlich musste er an Anders Frisk denken, den international tätigen Fußball-Schiedsrichter aus Schweden, der im März von einem Tag auf den anderen zurückgetreten war, weil Unbekannte ihn und seine Familie mit Morddrohungen schockiert hatten.
Die Lok des talaufwärts fahrenden, scheppernden Güterzugs hatte jetzt den Bahndamm über ihm erreicht und ließ die Waggons vorüberziehen, die sich tiefschwarz vom helleren Hintergrund abhoben. Noch einmal ging er in Gedanken das Gespräch mit Heimerle und Funke durch. Sie waren bisher die Einzigen gewesen, denen er sich anvertraute. Zwar hatten sie natürlich keine Lösung gefunden, ja nicht einmal eine Strategie – doch hier in der Provinz, weit entfernt von den Macht- und Schaltzentren, konnte man wenigstens sicher sein, im Kreise guter Freunde eine solide Basis zu erhalten.
Das Gespräch, das ihm jetzt bevorstand, war aber nicht minder schwierig. Doch es musste sein. Aus mehreren Gründen. Das Rattern des endlos langen Güterzugs hämmerte sich in sein Gehirn. Nie zuvor war ihm bewusst geworden, wie damit ein ganzes Tal beschallt wurde – vor allem nachts, wenn es keine anderen Geräusche gab. Oder hatte er da soeben doch noch etwas gehört? Lanski drehte sich um und umklammerte instinktiv den Griff seines Aktenkoffers noch fester.
Plötzlich beschlich ihn das ungute Gefühl, irgendetwas könnte nicht in Ordnung sein.
Da war doch jemand.
4
Der junge Mann, der in einer roten Hotel-Uniform steckte, war mit den beiden Deutschen in den Aufzug gestiegen und hatte den Knopf fürs neunte Stockwerk gedrückt. Der Weißhaarige und sein jüngerer Freund hingegen wählten die sechste Etage. Als sich die Tür automatisch schloss, betrachteten sich die Gäste in den getönten Spiegeln der Kabine und stellten fest, dass sie übernächtigt aussahen. Während nacheinander die Kontrollleuchten für die einzelnen Etagen aufblinkten, drehte sich der junge Hotelangestellte zu den Männern um, überlegte kurz und fragte dezent: »Do you want a special service for the night?« Der Weißhaarige mit dem hochroten Kopf verstand nicht so recht. Sein Begleiter hingegen wusste sofort, was mit der Frage nach einem »speziellen Service für die Nacht« gemeint war. Er lehnte lächelnd ab. Ihm war nicht danach. Außerdem würde er kein Geld dafür ausgeben wollen. Inzwischen hatte der Aufzug die sechste Etage erreicht und die beiden Deutschen stiegen aus. Der Hotelboy fuhr sichtlich enttäuscht weiter. Die Vermittlung eines nächtlichen Services hätte sein Taschengeld aufgebessert.
Mittlerweile hatte auch der Weißhaarige begriffen, was gemeint war. Die beiden Männer lächelten und strebten durch den mit Teppichboden gedämpften Flur ihren Zimmern entgegen. »Sollen wir uns noch was aus der Minibar genehmigen?«, fragte der Ältere mit der sonoren Stimme. Der andere nickte und ließ sich gerne noch zu einem Drink im Zimmer seines Freundes einladen.
Es war inzwischen weit nach Mitternacht. Der Weißhaarige holte aus dem kleinen Kühlschrank zwei kleine Flaschen Pils, öffnete sie und goss den Inhalt in die beiden bereit stehenden Gläser. »Wo sind wir da reingeraten, Rainer?!«, sinnierte er und erfüllte mit seiner kräftigen Stimme den Raum. Sie hatten die Stühle mit den abgewetzten Polstern an das Tischchen gerückt, auf dem ein Fernsehgerät stand. Das Zimmer war eng.
Rainer, der Jüngere, kratzte sich im zersausten blonden Haar und kommentierte: »Räuber und Ganoven.« Er griff nach dem Getränk und hob das Glas.
»Das kannst wohl annehmen«, bekräftigte der Ältere, der seinen leicht bayrischen Dialekt nicht verbergen konnte – und es auch nicht wollte. Dann prosteten sie sich zu und nahmen einen kräftigen Schluck.
»Mensch, Martin, die haben ganz schön Schiss«, meinte Rainer und wischte sich Bierschaum vom Mund.
»Der Arsch geht denen auf Grundeis, mein Lieber. Da läuft mehr, als sie uns sagen wollen.«
»Natürlich, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Warum soll sich denn die Mafia an den Geschäftsführer einer vergleichsweise kleinen und harmlosen Firma heranmachen, die nur mit Baustoffen handelt? Das gibt doch keinen Sinn.«
Martin nickte und lehnte sich zurück, sodass die Lehne bedenklich knarrte. »Und noch im vergangenen Jahr war alles in Ordnung, verstehst? Der Jano hat große Töne gespuckt – und die Bilanz hat gestimmt.« Er legte eine kurze Pause ein. »Naja, zumindest, was ich rausgelesen hab. Aber Bilanzen kann man nach Belieben frisieren – das kennt man ja, verstehst?«
»Wie ist deine Einschätzung? Haben wir noch eine Chance, unser Kapital wieder zu kriegen?«
»Ich kann die Zweihunderttausend nicht einfach wegstecken.« Er holte tief Luft. »Zunächst mal vertrau ich auf den Amerikaner, der schon seiner Schwester zuliebe seinen Schwager nicht als Betrüger abstempeln lassen will.«
Rainer nickte wieder. Er hatte zwar nur einen Bruchteil von der Summe seines Freundes investiert, war aber nicht minder stark darauf angewiesen, das als Darlehen gewährte Geld wieder zu erhalten.
Vor vielen Jahren hatte alles so verlockend angefangen. Jano, der smarte, slowakische Geschäftsmann, dem Beziehungen bis in die höchsten politischen Ebenen seines Heimatlandes nachgesagt wurden, unter anderem sogar zum späteren Staatspräsidenten, war auf der Suche nach Geschäftspartnern durch Deutschland gereist. Ganz im Stile eines amerikanischen Businessman hatte er geredet und das Vertrauen von potenziellen Investoren gewonnen. Er hatte Ideen und den nötigen Elan – nur eben kein Geld. Dabei konnte er, gemessen an deutschen Verhältnissen, bereits mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz daheim etwas bewegen. Ein paar zehntausend Mark waren damals für ihn eine riesige Summe gewesen. Und weil in der Slowakei die Banken noch geradezu inflationäre Darlehenszinsen verlangten, oft über 20 Prozent, konnte er seinen Geldgebern gut und gern die Hälfte davon versprechen und es trotzdem verkraften.
Jano war es damals, Mitte der 90er Jahre, tatsächlich gelungen, Kapitalanleger zu finden, mit deren geldkräftiger Unterstützung er eine Firma aufbauen konnte, die in geradezu atemberaubender Weise expandierte und von der aufstrebenden Wirtschaft des kleinen Landes profitierte. Er bezahlte artig seine Zinsen und legte Bilanzen vor, die bei den jährlichen Gesellschafterversammlungen Freude aufkommen ließ. Als sich herumsprach, welch traumhafte Kapitalanlage eine Investition in ein slowakisches Unternehmen sein konnte, meldeten sich immer neue Interessenten bei Jano. Dass er ein Schwindler sein würde, hatte niemand gedacht. Und auch jetzt war sich Martin noch nicht sicher, ob Jano das viele Geld, das jetzt offenbar irgendwie verschwunden war, absichtlich veruntreut hatte oder ob er einfach zu hoch gepokert hatte – womit auch immer.
»Weißt«, meinte Martin, nachdem er einen kurzen Moment überlegt hatte, »letztlich ist’s mir wurscht, was da gedreht wurde. Ich will mein Geld wieder – und dann sehn die mich hier nie mehr. Nie mehr, verstehst?«
Rainer nickte. »Ich denk auch, wir sollten uns nicht allzu sehr in diese Sache einmischen. Der Amerikaner ist ehrlich bemüht, Gras über die Sache wachsen zu lassen.«
Martin holte tief Luft. »Du hast Recht. Weißt, mir ist heut Abend etwas eingefallen, was vor einigen Jahren einem Geschäftsmann aus dem Kreis Göppingen widerfahren ist.« Er holte ein weiteres Pils aus der Minibar und öffnete den Kronenkork. »Ich weiß zwar nicht, was er für Geschäfte gemacht hat. Aber weißt, was sie mit dem gemacht haben?«
Rainer zuckte mit den Schultern.
»Gekillt hab’n sie ihn. Erschossen. Regelrecht hingerichtet.« Martin schaute seinem Freund fest in die Augen. Seine Adern an den Schläfen waren hervorgetreten. »Erschossen – in Ungarn drübn.«
»Deshalb mein ich, es ist in diesen Gegenden vielleicht besser, man stellt nicht so viele Fragen.«
Rainer wurde bleich. »Vielleicht sollten wir Matthias anrufen.«
Martin nickte.
5
Bruhn, der energische und für seine cholerischen Anfälle bekannte Göppinger Kripochef, strich sich über die glänzende Glatze, die nur noch ein schmaler Haarkranz umgab. »Was?«, wiederholte er und drückte den Telefonhörer fest ans linke Ohr, »auf offener Straße?« Bruhn rückte mit dem Oberkörper an die Schreibtischkante heran und stützte sich mit den Ellbogen ab. Das hatte ihm an diesem eiskalten Dienstagmorgen gerade noch gefehlt. Der Schreibtisch voll mit Fragebögen und Personalakten, mit statistischen Anfragen des Innenministeriums und einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Hauptkommissar August Häberle – und jetzt eine Leiche. Er lauschte angestrengt und stieß plötzlich eine Frage aus, als habe er seinen Gesprächspartner jäh unterbrochen: »Womit erschossen?« Er hörte dem Anrufer noch kurz zu, brummte ein »mhm« und entschied abrupt: »Ich komm hoch – und bring den Häberle mit.« Dann legte er ohne ein Wort des Dankes oder des Abschieds auf – wie immer.
Wenig später ließ sich der Kripochef von diesem Häberle, der zwar einer seiner fähigsten Mitarbeiter war, aber leider Gottes kein Blatt vor den Mund nahm, im weißen Dienst-Mercedes auf der B 10 talaufwärts in Richtung Ulm chauffieren.
»Was weiß der Teufel, was da wieder dahinter steckt – und das bei diesem Sauwetter«, knurrte Bruhn und lehnte sich zurück, als sie Göppingen verließen, »bis jetzt weiß man noch nicht, wer der Tote ist.«
»Weibergeschichten«, mutmaßte Häberle einsilbig. In seinem langen Berufsleben hatte er einige Morde bearbeitet, hinter denen verschmähte Liebe oder Widersacher steckten. Was vordergründig nach politischen oder geschäftlichen Motiven aussah, entpuppte sich oftmals als eine Beziehungstat. Häberle, jahrelang beim Landeskriminalamt Stuttgart für die schwierigsten Fälle zuständig gewesen und nun wieder, knapp acht Jahre vor der Pensionierung, im heimischen Göppingen tätig, ließ sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen – auch wenn Bruhn bereits wieder großen Presserummel befürchtete und im Geiste sämtliche einflussreichen Kreise in Aufruhr vermutete.
»Halten Sie sich bloß mit Vermutungen über Weibergeschichten zurück«, erwiderte der Kripochef. Es klang wie ein Befehl. »Das hetzt uns gleich die Boulevard-Presse auf den Hals. Mir reichen schon die hiesigen Radau-Journalisten.«
Häberle, der sich im täglichen Stop-and-go-Verkehr durch Eislingen quälte, wollte nichts dazu sagen. Er wusste, dass Bruhn ein gestörtes Verhältnis zu den Medien hatte – es sei denn, sie richteten eine Fernsehkamera auf ihn.
»Kein Auto bei der Leiche?«
»Nichts«, brummelte Bruhn, »keine Tasche, nichts. Liegt einfach so rum – schon einige Stunden, haben die Kollegen gesagt.«
Häberle schaute seinen Chef von der Seite an: »Das hört sich nicht gut an. Dann wird’s auch kaum jemand geben, der an dieser gottverlassnen Ecke etwas beobachtet hat.«
»Das rauszukriegen, ist Ihr Job«, konterte Bruhn, ohne die Augen von dem Dreißigtonner vor ihnen zu lassen. Ein »Mautflüchtiger« dachte er. Seit die Lkw-Maut auf der Autobahn funktionierte, wichen viele Brummi-Fahrer auf die parallel führende B 10 aus.
»Wissen wir, wer ihn gefunden hat?«
»Ein Rentner, der heut früh in dieser Affenkälte seinen Hund ausgeführt hat.«
Eislingen schien wirklich wieder verstopft zu sein. Die Ampeln richteten das übliche hausgemachte Chaos an – und dies, so erinnerte sich Häberle, obwohl der Bürgermeister stets mit seiner angeblich »grünen Welle« prahlte. Doch die hatte seit Jahrzehnten außer dieser selbst niemand erkennen können.
»Haben die Kollegen gesagt, wie oft geschossen wurde?« Der Kommissar versuchte, sich auf die Situation einzustellen.
»Zweimal getroffen, Kopf und Brust. Aus allernächster Nähe«, antwortete Bruhn zackig, »sieht aus wie eine Hinrichtung. Zack-bum.«
Häberle schwieg. Die Kolonne setzte sich wieder in Bewegung.
Ute Siller hatte sich besonders fein gemacht. Ihr dezent graues Kleid, knielang, unterstrich die Seriosität, mit der sie sich als Finanzchefin des Unternehmens gerne umgab. Damit wollte sie sich von den jungen Dingern abheben, wie sie immer zu sagen pflegte – von diesen Mädels, die Nullenbruch so gerne als Sekretärinnen einstellte. In ihrem gemeinsamen Vorzimmer saß deshalb seit einiger Zeit auch so eine Zwanzigjährige, deren Getue ihr ziemlich auf die Nerven ging. Dazu war sie noch Ausländerin, sprach dafür aber erstaunlich gut Deutsch. Schon oft waren sie sich in die Haare geraten. »Schluss jetzt«, sagte die Chefin dann barsch und warf die Tür ihres Büros lautstark zu, um ihrer Autorität Nachdruck zu verleihen. Auch heute Vormittag war ›Kindchen‹, wie sie die hellblonde Angestellte von Anfang an tituliert hatte, wieder aufmüpfig und hatte über die vielen Briefe gestöhnt, die zum Schreiben anstanden.
Ute Siller war ohnehin sauer. Gestern hatte Nullenbruch hartnäckig eine Betriebsversammlung angekündigt – und nun war er über Nacht verschwunden. Als sie ihren Computer anschaltete, entdeckte sie eine Mail von ihm, die sie um 3.48 Uhr erhalten hatte: ›Tut mir leid, aber ich habe einen dringenden Termin wahrnehmen müssen. Betriebsversammlung wird verschoben.‹ Keine Begründung, kein Gruß.
Die Frau starrte noch ein paar Sekunden auf den Bildschirm und drückte dann am Telefon Meckenbachs Nummer. Der hatte auf dem Display bereits gesehen, wer anrief und kam gleich zur Sache: »Nicht aufregen, Ute. Er hat mal wieder umdisponiert.«
»Langsam hab ich den Eindruck, er weiß manchmal selbst nicht so genau, was er will.« Sie lehnte sich in ihrem schweren, ledernen Bürosessel zurück und schaute zur Tür, die sie vorhin mit Wucht zugeworfen hatte.
»Die Sache überfordert ihn«, meinte Meckenbach.
»Hast du denn eine Ahnung, wohin er ist?«
»Nicht die geringste. Vielleicht hat’s mit dem Anruf zu tun. Erinnerst du dich? Er hatte doch gestern noch eine Verabredung.«
»Stimmt, ja«, erwiderte Ute Siller nachdenklich, »hat der nicht Leo geheißen oder so ähnlich?«
»Hab ich nicht gehört und ist mir auch ziemlich egal. Sag mal, Ute, hast du heut Mittag schon was vor? Ich mein, wir könnten essen gehen.«
»Keine schlechte Idee. Was schlägst du vor?«
»Pizza in Göppingen, wie immer.«
»Okay. Fahr’n wir gleich um halb eins?«
Er stimmte freudig zu. Ute Siller legte auf und verlor ihr Lächeln. Sie erhob sich energisch und erreichte mit wenigen Schritten die Tür zum Vorzimmer, die sie mit einem Ruck aufriss. Fast im gleichen Moment nahm die junge Sekretärin ihr knallrotes Handy vom Ohr und drehte sich erschrocken um.
»Hab ich mir’s doch gedacht«, herrschte die Chefin die Angestellte an, deren blasses Gesicht rot anlief. »Du telefonierst während der Geschäftszeit privat rum?«
Das Mädchen schluckte und ließ die Hand mit dem Handy langsam sinken. Sie hätte jetzt lügen können, doch die Autorität, die diese Frau vor ihr ausstrahlte, wirkte geradezu lähmend auf sie.
»Ich will eine Antwort. Oder bist du taub?« Ute Siller kam bedrohlich nahe an den Schreibtisch heran.
»Tut mir leid, Frau Siller«, stammelte die Sekretärin mit ihrem unüberhörbaren slawischen Dialekt, »mein Freund hat mich nur kurz was fragen wollen.«
»Hab ich nicht gesagt, dass Privatgespräche absolut verboten sind? Dazu zählen auch Gespräche von deinem Handy. Hier drin wird gearbeitet – und sonst nichts. Aber auch gar nichts.« Die Frau starrte ihre Angestellte mit versteinertem Gesicht an. »Und dass eines klar ist, ein für alle Mal …« Ihre Stimme hatte ein gefährliches Zischen angenommen. »Busen, Beine und Po haben nichts mit Intelligenz zu tun.« Das hatte sie diesem ›Kindchen‹ schon lange mal sagen wollen. Jetzt war es raus. Wenn dieses Mädchen glaubte, mit aufreizender Kleidung vielleicht Nullenbruch imponieren zu können, dann war es höchste Zeit, einen Riegel vorzuschieben.
Die Sekretärin spürte, wie ihr Herz zu rasen begann und ihre Wangen glühten. Sie wollte etwas sagen, doch ihre Chefin schnitt ihr das Wort ab: »Ruhe. Ich will nichts hören. Gar nichts. Merk dir eins: Was hier drin gesprochen wird, was hier geschrieben und ausgehandelt wird, das sind strengste Geschäftsgeheimnisse. Wenn da auch nur ein Sterbenswörtchen nach draußen dringt, fliegst du hochkantig raus – und das mit einem entsprechenden Zeugnis. Ich persönlich, verstehst du, ich persönlich werde dafür sorgen, dass du dann nie mehr wieder einen Job kriegst. Nie mehr. Denk an deine Vergangenheit. Und denk dran, wo du bist.« Die Frau war jetzt ganz dicht an die Sekretärin herangetreten, die auf ihrem Schreibtischstuhl kauerte. »Im Übrigen stehst du gefälligst auf, wenn ich mit dir rede«, fauchte Ute Siller und deutete mit einer Kopfbewegung an, was sie von der Angesprochenen erwartete. Das Mädchen, jetzt völlig eingeschüchtert, blieb reglos sitzen.
»Hast du nicht kapiert? Du sollst deinen Arsch heben.« Die gefährlich scharfe Stimme der Chefin war leiser geworden, denn mit diesem Jargon wollte sie von niemandem gehört werden.
Die junge Frau erhob sich zögernd, ohne etwas zu sagen, und fühlte sich dabei mit weichen Knien wie ein Schulmädchen, das etwas Verbotenes getan hatte. Sie war nahezu so groß wie Ute Siller und schaute ihr angstvoll in die Augen, als befürchte sie, auch noch eine Ohrfeige verpasst zu bekommen.
»Jetzt werd ich dir mal was sagen«, machte die Chefin weiter, »egal, was du hier drin erfährst. Du wirst es für dich behalten. Denn …« Sie überlegte ein paar Sekunden und ließ ihr Gegenüber nicht aus den Augen, »manchmal kann es gefährlich sein, sehr gefährlich – zu viel zu wissen.« Und sie fügte hinzu: »Oder das Falsche zu wissen.«
Ute Siller drehte sich weg und eilte zur Tür. »Jetzt aber an die Arbeit, los«, zischte sie und schmetterte die Tür hinter sich zu. Die junge Frau blieb völlig verstört zurück. Sie zitterte.