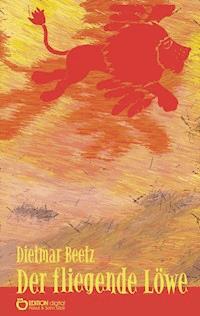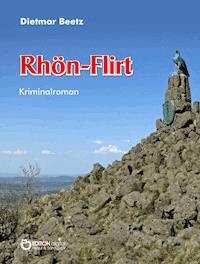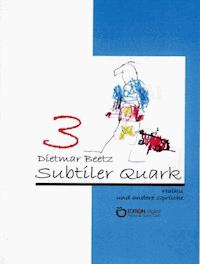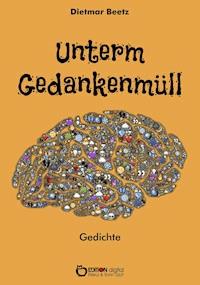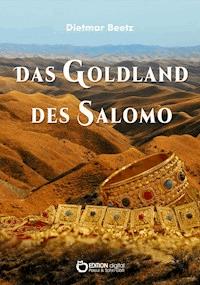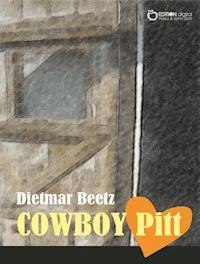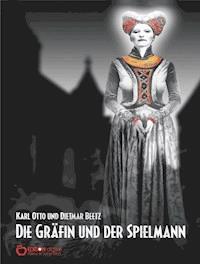7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Malam ist unterwegs, die „ehrwürdigen Alten“ des Dorfes zur Hochzeit seiner Schwester zu bitten. Dabei beobachtet er, wie Humberto, sein erwachsener Freund, sonderbare Zeichen im Urwald setzt. Plötzlich bombardieren portugiesische Flugzeuge die Hütten und die Hochzeitsgesellschaft. Malam erinnert sich an das merkwürdige Verhalten seines Freundes — sollte er ein Verräter sein? Auf beschwerlichen Wegen müssen die Verletzten ins Hospital getragen werden. Argwöhnisch belauert Malam Humberto während dieses abenteuerlichen Marsches durch den Busch, durch Schlammfelder und Flüsse. — Diese Geschichte spielt 1973 in schon befreiten Gebieten Guineas, doch der Kampf gegen die portugiesische Kolonialmacht war noch nicht zu Ende. INHALT: Nachts und in der Frühe zuvor Ein kranker Medizinmann Drei weiße Hemden Jacto! Hilfe von den „Hundesöhnen“ Beschwatzt werden und selber beschwatzen Durch Schlamm und über das Wasser Ohne Bleibe In Schussweite Geier über dem Ufer Nur ein leeres Etui Ein Tag im September
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Dietmar Beetz
Malam von der Insel
ISBN 978-3-95655-177-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1981 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Nachts und in der Frühe zuvor
Vor jenem Tag im September neunzehnhundertdreiundsiebzig, als das Unheil hereinbrach, wurde Malam in der Nacht plötzlich wach. Die Augen aufgerissen, starrte er in das Dunkel über seinem Lager und lauschte.
Nichts. Nur ein dumpfes Pochen, hastig, doch zu gleichförmig für den Hall einer Trommel, die eine Nachricht übermittelt oder Alarm schlägt ...
Beim nächsten Atemzug begriff der Junge, dass er das Hämmern seines eigenen Herzens vernahm, und verspürte einen leichten Schauer. Hoffentlich nicht wieder Paludismo, dachte er. Das hätte mir noch gefehlt, gerade jetzt, vor der Feier!
Er seufzte. Nein, es war nicht Malaria, was ihn frösteln ließ, kein neuer Anfall von Sumpffieber; gegen diese Krankheit hatte Pansao, der Lehrer, ihm Dragees gegeben, und außerdem spannte sich seit Kurzem über seinem Lager ein Moskitonetz. Der Schauer kam von der Kühle, wie sie stets gegen Ende der Regenzeit nachts in die Hütte drang.
Malam zog das wollene Tuch bis zu den Schultern hoch, rollte sich auf der knisternden, mit Gras gefüllten Matratze zusammen und schloss wieder die Augen.
Der Schlaf aber wollte nicht kommen. Und plötzlich bedauerte Malam, nicht krank zu sein; denn dann würde Brinsam, seine große Schwester, wieder an seinem Bett sitzen, und ihre Hochzeit fiele aus, und vielleicht würde alles wie früher werden.
Er schniefte, bemühte sich, seinen Kummer zu unterdrücken.Schließlich war er einer vom Stamme der Balanta, fast schon ein Mann; mit dreizehn Jahren hatte ein afrikanischer Junge nicht mehr zu flennen, und gar als künftiger Partisan …
Er stockte, nun doch von Gram überwältigt, von Zorn. Soll sie heiraten, soll sie nur! Meinetwegen kann sie gleich ausziehen und mich, ihren Bruder, allein lassen. Ohne Vater und Mutter ... Aber dann geh ich — egal, wohin!
Malam schlug das Tuch zurück, zog einen Zipfel des Moskitonetzes unter der Matratze hervor und tastete mit dem Fuß auf dem festgestampften Boden nach seinen Sandalen, bevor er unter dem zeltartigen Dach hervorkroch und den Spalt hinter sich wieder schloss. Vom Hocker neben der Pritsche nahm er sein Hemd, das bessere, das Brinsam mit dem glutheißen Eisen geplättet hatte und bereitgelegt für die Hochzeitsfeier ...
„Damit du schmuck aussiehst — als Hausherr. Ach, wenn Vater und Mutter diesen Tag noch hätten erleben können!“
Doch gleich darauf war sie vergnügt gewesen wie zuvor, und nun, um Mitternacht, befand sie sich bestimmt bei ihrem Bräutigam.
Na, bitte: Ihr Lager ist leer! Sicher, sagte sich Malam, bin ich munter geworden, als sie fortgeschlichen ist — heimlich, wieder mal. Als ob ich nicht Bescheid wüsste und immer noch „der Kleine“ wär!
Mürrisch trat er aus dem Halbdunkel der Behausung in den Mondschein, der durch das Laub fiel — ein Dach, das hier, im Zentrum des Dorfes, weniger dicht war als am Rande des Tabanca und dahinter, wo fast undurchdringlicher Busch begann. Auf dem winzigen, von Schatten und Lichtflecken gesprenkelten Platz blieb Malam unschlüssig stehen.
Das Dutzend Hütten ringsum lag dunkel und still inmitten der tausendstimmigen Nacht. Schrill zirpten die Grillen, und durch die Wipfel der Bäume fuhr seufzend der Wind. Irgendwo knackte ein Ast.
Ein Schakal oder — Malam stockte der Atem — ein Panther? Unsinn! Da würden die Hunde und die Ziegen und selbst die Hühner was wittern und wären unruhig.
Nur die Schlange glitt, wie er wusste, meist unbemerkt durch das Gestrüpp oder kroch lautlos auf dem Boden heran. Welche Mühe Malam sich auch gab, vor dem grünen oder schwarzen, sich windenden Reptil hatte er Angst, obwohl Pansao behauptete, Schlangen bissen den Menschen nur, wenn sie von ihm getreten oder bedroht würden.
Pansao! Der glaubte auch nicht an Fengotos, die Kobolde oder Buschgeister, ja nicht einmal an die Allmacht des Baumes der Ahnen! Natürlich sprach er nicht öffentlich darüber, nicht auf einer Dorfversammlung oder beim Palaver und selbst nicht im Unterricht. Er nahm Rücksicht auf die Gläubigen. Vor Malam, seinem künftigem Schwager, aber hatte er oft erklärt, Geisterglaube sei fauler Zauber, Folge von Unwissenheit und Verdummung — genauso wie der Glaube mancher Stämme an Allah oder wie der Glaube der Portugiesen an einen anderen Gott, zu dem sie in den Städten und größeren Ortschaften die Afrikaner bekehren wollten.
Die Städte des Landes, Bissau und Bafatá oder die nächstgelegene, Catió — den Jungen lockten sie. Sie zogen ihn an, obwohl er wusste, dass sie sich ausnahmslos noch in der Hand der verhassten Portugiesen befanden. Am liebsten wäre er jetzt, mitten in der Nacht, losgelaufen, nach Catió und weiter, bis zur Hauptstadt Bissau, und nie mehr auf die Insel und nach Entrar, seinem Heimattabanca, zurückgekehrt.
Fortgehn, dachte er, während er den Dorfplatz verließ und auf den Pfad zu Humbertos Hütte einbog. Wenn Brinsam heiratet und eine eigene Familie hat, hält mich hier nichts mehr. Und falls die Partisanen mich nicht haben wollen — nun, dann fahre ich eben zur See wie Humberto und mobilisiere die Matrosen für den Kampf.
Dieser Einfall war neu und beschleunigte den Schritt. Mit schlappenden Sandalen hastete Malam über den nächtlichen, von Mondschein gescheckten Pfad, vorbei an Flecken voller schulterhohem Elefantengras, an Kuhlen, aus denen Schmatzen und-das Quaken von Fröschen drangen, schaurig wie manchmal die Laute der Fengotos ...
Dennoch ängstigte Malam sich kaum — nun, da er ein Ziel hatte, einen Plan. Mit welchen Worten er sich bei Humberto erkundigen würde, das wusste er zwar nicht, doch war er sicher, der ehemalige Seemann könne ihm einen Rat geben.
Dass jetzt nicht die rechte Zeit für solche Auskünfte war, kam dem Jungen erst in den Sinn, als er Humbertos Hütte, eine einzelne abseits vom Tabanca, erreicht hatte, als er schon die Musik und das Gekicher vernahm. Eigenartig berührt, blieb er stehen und horchte.
„Obrigado, senhor, obrigado, senhor …“ — „Danke, Herr, danke schön, mein Herr …“
Malam kannte das Lied, einen „Hit“, wie Humberto es nannte, und er wusste, dass die Musik von Radio Bissau kam, vom Rundfunksender der Portugiesen, wusste auch, was in der Hütte geschah. Ein Mädchen war bei Humberto.
Während der Junge noch lauschte, verspürte er ein Krabbeln, ein Zwicken ... Ehe er begriff, biss es ihn an Füßen, Händen, Beinen ...
Ameisen! schoss es Malam durch den Sinn, und er schlug zu und hüpfte, klatschte, trampelte, um sich von den Formingueros, den gefürchteten, fleischfressenden, blutgierigen, dem Feind aller Lebewesen im Busch, zu befreien.
Und er vernahm Humbertos Stimme, ein wütendes Gebrüll, und rannte, bevor er erkannt wurde, los, rannte noch, als ihm schon klar war, dass Humberto nicht folgte, ihn nicht einholen konnte, hinkend, mit dem durch einen Unfall verkrüppelten Bein. Er verschnaufte erst, als der Pfad auf den Dorfplatz mündete.
Die Hütten lagen dunkel und still im Schutz der turmhohen Bäume, und nur aus Pansaos Behausung schienen Geräusche zu dringen, Geflüster und andere Laute. Malam wandte sich ab. Nein, dorthin würde er jetzt nicht gehen, keinen Schritt näher, ja nicht einmal daran vorbei, zu Onkel Bigna und Cotchenga. — Aber wohin?
Und während Malam eine letzte Ameise fing und zerdrückte, wurde ihm plötzlich bewusst, dass er schon seit Wochen umherlief wie ein treuloser Hund, mal zu Cotchenga, dem Freund, mal zu Humberto, der erst seit Monaten wieder auf der Insel war und der ihn Cotchenga, Pansao und selbst Brinsam entfremdet hatte. Die Schwester und der Lehrer, der einstige Spielgefährte und der geheimnisvolle Weltenbummler — diesen vier Menschen fühlte sich der Junge am meisten verbunden. Und zwischen ihnen stand er, hin und her gerissen, unschlüssig wie jetzt in der Nacht vor der Hochzeit, hier am Rande des Tabanca.
Ratlos, bedrückt und zu aufgewühlt, um sich in der leeren, dunklen Hütte wieder schlafen zu legen — so bog Malam ein auf einen anderen Pfad, auf den Steg, der in die Nachbarsiedlung führte. Ein vierter Weg, der kürzere, lief hinab zur Küste, zu den Pirogen der Fischer und den Feldern hinter dem Wald, wo die Bauern des Dorfes Reis und Maniok, Bataten und Erdnüsse anbauten. Malam kehrte um. Er verließ den Pfad und steuerte auf die Schule zu.
Die Rodung, wo Pansao die Kinder, deren Eltern es erlaubten, lesen, schreiben und rechnen lehrte, lag gleichfalls im Schutz ausladender Baumkronen, und dieses Dach war genauso licht wie das über den Hütten von Entrar. Durch die Lücken im Laub schien rund und hell der Mond; den Weg zu seinem Platz hätte Malam aber auch in völliger Finsternis gefunden.
Bevor er sich setzte, stand er eine Weile vor der aus Ästen und Lianen gezimmerten Bank und dem wackligen, auf dieselbe Weise gefertigten Tisch, stand da, den Atem anhaltend, als erfahre er sogleich alle Geheimnisse der Welt.
Was lockend war und wert, erlernt zu werden oder erlebt — davon hatte Malam durchaus eigene Vorstellungen, und so geschah es nicht selten, dass seine Gedanken abschweiften, fort von der Schule und hin zu Humbertos Geschichten ...
Bis Pansao ihn ertappte und zurückrief wie neulich im Mathematikunterricht.
„Das interessiert dich wohl nicht, oder schläfst du?“
„Nein“, erwiderte Malam, um seinen Ruf bei den anderen Kindern besorgt, „das interessiert uns nicht.“
Für einen Atemzug schnellten die Brauen Pansaos hoch zur Narbe, die von einem Splitter stammte und das Gesicht immer grimmig erscheinen ließ; dann begann es um den Mund des Lehrers zu zucken.
„Und was, wenn man fragen darf, würde den Herrn interessieren?„Der Kampf“, gab Malam mürrisch zur Antwort. „Der Krieg — was sonst?“
„Lernt erst und werdet Männer!“, sagte Pansao, ernst nun. „Kämpfen könnt ihr auch später, nach der endgültigen Befreiung unserer Heimat: kämpfen gegen Unwissenheit und Armut, gegen Hunger und Seuchen ...“
„Wir wollen aber schießen!“, fiel Malam ihm ins Wort. „Auf den Feind, auf die verdammten Tugas!“
Während die Kinder den Atem anhielten und aus dem Mangrovengestrüpp ringsum und aus dem Geflecht der Baumkronen über ihnen nur das Zwitschern der Vögel drang, schaute Pansao den Jungen eine Weile nachdenklich an.
„Hoffentlich“, sagte er dann, „hoffentlich wird das für euch nicht mehr nötig sein. Glaubt ja nicht, der Krieg gegen die Portugiesen wäre schön! Das hier“ — er tippte mit der linken Hand an den leeren Ärmel der Bluse seiner ausgeblichenen Uniform — „war bestimmt kein Vergnügen, und sicher können auch eure Eltern euch erzählen ...“
Er brach ab, und Malam senkte den Kopf noch tiefer.
Meine Eltern, dachte er, können mir nichts mehr erzählen.
Da berührte die Hand des Lehrers seine Schulter.
„Ich weiß, Malam, du möchtest deinen Vater rächen. Glaub mir, ich kann dich verstehen; ich habe selber eine Rechnung mit den Tugas zu begleichen. — Und welchem Mann aus dem Stamme der Balanta oder der Nalu“, fragte er, wieder an alle gewandt, „wem aus unserem Volk geht es anders?“
Ein Mädchen seufzte, doch Malam — ihn kränkte die Gleichsetzung seines Stammes mit dem der verachteten Nalu — blieb abwartend.
„Verlass dich drauf“, fuhr der Lehrer fort und klopfte dem Jungen auf die Schulter, „wir zahlen es den Tugas schon heim: Wir beweisen ihnen, wozu wir Afrikaner fähig sind! — Abgemacht?“ Er hielt die Hand hin, die linke, und Malam, nun versöhnt, schlug ein.
„Gut“, sagte Pansao. „Fangen wir also noch mal von vorn an: Wie war das mit den Winkeln im gleichschenkligen Dreieck?“ Er ließ den Blick schweifen über die Finger, die in die Höhe schnellten, und über die Köpfe, die sich senkten, und Malam, der gleichfalls die Augen niederschlug, merkte den Spott in der Stimme und wusste Bescheid, schon bevor er seinen Namen hörte.
Und vernahm das Kichern von Quinta, der die Mutter Zöpfchen flocht wie einer jungen Braut und die — natürlich! — mit den Fingern schnipste und dabei grinste, sich lustig machte über ihn, Malam.
„Komm zur Tafel!“
Den Blick auf dem braunroten Boden der Rodung, auf dem Gewirr aus Laubschatten und Sonnenflecken, befolgte Malam die Aufforderung des Lehrers. Und dann stand er vor dem leeren, hell gescheuerten Brett, das an einem Baumstamm und auf zwei Astgabeln ruhte, stand da, ein Stückchen Holzkohle in der Hand, und starrte die Tafel an.
Dachte: Ein gleichschenkliges Dreieck hat drei — nein: zwei ... Ach, zu den Fengotos mit diesem Zauber! Vater konnte nicht mal seinen Namen schreiben, und Humberto lacht bloß über solchen Unsinn. Dabei kennt er die ganze Welt und besitzt sogar ein Radio, und alles ohne — Mathematik!
Als habe er die Gedanken des Jungen erraten, sagte Pansao: „Ich weiß, einigen im Tabanca gefällt nicht, dass die Küken mehr als die Henne lernen, dass sie vielleicht mal klüger werden. Das ist so, leider. Aber die Partei und unser Land brauchen gebildete Menschen, Männer und Frauen, die etwas verstehen von Politik und Geschichte, von Hygiene und Mathematik ...“
Immer dasselbe, dachte Malam, und er warf einen gelangweilten Blick auf Pansao.
„Jawohl, auch von Mathematik!“, rief der Lehrer, als spreche er zu allen im Tabanca. „Oder wollt ihr, dass wir ewig nur mit Maschinenpistolen kämpfen? Schon beim Abfeuern einer Bazooka muss man beachten, wie schnell und wohin sich der Helikopter oder ein anderes Ziel bewegt, muss — berechnen! Und was meint ihr wohl, was unsere Partisanen vor dem ersten Schuss aus einer Flugzeugabwehrkanone lernen? — Na, was?“
„Mathematik!“, rief Quinta triumphierend, und auch einige Jungen fielen ein.
„Richtig: Mathematik, Ballistik, die Lehre zur Berechnung der Flugbahn von Geschossen — eine komplizierte Wissenschaft. Wer sie beherrschen will, muss vorher einfachere Sachen begreifen. Zum Beispiel, wie es sich mit den Winkeln verschiedener Dreiecke verhält.“
Diesmal nickte selbst Malam, und seufzend begann er: „Also, ein Dreieck hat drei Ecken, und ein gleichschenkliges Dreieck hat — gleichgroße Schenkel.“
Irgendwer prustete los, doch Pansao rief: „Zwei gleich große Schenkel, genau! Und solch ein Dreieck zeichne nun mal für alle an die Tafel!“
Hinterher wischte sich Malam den Schweiß von der Stirn und dachte: Ballistik — das begreife ich nie. Wozu auch? Ich geh ja sowieso zu den Fliegern.
Und wieder träumte er mit offenen Augen seinen Lieblingstraum: Pilot sein und in einer blitzenden Maschine über das Land fliegen, unter dem blauen, wolkengescheckten Himmel über Busch und Savanne, über Sümpfe, Siedlungen, Flüsse ... So nähert er sich auf dem Rückflug von einem Einsatz der Insel und seinem Heimatdorf, und direkt über dem Tabanca zieht er eine Schleife und wackelt mit den Tragflächen: dreimal, weil er heute drei FIAT der Portugiesen abgeschossen hat. Unten zwischen den Hütten bricht Jubel aus, und endlich begreifen alle, welch Held Malam ist, und niemand, auch nicht Quinta mit ihren Brautzöpfchen, wagt es mehr, sich über ihn lustig zu machen.
Der Junge seufzte. Noch hockte er auf dem Schulplatz von Entrar, mit dreizehn Jahren erst Schüler der zweiten Klasse und doch einer der ersten auf der Insel, die lesen, schreiben und rechnen lernten, und er ahnte, wie weit der Weg war bis zum Platz in der Kanzel einer Abwehrmaschine. Und wusste, dass die Partisanen der PAIGC, der Partei, die den Befreiungskampf führte, noch gar keine Flugzeuge besaßen, ja nicht einmal Piloten, nur Piloten-Schüler, die sich, wie Pansao unlängst erzählt hatte, in der Sowjetunion befanden: zur Ausbildung, die Jahre dauerte.
Nein, dachte Malam, während er aufstand, dann lieber auf ein Schiff, als Mobilisator der Matrosen! Sobald Humberto bei der Hochzeit aufkreuzt, frage ich ihn aus.
Ein Geräusch lässt ihn aufhorchen, stocken. Im nächsten Moment sieht der Junge auf dem Steg, der nach Catchur führt, einen huschenden Schatten — die Gestalt einer Frau, die sich aus dem Dunkel zwischen den Baumstämmen löst. Biquirante, denkt er, noch bevor er die Alte erkannt hat. Klar. Wer sonst treibt sich nachts im Wald rum?
Mit leichtem Bangen sieht er, dass sie stehen bleibt, wo der Schulplatz den Steg berührt, dass sie auf Malam offenbar wartet, und während er sich zaudernd nähert, schießt ihm durch den Sinn, was im Tabanca über diese Frau erzählt wird: Sie sei mit Unfruchtbarkeit gestraft worden, sei kinderlos, weil sie dem Baum der Ahnen einmal die gebührende Ehrerbietung verweigert habe, und nun stehe sie im Bunde mit den Fengotos, habe Verbindung auch zu den „Hundesöhnen“ vom Stamme der Nalu ...
Wer weiß, vielleicht kommt sie aus Catchur und hat sich unterwegs gemeinsam mit den Geistern einen Streich ausgedacht, irgendeine Gemeinheit gegen mich oder Brinsam und Pansao? Gerade auf Brautpaare sollen es die Fengotos abgesehen haben, und ich als Hausherr, seit der Vater tot ist ...
Für alle Fälle beschließt er, wachsam zu sein. Deshalb gibt er ihr nicht die Hand, sondern verneigt sich nur, grüßt und erkundigt sich murmelnd nach ihrem Befinden.
„Danke, es geht. — Und dir, Malam, Sohn von Sansao und Binta, wie geht es dir?“
„Es geht, Biquirante, Tochter des ehrwürdigen Tchongo und seiner Gemahlin Maimuna. — Was macht Eure Gesundheit?“
So wechseln sie auf afrikanische Weise Gruß und Erwiderung. Währenddessen forscht der Junge beim Schein des Mondes im Gesicht der Alten, das gezeichnet ist von Krankheiten und Gram. Plötzlich glaubt er, hinter den Runzeln und Falten andere Züge zu erspähen — das Antlitz seiner Mutter, hohlwangig, wie auf dem Totenlager: ausgemergelt vom Bluthusten, wie man ihre Krankheit nannte, vom Fieber gleichsam ausgebrannt.
„Was macht Eure Gesundheit?“, erkundigt er sich erneut, nun hörbar besorgt.
„Danke, es geht“, entgegnet sie abermals, und in ihrem Blick, der bislang gleichgültig schien, in ihrem Blick glimmt Erstaunen auf, ja Rührung.
„Es geht“, wiederholt sie — das erste Abweichen vom üblichen Zeremoniell —, und im selben Tonfall fügt sie hinzu: „Schön von dir, Malam, dass du die Ehrerbietung gegenüber den Alten pflegst. Was bleibt denn sonst für uns, die wir dem Reich der Ahnen schon weit näher stehen als dem Reich der Lebenden?“ Das Reich der Künftigen, müsste Malam jetzt, der Tradition gemäß, erwidern. Doch wollen ihm diese Worte nicht über die Lippen, nicht vor dieser Frau, von der er weiß, dass es Künftige — Kinder — für sie nicht geben wird.
So bleibt er stumm, und sie scheint auch keinen Trost zu erwarten. Schweigend geht sie voran, den Steg hinab zum Tabanca. Er folgt ihr — vor sich ihre hängenden Schultern —, ein Anblick, der ihm ans Herz greift.
Sogleich wehrt er sich gegen diese Regung, die er für eine Eingebung böser Geister hält, für einen Teil in ihrem hinterlistigen Plan.
Sie will sich mein Mitleid erschleichen, mein Vertrauen, und wenn meine Wachsamkeit schläft, ist es zu spät. Dann kann sie mir arge Gedanken und Wünsche einflüstern, mein Herz vergiften durch Neid und kleinlichen Hass, durch alles Schlimme, aus dem die Krankheiten kommen. Ein Schauder überläuft ihn, und der Junge schwört sich, noch vorsichtiger zu sein. So erreichen sie den Dorfplatz. Biquirante bleibt stehen und dreht sich um. Jetzt, denkt Malam, wird sie versuchen, mir die Hand zu geben, mich zu berühren, um Macht über mich zu gewinnen, jetzt ... Die Alte aber wendet sich, nachdem sie ihn mit einem Blick gestreift hat, ab und sagt wie in Gedanken: „Das Leben geht weiter, was auch im Tabanca geschieht. Wir ziehen ins Reich der Ahnen, machen Platz hier für — andere, die geboren werden und heranwachsen, die arbeiten und sterben. So war es schon immer, und so ist es gut.“
Der Junge atmet auf und seufzt.
Da erscheint auf ihrem dunklen, faltigen Gesicht ein Lächeln, ein wehmütiger Zug.
„Hab keine Angst, Malam, und sei nicht traurig! Ein paar Jahre noch, dann heiratest auch du. Und vorher? — Unsere Insel ist groß; nirgendwo bist du so allein, dass der Schmerz dich erschlägt. — Und nun, Malam, geh heim und versuche zu schlafen! Bald wird es hell, und eine Hochzeitsfeier strengt an.“
Ein flüchtiger Gruß, und Biquirante entfernt sich, schlurft über den vom Mondschein gesprenkelten Platz zu ihrer Hütte, die hinter den anderen steht, vom Busch fast überwuchert.
Endlich erwacht Malam aus der Starre und besinnt sich, denkt: Kein Handschlag, nichts, nicht einmal der Versuch, mich zu berühren und Macht ...
Er stockt, beschämt, und nun erst ist er sich im Klaren, wie gütig die Alte gesprochen hat, tröstend, als kenne sie seinen Kummer, als sei solches Leid ihr nicht fremd.
Seltsam, überlegt er, während er sich umschaut in der Runde, im Kreis der Hütten, die unverändert im Dunkel liegen. Seltsam, alle halten sie für böse; aber kann denn ein wirklich schlechter Mensch so reden, so — verständnisvoll?
Eine Antwort weiß er nicht. Er will Pansao fragen, ihn oder Brinsam — nicht gleich, sondern später, wenn es hell wird und die Macht der Fengotos weicht.
Jetzt wäre Malam schon zufrieden mit einem Gruß der Schwester, einem Wort. Doch das Lager links hinter der Türöffnung ist leer wie vor Stunden. Da lässt er sich neben dem Eingang nieder, traurig und müde und trotzig.
Soll sie nur sehen, dass ich gewartet habe, dass ich Bescheid weiß! Hätte sie wenigstens eine Andeutung gemacht! Aber zu tun, als sei ich noch immer ,,der Kleine“ ...
Soweit der Junge zurückdenken kann, hat Brinsam im Haushalt geholfen und sich um ihn gekümmert; stets war sie „die Große“, die Ältere, der er gehorchen musste, die befahl. Das galt schon, als die Mutter noch lebte und bereits an Bluthusten litt, als sie Tag für Tag auf ihrer Pritsche lag und vor Schwäche nicht mehr fähig war, zum Bach zu gehen und Wäsche zu waschen, Wasser zu holen und Essen zu kochen, und auch nach ihrem Tod änderte sich daran nicht viel.
Bis eines Tages vor fast drei Jahren Pansao im Tabanca erschien.
Die Schwester mochte den Lehrer und Mobilisator der PAIGC vom ersten Augenblick an, und lange Zeit weihte sie den Bruder ein. So erlebte Malam den Beginn dieser Liebe: die schüchternen, erfolglosen Versuche des Mädchens, den Fremden auf sich aufmerksam zu machen, die Enttäuschung und Tränen, aus denen immer wieder Hoffnung wuchs. Als sei es seine eigene Angelegenheit, nahm Malam an allen Kümmernissen teil.
Solches Vertrautsein mit der großen, fünf Jahre älteren Schwester war neu für Malam und erhöhte ihn. Als Brinsam aber zu schweigen begann vor Glück, fühlte sich der Junge zurückgestoßen, verraten und betrogen.
Dazu kam, dass sie in jenen Tagen erfuhren, der Vater sei tot, einer Verwundung im Kampf gegen die Portugiesen erlegen.
Die Nachricht überbrachte Pansao, der Vertreter der PAIGC, der Mobilisator im Tabanca.
„So ein Unglück! Nun seid ihr Waisen. Ohne Vater und Mutter ... Nur gut, dass Brinsam schon groß ist, fast erwachsen!“ Da gewahrte Malam, wie das Mädchen sich straffte, sich über die Wangen fuhr und Pansao einen Blick zuwarf, einen Blick, der den Lehrer stocken ließ, der ihm das Blut ins Gesicht trieb ... Fortan war die Schwester wie verwandelt, trotz der Trauer eigenartig vergnügt, gleichsam durchglüht von stiller, heimlicher Freude, und auch der Lehrer erschien dem Jungen verändert: erregter, mitreißend, wenn er sprach beim Palaver vor den Hütten, bei Versammlungen oder im Unterricht, glücklich, wenn er lachte, ja sogar, wenn er schwieg.
All das beunruhigte Malam. Ein Unterton schlich sich in seine Stimme, sobald die Rede auf den Lehrer kam, und Brinsam begann, solchen Gesprächen mit dem Bruder auszuweichen, sich vor ihm zu verschließen.
„Gib zu, er liebt dich!“, forderte er einmal in einem Tonfall, als verlange er das Eingeständnis einer Schuld.
Brinsam, eben noch verklärt, wurde fahl.
„Still! — Bist du verrückt? Wenn das die Fengotos hören ...“
„Unsinn — am helllichten Tag!“
„Trotzdem ... Schweig bitte trotzdem! So was darf man nicht berufen.“
„Also doch ...“
Das war vor reichlich einem Jahr, und nun soll Hochzeit sein, eine Feier, drei Tage lang, für Brinsam und Pansao und für alle im Tabanca.
In der Frühe zuvor aber, nach einer Nacht, die er zur Hälfte durchwacht hat, hockt Malam neben der Türöffnung, bis Brinsam ihn weckt.
„Malam! — Malambu, mein Kleiner, Brüderchen, was ist denn ...?“
Am liebsten möchte der Junge wieder die Augen schließen, sich auf die Seite legen, um weiterzuschlafen, beruhigt — nun, da er weiß, dass sie da ist.
„Komm, Malam, leg dich ins Bett, bald wird’s hell!“
Da erhebt er sich mürrisch, schlurft knurrend zu seinem Lager und kriecht, zerstochen und sich kratzend, unter das Moskitonetz.
„Was ist, Malam? Was fehlt dir? Warum ...?“
„Nichts. Frag nicht! — Schlaf!“
Sie gähnt und streckt sich, und bald darauf wird ihr Atem gleichmäßig und sanft wie das Schnurren einer jungen Katze.
Schlaf, Schwester, ruh dich aus, damit du schön bist auf deiner Hochzeit!
Ein kranker Medizinmann
Als Malam erwachte, war der Platz vor der Hütte bereits voll Geschäftigkeit. Gelächter und Rufe drangen herein, Geräusche wie jeden Morgen, doch war das Lärmen heute anders als sonst, vergnügter.
Sie freuen sich schon auf die Feier, alle — außer mir. Das gesamte Tabanca ist froh, weil es ein Fest gibt, nur ich ...
Da verdunkelte sich die Türöffnung. Die Nachbarin, Quintas Mutter, kam, von Brinsam gefolgt, auf Malams Lager zu; rasch schloss der Junge die Augen.
„Er schläft noch“, hörte er Brinsam flüstern.
„Ach, was! Der tut nur so. Siehst du nicht, dass er blinzelt?“
Und derbe Hände zogen das Moskitonetz unter der Matratze hervor und rüttelten Malam an der Schulter.
„Steh auf! Die Pflicht ruft!“
Der Junge rieb sich die Augen und gähnte, als finde er erst jetzt zurück in die Wirklichkeit.
„Pflicht?“, fragte er mürrisch. „Was für eine Pflicht?“
Die Nachbarin stemmte die Hände in die Hüften und schaute ihn verwundert an. „Hast du etwa vergessen, was sich für den Hausherrn am Morgen vor der Hochzeit gehört?“
Auch das noch! dachte Malam, und er tastete missmutig mit dem Fuß nach seinen Sandalen. Und hielt inne, hielt den Atem an und rührte sich nicht; denn Brinsam hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt.
„Malam, bitte, tu mir den Gefallen, wasch dich, iss was und lade dann die ehrwürdigen Alten noch mal ein! Besonders Onkel Bigna — mir zuliebe ...“
Er spürte den sanften Druck ihrer Hand — Drängen und Besänftigung in einem — und hörte wieder die Stimme der Nachbarin. „Wenn euer Vater nicht tot wäre, ginge er; aber so ...“
„Schon gut, ich geh ja“, erwiderte Malam. „Als ob ich nicht wüsste, was sich gehört!“ Er fuhr in die Sandalen und erhob sich, nahm sein Hemd, ein Handtuch und die Seife ...
„Und sei bitte freundlich!“, sagte Brinsam.
„Nett musst du sein, ehrerbietig!“, rief die Nachbarin.
Malam zuckte die Schultern. Mürrisch verließ er die Hütte, überquerte den Platz und betrat den Pfad, der zum Bach führte. Immer dasselbe, dachte er. Tu das, mach es so, unterlass das! — Und nun auch noch die Alten zur Hochzeit bitten ...
Eine andere Aufgabe hätte den Jungen wahrscheinlich gelockt, und gar eine Pflicht, die sonst nur Erwachsene betraf, wäre ihm wie eine Auszeichnung erschienen. Indem er aber jetzt Brinsam half, Pansao zu heiraten, trug er selber dazu bei, die Schwester zu verlieren. Außerdem war er gezwungen, bei der Auseinandersetzung im Dorf einen Standpunkt zu beziehen.
Betteln gehn für Pansao, dachte er, die letzten im Tabanca einfangen und auf seine Seite ziehn ... Wenn nur Humberto nicht gegen alles wär, was von Pansao kommt ...
Das bedrückte Malam am meisten: Dass sein Freund und Vorbild Humberto der ärgste Widersacher des Lehrers war und dass diese Feindschaft eher wuchs als sich verringerte. Zu offenen Ausbrüchen war es bisher zwar nicht gekommen, doch spürte der Junge seit langem, wie Humberto und Pansao einander belauerten. „Was hast du eigentlich gegen Pansao?“, hatte er schon vor Wochen Humberto gefragt. Da saßen sie unten am Strand, wo der Bach ins Meer fließt, jeder in den Händen eine Angelrute, und Malam merkte, wie Humbertos Schwimmer zu zucken begann. Ein Fisch, dachte er, ein Fisch am Köder ...
Aber Humberto schien das nicht zu sehen, und plötzlich entdeckte Malam, dass das Zucken von den Händen ausging, von Humbertos Händen; im nächsten Moment wurde die Angel aus dem Wasser gerissen.
„Ich?“, fragte Humberto heiser. „Was sollte ich denn gegen euren Lehrer haben?“
Er räusperte sich, warf die Angel wieder aus und erkundigte sich scheinbar beiläufig: „Wie kommst du eigentlich darauf? Behauptet er das?“
„Nein“, sagte Malam zögernd, „nur so ...“