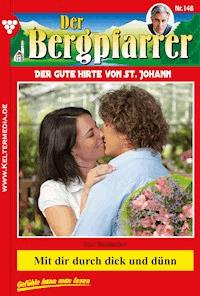
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. »Ja, Himmeldonnerwetter!« Walburga Klausen schaute ärgerlich auf ihre Schwägerin. »Kannst' net aufpassen?« fuhr sie die junge Frau an und deutete auf die Scherben eines Frühstückstellers, die den Fußboden bedeckten. »Entschuldigung«, murmelte Petra. »Ich hab's ja net absichtlich gemacht.« »Denken könnt' man's aber«, gab die Bäuerin zurück, mit tiefen Zornesfalten im Gesicht. »Jetzt mach' den Dreck schon weg und dann kümmerst' dich ums Mittagessen. Der Wolfgang möcht' einen Schweinsbraten haben.« »Schweinsbraten?« rief Petra. »Aber da muß ich ja erst ins Dorf zum Metzger. Wie soll ich das Essen denn bis zum Mittag fertig bekommen? Der Braten braucht doch mindestens zwei Stunden!« Ihre Schwägerin sah sie kopfschüttelnd an. »Indem du dich ein bissel beeilst und dich net den lieben langen Tag um die Arbeit drückst!« erwiderte sie ungehalten und rauschte hinaus. Petra konnte nur mühsam die Tränen zurückhalten. Es war eine schreiende Ungerechtigkeit, wie Walburga mit ihr umging! Sie gab sich doch alle Mühe! Rasch machte sie sich daran, die Scherben einzusammeln und in den Mülleimer zu werfen, dann warf sie sich eine Jacke über und lief nach draußen. Lang' mach ich das net mehr mit, dachte sie, als sie die Bergstraße in Richtung Engelsbach fuhr. Ständig schimpft sie mit mir, und nix kann ich ihr recht machen! Petra fand sich wirklich ungerecht behandelt. Mochte ihr Bruder auch immer wieder darauf hinweisen, daß Walburga in ihrem Zustand Ruhe und Fürsorge brauchte, und die Schwester um Verständnis für seine Frau bitten; eine Schwangerschaft war nun mal keine Krankheit. Dabei freute sich Petra genauso auf das Baby, das in wenigen Wochen geboren werden sollte. Sie hoffte sehr
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer – 148 –Mit dir durch dick und dünn
Diese zarte Hand hat alles fest im Griff
Toni Waidacher
»Ja, Himmeldonnerwetter!«
Walburga Klausen schaute ärgerlich auf ihre Schwägerin.
»Kannst’ net aufpassen?« fuhr sie die junge Frau an und deutete auf die Scherben eines Frühstückstellers, die den Fußboden bedeckten.
»Entschuldigung«, murmelte Petra. »Ich hab’s ja net absichtlich gemacht.«
»Denken könnt’ man’s aber«, gab die Bäuerin zurück, mit tiefen Zornesfalten im Gesicht. »Jetzt mach’ den Dreck schon weg und dann kümmerst’ dich ums Mittagessen. Der Wolfgang möcht’ einen Schweinsbraten haben.«
»Schweinsbraten?« rief Petra. »Aber da muß ich ja erst ins Dorf zum Metzger. Wie soll ich das Essen denn bis zum Mittag fertig bekommen? Der Braten braucht doch mindestens zwei Stunden!«
Ihre Schwägerin sah sie kopfschüttelnd an.
»Indem du dich ein bissel beeilst und dich net den lieben langen Tag um die Arbeit drückst!« erwiderte sie ungehalten und rauschte hinaus.
Petra konnte nur mühsam die Tränen zurückhalten.
Es war eine schreiende Ungerechtigkeit, wie Walburga mit ihr umging! Sie gab sich doch alle Mühe!
Rasch machte sie sich daran, die Scherben einzusammeln und in den Mülleimer zu werfen, dann warf sie sich eine Jacke über und lief nach draußen.
Lang’ mach ich das net mehr mit, dachte sie, als sie die Bergstraße in Richtung Engelsbach fuhr. Ständig schimpft sie mit mir, und nix kann ich ihr recht machen!
Petra fand sich wirklich ungerecht behandelt. Mochte ihr Bruder auch immer wieder darauf hinweisen, daß Walburga in ihrem Zustand Ruhe und Fürsorge brauchte, und die Schwester um Verständnis für seine Frau bitten; eine Schwangerschaft war nun mal keine Krankheit.
Dabei freute sich Petra genauso auf das Baby, das in wenigen Wochen geboren werden sollte. Sie hoffte sehr darauf, daß sie Patentante werden würde und gab sich alle erdenkliche Mühe, der Schwägerin den Alltag zu erleichtern. Aber Walburga wurde mit jedem Tag, den die Geburt näher rückte, unausstehlicher.
Mehr als einmal schon hatte die Schwester des jungen Klausnerbauern mit dem Gedanken gespielt, alles hinzuwerfen und den Hof zu verlassen.
Nur – wo sollte sie hin?
Sie gehörte zum Klausnerhof, genauso wie ihr Bruder. Beide waren sie dort geboren und aufgewachsen. Es war ihre Heimat, und Petra konnte sich eigentlich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.
Zumindest nicht, solange sie nicht eine eigene Lebensperspektive gefunden hatte. Aber das lag wohl noch in weiter Zukunft.
Sie hielt vor dem Geschäft des Metzgers und stöhnte auf, als sie schon vom Auto aus die lange Schlange vor dem Tresen sah. Es dauerte wirklich eine gute Viertelstunde, bis sie den Laden wieder verließ und sich auf den Rückweg machte.
Irgendwie schaffte sie es, das Mittagessen rechtzeitig auf den Tisch zu stellen. Wolfgang aß mit gutem Appetit, während seine Frau nur auf ihrem Teller herumstocherte und ein paar Gabeln Gemüse zu sich nahm. Petra hatte auch kaum Hunger. Nach dem Essen ging ihr Bruder gleich wieder an die Arbeit, während Burgl sich hinlegte. Petra machte sich an den Abwasch, kümmerte sich hinterher um den Garten, fütterte die Hühner, bügelte die Wäsche, die sie am Morgen zum Trocknen in den Garten gehängt hatte, putzte die Fenster und wartete darauf, daß der Bauer zurückkam und sie zusammen die Kühe melken konnten.
Nach dem Abendessen zog sie sich in ihre Kammer zurück. Ein wenig fernsehen, in einer Zeitschrift blättern, auf den Wecker schauen und schließlich ins Bett gehen.
Das war ihr Leben, tagaus, tagein.
Der Wecker klingelte um halb fünf, und der gleiche Trott begann von vorne.
Aber Petra haderte nicht mit ihrem Leben. Es war erträglich. Und doch hätte es schöner sein können, wenn Burgl nicht ständig etwas an ihr auszusetzen gehabt hätte.
Vielleicht, sprach sie sich immer wieder Mut zu, wird alles anders, wenn erst das Baby endlich da ist.
Doch da irrte sie sich...
*
Maria Riemer streckte den Kopf zum Küchenfenster hinaus, als sie den Traktor auf den Hof fahren hörte. Georg saß darauf, und sein Gesicht war alles andere, als zufrieden.
Die Magd wandte sich rasch ab und schaltete die Kaffeemaschine ein. Pulver und Wasser hatte sie zuvor schon hineingegeben. Dann ging sie in die Speisekammer und holte den Kuchen, den sie am Vormittag gebacken hatte, und stellte ihn auf den Tisch. Während sie ein Messer aus der Schublade nahm, spürte sie einen plötzlichen Schmerz, der ihr durch die Brust fuhr. Unwillkürlich preßte sie die Hand auf das Herz und hielt den Atem an. Als der Schmerz nachließ, stieß Maria erleichtert die Luft wieder aus.
Vielleicht sollt’ ich mir doch mal Zeit nehmen und zum Doktor geh’n, dachte sie.
Seit einigen Wochen hatte sie diese Schmerzattacken, die sie förmlich überfielen. Nach wenigen Augenblicken war dann alles wieder normal, aber die Magd ahnte, daß es sich dabei um eine Warnung ihres Körpers handelte. Sie sollte zum Arzt gehen.
Doch woher sollte sie die Zeit nehmen?
Auf dem Hof war genug zu tun, und wenn sie ehrlich war, dann mußte sich Maria eingestehen, daß sie sich vor der Diagnose Dr. Wiesingers fürchtete. Bestimmt würde bei der Untersuchung herauskommen, daß sie ins Krankenhaus mußte, vielleicht sogar operiert werden, und das konnte sie Georg auf keinen Fall antun. Er hatte ja sonst niemanden, der für ihn sorgte.
Der junge Bauer betrat die Küche. Georg Burgthaler war groß gewachsen und schlank. Er hatte kurzes, dunkles Haar und ein sympathisches Gesicht, das im Moment allerdings bedrückt wirkte.
»Na, Bub, wie schaut’s aus?« fragte Maria.
Trotz seiner sechsundzwanzig Jahre nannte sie ihn immer noch Bub, so wie sie es schon immer getan hatte, und in irgendeiner Weise war das auch gerechtfertigt. Maria Riemer arbeitete seit mehr als dreißig Jahren auf dem Burgthalerhof, sie hatte erlebt, wie Georg geboren wurde, und wie seine Eltern starben. Die Mutter schon recht früh, der Vater vor zwei Jahren. Maria selbst stand kurz vor der Rente, aber sie dachte überhaupt nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Sie wollte arbeiten, bis der Herrgott sie von dieser Welt abberief.
In der letzten Zeit argwöhnte sie allerdings, daß der Tag nicht mehr fern war. Die immer wiederkehrenden Schmerzen redeten eine deutliche Sprache...
Georg setzte sich auf seinen Platz unter dem Herrgottswinkel. Er holte tief Luft und seufzte.
»Net gut«, erwiderte er auf die Frage der Magd. »Es ist einfach zu trocken gewesen, dem Getreide fehlt der Regen.«
Die anderen Bauern standen vor demselben Problem. Aber die hatten das nötige Geld und Gerätschaften, um ihre Felder zu bewässern.
Maria schnitt den Kuchen an und schenkte Kaffee ein. Dann setzte sie sich zu ihm. Während Georg aß und trank, schaute sie ihn nachdenklich an.
Verdient hat er’s net, dachte sie. Dabei gibt er sich solche Mühe.
Ja, es war kein einfaches Leben auf dem Burgthalerhof. Schon Georgs Vater hatte keine glückliche Hand gehabt. Als er verstarb, hinterließ er seinem Sohn nicht nur den Hof, sondern auch einen Berg Schulden, den abzutragen, der junge Bauer immer noch dabei war.
Die Magd machte ein sorgenvolles Gesicht.
Wie soll das bloß weitergehen? fragte sie sich. Der Bub kann ja auch net mehr, als arbeiten. Und wenn ich zum Doktor geh’, dann steht er womöglich ganz allein da.
Georg hatte seine Tasse ausgetrunken und stellte sie auf den Unterteller zurück.
»Ich muß wieder los«, sagte er und stand auf. »Vielleicht schaut’s droben beim Hornstieg besser aus.«
Glauben mochte er es allerdings nicht so recht.
Wortlos ging er aus der Küche. Maria räumte den Tisch ab. Als sie den Kuchenteller abgedeckt hatte und in die Speisekammer zurückbringen wollte, war der Schmerz wieder da. Diesmal schlimmer, als je zuvor. Sie stieß einen Schrei aus, der Teller entglitt ihren Händen und fiel scheppernd zu Boden. Maria krümmte sich zusammen und hielt sich an der Kante des Küchenschranks fest. Ihr wurde schwarz vor Augen, und sie merkte nicht mehr, daß sie hinfiel.
*
Georg hatte die Küche verlassen und stand noch in der Diele, als er den Schrei hörte. Gleich darauf klirrte es. Er eilte zurück und sah die Magd zu Boden fallen.
»Maria!« rief er entsetzt.
Sie rührte sich nicht. Der Bauer beugte sich über sie. Das Gesicht der Magd war aschfahl, und sie schien nicht mehr zu atmen. Oder wenn doch, dann nur noch ganz schwach.
Der Bauer verlor keine Zeit und hastete zum Telefon. Die Nummer das Arztes kannte er auswendig. Oft genug hatte er sie gewählt, als der Vater krank darniederlag. Am anderen Ende wurde nach dem zweiten Klingeln abgenommen, und die Arzthelferin meldete sich.
»Burgthaler hier, Frau Brunner«, rief Georg. »Der Doktor muß sofort kommen. Die Maria, sie ist zusammengebrochen. Ich glaub’, sie atmet net mehr!«
Den letzten Satz hatte er mit erstickter Stimme gesprochen.
»Ich sag’ Dr. Wiesinger sofort Bescheid«, antwortete die Arzthelferin und legte auf.
Bange Minuten vergingen. Von St. Johann bis zum Burgthalerhof waren es gute zehn Autominuten. Georg beugte sich immer wieder über Maria, fühlte nach ihrem Puls und atmete auf, als er ihn ganz leise spürte.
»Herrgott«, flüsterte er, »du darfst sie mir net nehmen. Bitte, mach’, daß es nur ein kleiner Schwächeanfall ist. Sie muß leben, die Maria. Bitte, lieber Gott!«
Endlich hörten er einen Wagen auf den Hof fahren und eilte an die Tür. Toni Wiesinger war schon ausgestiegen, seine Arzttasche in der Hand.
»Sie liegt in der Küche«, erklärte der Bauer. »Ich hab’ mich net getraut, sie woanders hinzulegen.«
»Das war vollkommen richtig«, nickte der Arzt. »Ich hab’ einen Rettungswagen alarmiert. Sie werden gleich hier sein. Such’ schon mal ein paar Sachen zusammen. Maria wird bestimmt ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen.«
Während der Arzt sich um die Magd kümmerte, lief Georg in Marias Kammer und suchte zusammen, was man im Krankenhaus so braucht: Waschbeutel, Nachtzeug, etwas Wäsche.
Er hatte gerade alles in eine Tasche gestopft, als der Notarztwagen auf den Hof fuhr. Toni Wiesinger empfing den Kollegen und führte ihn in die Küche. Mit bangem Gesicht stand Georg daneben.
»Herzinfarkt«, sagte der junge Arzt aus St. Johann. »Ich habe den Kreislauf stabilisiert und ihr ein blutverdünnendes Medikament verabreicht.«
Die beiden Rettungssanitäter, die den Notarzt begleiteten, hatten Maria eine Sauerstoffmaske aufgesetzt und hoben sie auf die Trage.
»Wo bringen Sie sie hin?« fragte Georg.
»Maria hatte einen Herzinfarkt«, erklärte Toni ihm noch einmal. »Sie kommt ins Krankenhaus in der Kreisstadt. Garmisch wär’ mir eigentlich lieber, das ist aber zu weit. Ich hab’ sie zwar ein bissel stabilisieren können, trotzdem ist jetzt Eile geboten.«
Der Bauer nickte verstehend.
»Kann ich mitfahren?«
Dr. Wiesinger schüttelte den Kopf.
»Besser net«, entgegnete er. »Maria muß jetzt erst einmal intensiv behandelt werden. Du würdest da nur herumhocken und warten. Bleib’ hier, Georg. Ich steh’ mit den Kollegen im Krankenhaus in Verbindung und werd’ dich benachrichtigen, sobald ich was weiß.«
Georg Burgthaler nickte.
Zusammen gingen sie nach draußen. Dort hatte man Maria schon in den Rettungswagen geschoben und die Türen geschlossen.
»Besteht Lebensgefahr?« fragte der Bauer.
Toni Wiesinger sah ihn ernst an.
»Ich will ehrlich sein«, antwortete der Arzt. »Ein Infarkt ist immer eine schwere Krankheit, und Maria ist net mehr die jüngste. Man muß auf alles gefaßt sein. Aber du darfst die Hoffnung net aufgeben.«
Er nickte ihm aufmunternd zu und stieg in sein Auto. Georg sah ihn davonfahren und war nicht mehr in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.
Daß Maria und er hier zusammen wohnten, war eine solche Selbstverständlichkeit, daß es ihm nie in den Sinn gekommen war, es könne sich jemals etwas daran ändern. Dabei hätte er es durchaus erwarten müssen. Er hatte es ja schon zweimal erlebt, bei der Mutter und beim Vater.
Eigentlich wollte er zum Hornstieg hinauffahren und schauen, wie es dort auf den Feldern stand. Doch jetzt war er nicht mehr dazu in der Lage. Statt dessen setzte er sich auf die Bank, die vor dem Haus stand, und starrte traurig vor sich hin.
Es mochte wohl eine Stunde vergangen sein, bis er sich endlich aufraffte. Trotz allem ging das Leben weiter, und er mußte sich um die Kühe kümmern.
Zeit zum Melken.
Eine Arbeit, die sie immer zusammen verrichtet hatten. Jetzt machte er sie alleine. Georg beeilte sich damit, denn er wollte schnell wieder im Haus sein, für den Fall, daß Dr. Wiesinger anrief. Er hockte sich in die Küche, ließ seinen Blick wandern und dachte an Maria.
Wie sollte es jetzt weitergehen? Konnte es eigentlich noch schlimmer kommen?
Endlich klingelte das Telefon. Georg hastete in die Diele und nahm den Hörer ab.
»Ja?«
»Ich bin’s«, vernahm er die Stimme des Arztes. »Maria ist erst einmal außer Lebensgefahr. Allerdings befindet sie sich noch im Koma. Es hat also keinen Zweck, daß du zu ihr fährst. Morgen mittag vielleicht.«
»Und... sie wird wieder gesund?« fragte er.
»Nun ja«, schränkte Dr. Wiesinger ein, »ganz gesund wird sie wohl werden und bleiben, wenn sie sich an bestimmte Vorschriften hält. Maria wird künftig darauf angewiesen sein, regelmäßig die Medikamente zu nehmen, die man ihr verschreiben wird, und Diät zu halten. Außerdem muß sie sich regelmäßig untersuchen lassen. Allerdings wird sie net mehr so schaffen können, wie bisher.«
Georg atmete erleichtert auf. Er hatte nur vernommen, daß Maria wieder gesund werden würde. Daß sie kaum mehr eine vollwertige Arbeitskraft sein konnte, daran dachte er erst später, als er wieder in der Küche hockte und sich ein karges Abendessen zubereitete, das er dann doch nicht aß.
Und dann stellte sich ihm wieder die Frage, wie es weitergehen sollte. Schon zu zweit war es schwer genug gewesen, den Hof zu bewirtschaften. Aber ohne die Magd war es schier aussichtslos.
*
Sebastian Trenker hatte von Dr. Wiesinger erfahren, was geschehen war. Noch am selben Abend machte er sich zum Burgthalerhof auf, um mit Georg zu sprechen. Der Bergpfarrer fand den jungen Bauern in der Küche sitzend. Vor ihm auf dem Tisch stand ein Holzteller, auf dem eine unberührte Brotscheibe lag.
»Ich bring’ einfach keinen Bissen runter«, erklärte Georg und blickte Sebastian mutlos an.
»Die Maria wird’s überleben«, sagte der Geistliche. »Und das ist erst einmal die Hauptsache. Du aber, Georg, du mußt dafür sorgen, daß du bei Kräften bleibst. Denn jetzt wirst’ für zwei schaffen müssen. Ich hab’ mir auf der Fahrt hierher schon den Kopf zerbrochen, wer dir bei der Arbeit helfen könnt’, aber mir fällt niemand ein.«
Der Bauer seufzte.
»Ich will eigentlich gar net, daß irgendein Fremder hier schafft«, antwortete er.
Sebastian schüttelte den Kopf.
»Allein’ wirst’ es kaum schaffen. Sei net so stur. Vielleicht rufst’ mal beim Arbeitsamt an. Möglicherweise sucht grad jemand händeringend eine Anstellung.«
»Aber wie soll denn das geh’n?« fragte Georg zurück. »Ich kann doch net noch eine Magd bezahlen. Das Geld ist einfach net da.«
Pfarrer Trenker nickte verstehend.
»Ich weiß«, sagte er. »Die Schulden, die dein Vater dir hinterlassen hat, drücken schwer. Wie lang’ hast’ denn noch daran zu zahlen?«
»Zwei, drei Jahr’ bestimmt noch. Und wenn die Ernte so schlecht ausfällt, wie ich befürchte, dann wird’s noch länger dauern.«
Die Antwort stimmte den guten Hirten von St. Johann nicht gerade optimistisch.





























