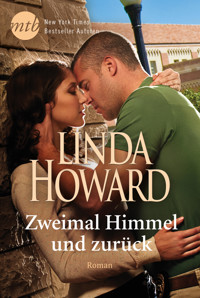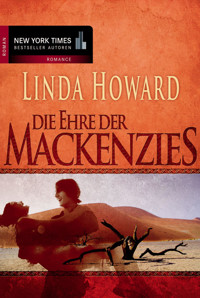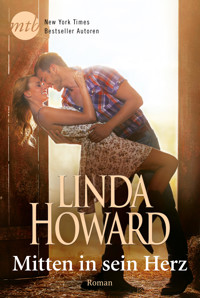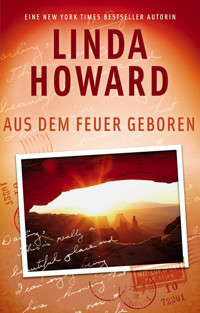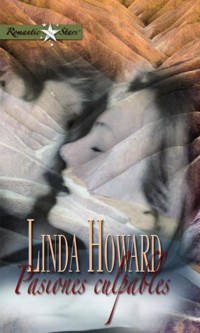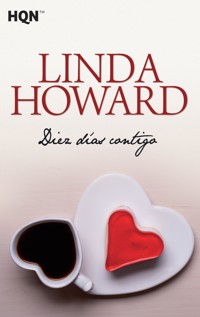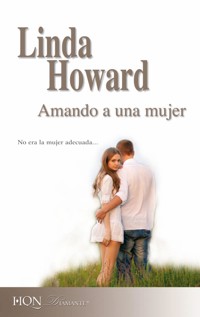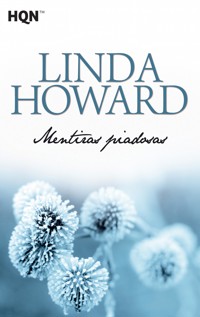6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie will kämpfend untergehen - bis sie ihn trifft ...
Lily Mansfield arbeitet als Auftragskillerin für die CIA. Kein Auftrag scheint zu schwierig für sie. Dabei wird sie zunehmend waghalsiger und geht Risiken ein, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kollegen gefährden könnten. Als ihre besten Freunde ermordet werden, startet Lily einen Rachefeldzug und niemand scheint sie stoppen zu können. Bis der attraktive CIA-Agent Lucas Swain in ihr Leben tritt ...
Da die CIA Aktionen im Alleingang nicht duldet, erhält Lucas den Auftrag, Lily zu stoppen. Ein Routinejob - wenn er sich nur nicht so zu Lily hingezogen fühlen würde ...
Jetzt erstmals als eBook - spannend und voller Leidenschaft! Der Roman erschien im Original unter dem Titel Kiss Me While I Sleep.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Lily Mansfield arbeitet als Auftragskillerin für die CIA. Kein Auftrag scheint zu schwierig für sie. Dabei wird sie zunehmend waghalsiger und geht Risiken ein, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kollegen gefährden könnten. Als ihre besten Freunde ermordet werden, startet Lily einen Rachefeldzug und niemand scheint sie stoppen zu können. Bis der attraktive CIA-Agent Lucas Swain in ihr Leben tritt ...
Da die CIA Aktionen im Alleingang nicht duldet, erhält Lucas den Auftrag, Lily zu stoppen. Ein Routinejob – wenn er sich nur nicht so zu Lily hingezogen fühlen würde ...
Linda Howard
Mörderische Küsse
Aus dem amerikanischen Englisch von Christoph Göhler
1
Paris
Lily neigte den Kopf und lächelte ihren Begleiter Salvatore Nervi an, während ihr der Ober schweigend und mit vollendeter Eleganz einen Stuhl am besten Tisch im Restaurant herauszog; zumindest ihr Lächeln war echt, wenn schon sonst so gut wie nichts an ihr echt war. Das blasse Eisblau ihrer Augen wurde von farbigen Kontaktlinsen zu einem weichen Haselnussbraun erwärmt; ihr blondes Haar war zu einem vollen Nerzbraun abgedunkelt und mit dezenten Highlights durchsetzt. Sie frischte den Haaransatz alle paar Tage auf, damit sich kein verräterisches Blond zeigen konnte. Für Salvatore Nervi hieß sie Denise Morel, ein Nachname, der aufgrund der zahlreichen Morels in Frankreich nicht allzu außergewöhnlich, aber auch nicht so gewöhnlich war, dass er unterbewusst Alarm ausgelöst hätte. Salvatore Nervi war von Natur aus misstrauisch, ein Charakterzug, der ihm schon so oft das Leben gerettet hatte, dass er das Zählen wahrscheinlich längst aufgegeben hatte. Aber wenn heute Abend alles glatt ging, würde sie ihn trotzdem zu packen kriegen – und zwar an seinem Schwanz. Was für eine Ironie.
Ihre selbst fabrizierte Vergangenheit reichte nur ein paar Schichten tief; mehr hatte sie in der kurzen Zeit nicht präparieren können. Sie hatte einfach darauf gesetzt, dass er seine Leute nicht allzu tief graben lassen und nicht die Geduld aufbringen würde, alle Ergebnisse abzuwarten, ehe er zur Tat schritt. Normalerweise übernahm es die Zentrale in Langley, sie mit einer fiktiven Vergangenheit zu versehen, aber diesmal war sie auf sich allein gestellt. Sie hatte in der knappen Zeit, die ihr zur Verfügung stand, ihr Bestes versucht. Wahrscheinlich wühlte Rodrigo, Salvatores ältester Sohn und die Nummer zwei im Nervi-Clan, immer noch; ihr blieb nicht allzu viel Zeit, bis er erkennen musste, dass diese geheimnisvolle Denise Morel vor wenigen Monaten aus dem Nichts aufgetaucht war.
»Ah!« Salvatore ließ sich mit einem zufriedenen Seufzen in seinen Stuhl zurücksinken und erwiderte ihr Lächeln. Er war ein gut aussehender Mann von Anfang fünfzig und vom Aussehen her ein typischer Italiener mit glänzendem, dunklem Haar und flinken, dunklen Augen über einem sinnlichen Mund. Er legte großen Wert darauf, in Form zu bleiben, und hatte noch kein einziges graues Haar – entweder das, oder er war genauso geschickt im Auffrischen wie sie. »Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus; habe ich Ihnen das schon gesagt?«
Auch sein Charme war klassisch italienisch. Zu dumm, dass er ein kaltblütiger Killer war. Na ja, das war sie auch. Darin waren sie einander ebenbürtig, wobei sie allerdings hoffte, dass sie sich nicht genau ebenbürtig waren. Ein Vorteil, so klein er auch sein mochte, käme ihr sehr gelegen.
»Das haben Sie«, antwortete sie mit warmem Blick. Sie sprach mit Pariser Akzent, den sie lang und mühsam einstudiert hatte. »Nochmals vielen Dank.«
Der Geschäftsführer des Restaurants, M. Durand, kam an ihren Tisch und verneigte sich höflich. »Es ist mir eine Ehre, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, Monsieur. Ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie: Es ist uns gelungen, eine Flasche 82er Château Maximilien zu erstehen. Sie ist gestern eingetroffen, und ich habe sie sofort beiseite gelegt, als ich Ihren Namen auf der Gästeliste sah.«
»Exzellent!« Salvatore strahlte vor Glück. Der 82er Bordeaux war ein außergewöhnlicher Jahrgang, von dem nur noch wenige Flaschen im Umlauf waren. Und für diese wenigen Flaschen wurden exorbitante Preise verlangt. Salvatore war Weinkenner und bereit, für einen seltenen Wein fast jeden Preis zu zahlen. Damit nicht genug, er war ein echter Weinliebhaber; wenn er einen guten Wein trank, zelebrierte er jeden Schluck, indem er in den höchsten Tönen von dem Bukett und den verschiedenen Aromen schwärmte. Er strahlte Lily glückselig an. »Dieser Wein ist das reinste Ambrosia; Sie werden sehen.«
»Wohl kaum«, erwiderte sie gelassen. »Mir hat noch kein Wein geschmeckt.« Von Anfang an hatte sie klar gemacht, dass sie mit ihrer Abneigung gegen jeden Wein eine recht untypische Französin war. Ihre Geschmacksnerven waren geradezu schändlich plebejisch. In Wahrheit hatte Lily nichts gegen ein Glas Wein einzuwenden, aber wenn sie mit Salvatore zusammen war, war sie nicht Lily; dann war sie Denise Morel, und Denise trank ausschließlich Kaffee oder Mineralwasser.
Salvatore lachte leise und sagte: »Wir werden sehen.« Trotzdem bestellte er einen Kaffee für sie.
Dies war ihr dritter Abend mit Salvatore; sie hatte sich vom ersten Moment an deutlich mehr geziert, als ihm lieb war, und ihn zweimal abblitzen lassen, ehe sie auch nur mit ihm ausgegangen war. Es war ein kalkuliertes Risiko gewesen, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Salvatore war es gewohnt, dass die Menschen seine Nähe, seine Gunst suchten; dass ihn jemand abwies, war er ganz und gar nicht gewohnt. Ihr scheinbares Desinteresse hatte im Gegenzug sein Interesse gesteigert, denn so war das bei allen mächtigen Menschen: Sie erwarteten, dass ihre Mitmenschen um sie buhlten. Außerdem war Denise Morel nicht gewillt, sich seinem Geschmack anzupassen, wie zum Beispiel beim Wein. Bei ihren beiden vorangegangenen Treffen hatte er jedes Mal versucht, sie zu einem Schlückchen Wein zu überreden, aber sie hatte sich eisern verweigert. Weil er noch nie mit einer Frau zusammen gewesen war, die nicht automatisch versucht hatte, ihm zu gefallen, reizte ihn ihre reservierte Art umso mehr.
Lily konnte es nur mit Mühe ertragen, in seiner Nähe zu sein, ihn anzulächeln, mit ihm zu plaudern, seine beiläufigen Berührungen zu erdulden. Meist schaffte sie es, ihren Groll im Zaum zu halten, indem sie sich ausschließlich auf ihren Plan konzentrierte, aber manchmal wurde ihr vor Zorn und Schmerz richtig speiübel, sodass sie sich nur mit größter Mühe beherrschen konnte und ihm am liebsten mit bloßen Händen an die Gurgel gegangen wäre.
Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie ihn einfach abgeknallt, aber Salvatore wurde professionell abgeschirmt. Sie wurde regelmäßig von Kopf bis Fuß abgetastet, bevor man sie zu ihm ließ; die beiden ersten Male hatten sie sich bei gesellschaftlichen Anlässen getroffen, wo alle Gäste vorsorglich durchsucht worden waren. Niemals stieg Salvatore im Freien in ein Auto; das Auto wurde stets unter ein schützendes Vordach gefahren, bevor Salvatore aus dem Haus trat, und er fuhr nirgendwohin, wo er ungeschützt aus dem Wagen steigen musste. Im Zweifelsfall fuhr er eben nicht. Lily war sicher, dass es in seinem Haus in Paris einen geschützten Geheimausgang gab, durch den er ungesehen verschwinden konnte, aber falls dem so war, dann hatte sie ihn noch nicht entdeckt.
Dieses Restaurant zog er allen anderen vor, weil es hier einen überdachten Seiteneingang gab, der von fast allen Gästen benutzt wurde. Außerdem war es ein höchst exklusives Lokal; die Warteliste war lang und wurde kaum je berücksichtigt. Die Gäste zahlten gut, um ungestört an einem sicheren Ort speisen zu können, und der Geschäftsführer scheute keine Mühe, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. So gab es beispielsweise keine Fenstertische; stattdessen waren in allen Fensterlaibungen Blumenkästen aufgestellt. Überall im Essbereich erhoben sich gemauerte Säulen, die alle Sichtachsen von den Fenstern aus zerteilten. Die Atmosphäre war gleichzeitig gemütlich und nobel. Ein Geschwader schwarz befrackter Kellner schwebte zwischen den Tischen herum, füllte Wein nach, leerte Aschenbecher, fegte Krümel zusammen und erfüllte möglichst jeden Wunsch, noch bevor er ausgesprochen war. Draußen reihten sich am Straßenrand die Limousinen mit verstärkten Stahltüren, kugelsicheren Scheiben und gepanzerten Unterböden. In den Autos saßen bewaffnete Leibwächter, die mit scharfem Blick die Straße und die Fenster der umliegenden Gebäude beobachteten, ob von dort Gefahr drohte, real oder imaginär.
Die sicherste Methode, dieses Restaurant und all seine berüchtigten Gäste auszuradieren, wäre eine ferngelenkte Rakete gewesen. Alles mit einem kleineren Kaliber erforderte eine große Portion Glück und war bestenfalls unberechenbar. Zu schade, dass sie keine ferngelenkte Rakete besaß.
Das Gift war in dem Bordeaux, der gleich serviert würde, und es war so stark, dass schon ein halbes Glas Wein tödlich wirkte. Der Geschäftsführer hatte keine Mühe gescheut, diesen Wein für Salvatore zu besorgen, und Lily hatte keine Mühe gescheut, die Flasche vor ihm in die Hand zu bekommen und dafür zu sorgen, dass M. Durand davon erfuhr. Erst als sie sicher gewesen war, dass sie und Salvatore hier speisen würden, hatte sie die Flasche liefern lassen.
Salvatore würde bestimmt versuchen, sie zu einem Gläschen Wein zu überreden, aber er würde nicht ernsthaft damit rechnen, dass er Erfolg haben würde.
Dafür rechnete er wahrscheinlich sehr wohl damit, dass sie heute Nacht sein Bett teilte, aber auch darin würde er ein weiteres Mal enttäuscht werden. Ihr Hass war so ätzend, dass sie sich kaum überwinden konnte, seine Küsse zu ertragen und mit gespielter Erregung auf seine Berührungen zu reagieren. Um keinen Preis der Welt würde sie ihn noch näher an sich heranlassen. Außerdem wollte sie nicht in seiner Nähe sein, wenn das Gift zu wirken begann, was vier bis acht Stunden nach der Einnahme geschehen würde, wenn Dr. Speer richtig geschätzt hatte; bis dahin wollte sie möglichst schon außer Landes sein.
Bis Salvatore merkte, dass etwas nicht stimmte, wäre es bereits zu spät; bis dahin hätte das Gift bereits seine Wirkung entfaltet, seine Nieren und die Leber zerstört und das Herz angegriffen. Er würde an mehrfachem massivem Organversagen krepieren. Vielleicht hätte er noch ein paar Stunden zu leben, möglicherweise sogar einen vollen Tag, bevor sein Körper endgültig den Geist aufgeben würde. Rodrigo würde ganz Frankreich durchkämmen lassen, um Denise Morel aufzuspüren, aber die hätte sich in Luft aufgelöst – zumindest vorübergehend. Sie hatte keineswegs vor, unsichtbar zu bleiben.
Gift war normalerweise nicht das Mittel ihrer Wahl; dazu hatte sie Salvatores Sicherheitsfanatismus gezwungen. Am liebsten setzte sie die Pistole ein, und das hätte sie sogar getan, auch wenn sie gewusst hätte, dass sie daraufhin selbst niedergeschossen worden wäre, aber sie hatte keine Möglichkeit gesehen, mit einer Waffe nahe genug an ihn heranzukommen. Wenn sie nicht allein gearbeitet hätte, dann vielleicht ... aber vielleicht auch nicht. Salvatore hatte schon mehrere Attentate überlebt und aus jedem eine Lehre gezogen. Nicht einmal ein Scharfschütze konnte ihn ins Visier nehmen. Wenn sie Salvatore Nervi umbringen wollte, musste sie entweder Gift einsetzen oder eine Waffe mit enormer Sprengkraft, die auch die Menschen in seiner Umgebung töten würde. Lily hätte keine Skrupel gehabt, Rodrigo oder irgendeinen anderen aus Salvatores Organisation ins Jenseits zu befördern, aber Salvatore war schlau genug, sich immer auch mit Unschuldigen zu umgeben. So gewissenlos und unterschiedslos zu morden brachte Lily nicht fertig; darin unterschied sie sich von Salvatore. Vielleicht war es der einzige Unterschied, aber diesen Unterschied musste sie um jeden Preis bewahren, wenn sie nicht den Verstand verlieren wollte.
Sie war siebenunddreißig. Sie arbeitete in diesem Job, seit sie achtzehn war, damit war sie über die Hälfte ihres Lebens eine Auftragsmörderin gewesen, und zwar eine verdammt gute, sonst hätte sie in diesem Geschäft nicht so lange überlebt. Anfangs war ihre Jugend von Vorteil gewesen: Sie hatte so frisch und unschuldig gewirkt, dass niemand sie als Bedrohung wahrgenommen hatte. Diesen Vorteil hatte sie nicht mehr, aber das machte sie durch ihre Erfahrung wett. Allerdings zehrte die Erfahrung auch an ihr, weshalb sie sich manchmal spröde wie eine angeknackste Eierschale fühlte; ein letzter Schlag, und sie würde zerbrechen.
Falls sie nicht bereits zerbrochen war und es nur noch nicht gemerkt hatte. Sie wusste, dass sie sich fühlte, als wäre ihr nichts mehr geblieben, als wäre ihr Leben eine öde Wüste. Nur ein einziges Ziel stand ihr noch vor Augen: Salvatore Nervi sollte untergehen und mit ihm seine ganze Organisation. Er war der erste, der wichtigste Punkt auf ihrer Liste, denn er hatte den Befehl gegeben, die Menschen umzubringen, die sie mehr liebte als alle anderen. Dieses Ziel war so übermächtig, dass sie nichts anderes mehr sehen konnte, keine Hoffnung, kein Lachen, keinen Sonnenschein. Dass sie ihre selbst gestellte Aufgabe wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen würde, zählte kaum.
Das bedeutete aber nicht, dass sie einfach aufgeben würde. Sie spürte keine Todessehnsucht; im Gegenteil, ihre Berufsehre gebot, dass sie nicht nur ihren Job erledigte, sondern auch noch damit durchkam. Und in ihrem Herzen flackerte immer noch die allzu menschliche Hoffnung, dass sie nicht nur überleben, sondern dass eines Tages dieser namenlose Schmerz nachlassen und sie wieder Freude am Leben finden würde. Die Hoffnung war nur eine kleine Flamme, aber sie leuchtete hell. Lily vermutete, dass es genau diese Hoffnung war, weswegen die meisten Menschen selbst im Angesicht nackter Verzweiflung unverdrossen weiterrackerten, weswegen so wenige tatsächlich aufgaben.
Trotzdem machte sie sich keine Illusionen über die Schwierigkeiten bei ihrem Vorhaben und über ihre Überlebenschancen währenddessen und danach. Nachdem sie diesen Job erledigt hätte, würde sie spurlos verschwinden müssen, vorausgesetzt, sie war dann noch am Leben. Die Schreibtischhengste in Washington wären bestimmt nicht begeistert, wenn sie Nervi abservierte. Nicht nur Rodrigo würde nach ihr suchen, sondern auch ihre eigenen Leute, und sie wusste nicht, ob es einen Unterschied machte, wer sie letztendlich aufspürte. Sie hatte sozusagen die schützende Hand abgeschüttelt, und das bedeutete, dass sie nicht nur entbehrlich war – das war sie immer gewesen –, sondern dass man kein Interesse mehr an ihrem Weiterleben hatte. Alles in allem eine eher unerfreuliche Situation.
Nach Hause konnte sie auf keinen Fall, und das nicht nur, weil sie längst kein Heim mehr hatte. Sie durfte ihre Mutter und Schwester nicht in Gefahr bringen, von der Familie ihrer Schwester ganz zu schweigen. Außerdem hatte sie seit zwei, drei Jahren nicht mehr mit ihren Verwandten gesprochen ... nein, inzwischen waren mindestens vier Jahre vergangen, seit sie zum letzten Mal mit ihrer Mutter telefoniert hatte. Oder fünf. Sie wusste, dass alle wohlauf waren, weil sie sich regelmäßig darüber informierte, aber die nackte Wahrheit war, dass sie nicht mehr in jene Welt gehörte und dass ihre Mutter und Schwester Lilys Welt genauso wenig verstehen würden. Gesehen hatte sie ihre Verwandten seit einem knappen Jahrzehnt nicht mehr. Sie gehörten dem »Zuvor« an, während sie selbst unwiderruflich im »Danach« lebte. Ihre Freunde in der Firma waren ihre neue Familie gewesen – und die hatte man abgeschlachtet.
Von jenem Zeitpunkt an, als sich herumgesprochen hatte, dass Salvatore Nervi hinter dem Tod ihrer Freunde steckte, hatte sie sich nur noch auf ein einziges Ziel konzentriert: Salvatore so nahe zu kommen, dass sie ihn töten konnte. Er hatte kein Hehl daraus gemacht, dass er den Mord befohlen hatte; stattdessen hatte er die Tat dazu genutzt, allen vor Augen zu führen, dass man ihm besser nicht in die Quere kam. Die Polizei brauchte er nicht zu fürchten; dank seiner zahlreichen Verbindungen war er von dieser Front her nicht angreifbar. Salvatore hatte nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa so viele einflussreiche Menschen in der Hand, dass er tun und lassen konnte, was ihm gerade einfiel.
Ihr wurde bewusst, dass Salvatore etwas zu ihr gesagt hatte und sie jetzt verärgert ansah, weil sie ihm so offensichtlich nicht zugehört hatte. »Verzeih mir«, entschuldigte sie sich. »Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Sie hat heute angerufen und mir erzählt, dass sie die Treppe hinuntergefallen ist. Sie behauptet, sie hätte sich nichts getan, aber ich glaube, ich sollte mich selbst davon überzeugen. Sie ist schließlich schon über siebzig, und alte Leute brechen sich leicht etwas, nicht wahr?«
Es war eine gewitzte Lüge, und das nicht nur, weil sie tatsächlich gerade an ihre Mutter gedacht hatte. Salvatore war Italiener bis ins Mark; er hatte seine Mutter abgöttisch verehrt und besaß einen ausgeprägten Familiensinn. Umgehend sah er sie bestürzt an. »Aber natürlich musst du zu ihr. Wo lebt sie denn?«
»In Toulouse.« Die Stadt lag in Südfrankreich und damit so weit wie möglich von Paris entfernt. Falls Salvatore seinem Sohn von ihrer Mutter in Toulouse erzählen sollte, konnte sie sich damit ein paar Stunden erkaufen, während Rodrigo den Süden nach ihr durchkämmte. Natürlich war es genauso gut möglich, dass Rodrigo annahm, sie hätte Toulouse nur erwähnt, um ihn in die Irre zu führen; ob ihr Plan aufging oder nicht, war ein Schuss ins Blaue. Sie hatte keine Zeit vorauszuberechnen, mit welchen Winkelzügen ihr Gegner auf ihre eigenen Winkelzüge reagieren würde. Sie würde einfach ihrem Plan folgen und darauf bauen, dass er funktionierte.
»Wann kommst du zurück?«
»Übermorgen, vorausgesetzt, ihr ist nichts passiert. Andernfalls –« Sie zuckte die Achseln.
»Dann müssen wir diese Nacht bis zur Neige auskosten.« Das Glühen in seinen dunklen Augen verriet nur zu deutlich, woran er dabei dachte.
Sie verstellte sich nicht. Stattdessen wich sie kaum merklich zurück und zog die Brauen hoch. »Vielleicht«, meinte sie kühl. »Vielleicht auch nicht.« Ihr Tonfall ließ erkennen, dass sie nicht allzu scharf darauf war, mit ihm zu schlafen.
Wenn überhaupt, dann heizte ihre Abfuhr sein Interesse zusätzlich an; sofort glühten seine Augen noch intensiver. Vielleicht erinnerte ihn ihr Zögern an seine unbeschwerte Jugendzeit, als er seine inzwischen verstorbene Gemahlin umworben hatte, die Mutter seiner Kinder. Zu seiner Zeit hatten die jungen Italienerinnen ihre Tugend noch sorgsam gehütet; möglicherweise war das auch heute noch so, das wusste sie nicht. Sie hatte kaum Kontakt zu jungen Frauen aus irgendeinem Land.
Zwei Ober kamen an ihren Tisch, von denen einer die bestellte Weinflasche präsentierte wie eine kostbare Trophäe, während der andere ihren Kaffee servierte. Sie lächelte zum Dank, als der Kaffee vor ihr abgestellt wurde, und war dann damit beschäftigt, dicke Sahne in ihre Tasse zu gießen, scheinbar ohne Salvatore zu beachten, für den der andere Ober mit großen Gesten die Flasche entkorkte und dann den Korken zum Beriechen hinhielt. In Wahrheit richtete sie ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Flasche und das balzartige Ritual, das vor ihr aufgeführt wurde. Weinkenner machten ein großes Getue um dieses Ritual; ihr persönlich war es völlig egal. Einschenken und Austrinken waren für sie die einzig wichtigen Rituale beim Weintrinken. Sie hatte nicht die geringste Lust, an einem Korken zu schnüffeln.
Nachdem Salvatore wohlgefällig genickt hatte, schenkte der Ober mit ernster Miene und großer Geste den Wein in Salvatores Glas. Mit angehaltenem Atem verfolgte Lily, wie Salvatore den roten Bordeaux im Kelch kreisen ließ, sein Bukett erschnupperte und dann vorsichtig kostete. »Ah!«, urteilte er nach einer halben Ewigkeit und mit genießerisch geschlossenen Augen. »Exzellent.«
Der Ober verbeugte sich, als wäre die Qualität des Weines allein sein Verdienst, stellte die Flasche in den Weinständer auf ihrem Tisch und entfernte sich.
»Den musst du probieren«, sagte Salvatore zu Lily.
»Das wäre Verschwendung.« Sie trank einen Schluck Kaffee. »Mir schmeckt der hier wesentlich besser.« Sie deutete auf ihre Tasse. »Wein ... igitt!«
»Dieser Wein wird dich bekehren, das verspreche ich dir.«
»Das haben mir schon viele versprochen. Und alle haben sich geirrt.«
»Nur ein winziges Schlückchen, nur für den Geschmack«, gurrte er, und zum ersten Mal sah sie so etwas wie Unwillen in seinen Augen aufflackern. Er war Salvatore Nervi, er war es nicht gewohnt, dass ihm jemand widersprach, und schon gar nicht eine Frau, die er mit seiner Aufmerksamkeit beehrt hatte.
»Ich kann Wein nicht ausstehen –«
»Diesen Wein hast du noch nicht probiert«, sagte er, griff nach der Flasche, schenkte einen Fingerbreit in ein zweites Glas und reichte es ihr dann über den Tisch. »Wenn du den hier nicht für göttlich hältst, werde ich dich nie wieder bitten, einen Wein zu kosten. Darauf gebe ich dir mein Wort.«
Damit hatte er unbestreitbar recht, denn dann wäre er tot. Und sie auch, wenn sie jetzt von dem Wein trank.
Als sie den Kopf schüttelte, wurde er wirklich zornig und stellte das Glas hart auf der Tischplatte ab. »Nie tust du das, was ich möchte.« Wütend sah er sie an. »Ich würde gern wissen, warum du überhaupt hier bist. Vielleicht sollte ich dich von meiner Gesellschaft erlösen und den Abend beenden, hm?«
Nichts hätte ihr besser gefallen – wenn er nur schon mehr Wein getrunken hätte. Sie glaubte nicht, dass ein kleiner Schluck genug Gift enthielt, um ihn zu erledigen. Das Gift war angeblich hochwirksam, und sie hatte genug davon durch den Korken in die Flasche injiziert, um mit dieser Flasche sämtliche Ober im Restaurant abzuservieren. Aber was würde mit der entkorkten Weinflasche passieren, wenn er jetzt wutentbrannt aufstand? Würde er sie mitnehmen, oder würde er sie auf dem Tisch stehen lassen und aus dem Restaurant stürmen? Der Wein war viel zu teuer, als dass man ihn wegschütten würde, so viel war klar. Nein, entweder würde man ihn glasweise an die anderen Gästen verkaufen, oder die Belegschaft würde ihn unter sich aufteilen.
»Na gut«, gab sie sich geschlagen und griff nach dem Glas. Ohne zu zögern, setzte sie es an den Mund und kippte es, bis der Wein ihre zusammengekniffenen Lippen benetzte, aber ohne dass sie auch nur einen Tropfen geschluckt hätte. Wirkte das Gift auch durch die Haut? Sie war fast sicher, dass es so war; immerhin hatte Dr. Speer sie ermahnt, Latexhandschuhe zu tragen, wenn sie damit hantierte. Die folgende Nacht könnte äußerst interessant werden, befürchtete sie, und zwar auf ganz andere Art als geplant, aber ihr blieb kein anderer Ausweg. Sie konnte die Flasche nicht einmal auf den Boden fegen, weil das Personal beim Aufputzen unweigerlich in Kontakt mit dem Wein kommen würde.
Sie gab sich keine Mühe, das Schaudern zu unterdrücken, das sie bei diesem Gedanken durchlief, und setzte hastig das Glas wieder ab, um anschließend ihre Lippen mit der Serviette abzutupfen, bevor sie das Tuch sorgsam so zusammenfaltete, dass sie den feuchten Fleck nicht berührte.
»Und?«, fragte Salvatore ungeduldig, obwohl er ihr Schaudern bemerkt haben musste.
»Faule Trauben«, sagte sie und schüttelte sich wieder.
Er sah sie an wie vom Donner gerührt. »Faule –?« Er konnte einfach nicht fassen, dass sie diesen fantastischen Tropfen nicht zu schätzen wusste.
»Genau. Wenn du mich fragst, lassen das Aroma, das Bukett sowie sämtliche Haupt- und Nebennoten auf verfaulte Trauben schließen. Bist du jetzt zufrieden?« Sie ließ in ihren Augen ebenfalls zornige Blitze aufblinken. »Ich mag es nicht, wenn man mich zu etwas zwingt.«
»Ich habe dich doch nicht –«
»Oh doch. Indem du mir gedroht hast, dich nicht mehr mit mir zu treffen.«
Er nahm wieder einen Schluck, auch um Zeit zu gewinnen. »Entschuldige bitte«, antwortete er dann vorsichtig. »Ich bin es nicht gewohnt, dass man –«
»Dir widerspricht?«, nahm sie ihm das Wort aus dem Mund und imitierte ihn dann, indem sie einen Schluck Kaffee trank. Würde durch das Koffein das Gift schneller wirken? Oder würde die fette Sahne es abschwächen?
Sie wäre bereit gewesen, ihr Leben zu opfern, wenn sie dafür einen gut gezielten Schuss auf seinen Kopf frei gehabt hätte; im Grunde war das hier nichts anderes. Sie hatte das Risiko so weit minimiert wie nur möglich, aber ein Restrisiko blieb immer, und ein Gifttod war ausgesprochen unangenehm.
Er zog die stämmigen Schultern hoch und sah sie betreten an. »Genau«, bestätigte er und ließ dabei seinen legendären Charme spielen. Er konnte ausgesprochen charmant sein, wenn es ihm gefiel. Wenn sie nicht gewusst hätte, wer er wirklich war, hätte sie sich vielleicht täuschen lassen; wenn sie nicht an jenen drei Gräbern gestanden hätte, in denen zwei enge Freunde und ihre Adoptivtochter gelegen hatten, hätte sie vielleicht philosophisch geschlossen, dass in ihrer Branche der Tod zum Berufsrisiko gehörte. Averill und Tina hatten gewusst, welches Wagnis sie eingingen, als sie sich auf dieses Spiel eingelassen hatten; aber die dreizehnjährige Zia war vollkommen unschuldig gewesen. Dass Zia gestorben war, konnte Lily nicht vergessen und schon gar nicht vergeben. Da half alles Philosophieren nichts.
Als sie drei Stunden später aufstanden und gingen, hatten sie ein luxuriöses Mahl verzehrt, und der gesamte Inhalt der Weinflasche schwappte in Salvatores Bauch. Es war kurz nach Mitternacht, und der Novemberhimmel spuckte wirbelnde Schneeflocken aus, die bei der ersten Berührung mit dem nassen Asphalt zerschmolzen. Lily fühlte sich elendig, aber das konnte genauso an der ständigen Anspannung liegen wie an dem Gift, das sich angeblich erst nach deutlich mehr als drei Stunden bemerkbar machen sollte.
»Ich glaube, mir ist irgendwas nicht bekommen«, sagte sie, als sie im Auto saßen.
Salvatore seufzte schwer. »Du brauchst dich nicht krank zu stellen, nur damit du nicht mitkommen musst.«
»Ich spiele dir nichts vor«, erwiderte sie scharf. Er drehte den Kopf zur Seite und starrte auf die vorbeiziehenden Lichter der Großstadt. Es war gut, dass er die ganze Flasche getrunken hatte, denn sie war ziemlich sicher, dass er sie nach diesem Abend endgültig abgeschrieben hatte.
Sie ließ den Kopf gegen die Nackenstütze sinken und schloss die Augen. Nein, das war keine Anspannung. Ihr wurde von Sekunde zu Sekunde schlechter. Sie spürte, wie der Druck in ihrem Hals zunahm, und sagte: »Lass bitte anhalten, mir wird schlecht!«
Der Chauffeur trat auf die Bremse – wie eigenartig, dass er angesichts dieser Drohung automatisch sein gesamtes Sicherheitstraining vergaß –, sie stieß die Tür auf, noch ehe der Wagen ganz ausgerollt war, beugte sich hinaus und übergab sich in den Rinnstein. Sie spürte Salvatores Hand auf ihrem Rücken und eine zweite als Stütze auf ihrem Arm, wobei er immer darauf achtete, sich nicht so weit nach vorn zu beugen, dass er von außen zu sehen war.
Nachdem sie unter Krämpfen ihren Magen entleert hatte, sank sie in den Wagen zurück und wischte sich den Mund mit dem Taschentuch ab, das ihr Salvatore schweigend reichte. »Ich muss dich um Verzeihung bitten.« Sie erschrak, als sie hörte, wie schwach und zittrig sie klang.
»Nein, ich muss dich um Verzeihung bitten«, widersprach er. »Ich habe dir nicht geglaubt, dass dir wirklich schlecht ist. Soll ich dich zu einem Arzt bringen? Ich könnte meinen Arzt anrufen –«
»Nein, es geht schon wieder«, log sie. »Bitte bring mich nur heim.«
Das tat er, unter vielen fürsorglichen Angeboten und dem Versprechen, sie gleich morgen früh anzurufen. Als der Fahrer endlich vor dem Gebäude hielt, in dem sie eine Wohnung gemietet hatte, tätschelte sie Salvatores Hand und sagte: »Ja, bitte ruf mich morgen früh an, aber küss mich nicht; vielleicht habe ich mir ein Virus eingefangen.« Mit dieser praktischen Entschuldigung zog sie ihren Mantel fester um sich und eilte durch die dichter fallenden Flocken zu ihrer Haustür, ohne sich ein letztes Mal nach dem anfahrenden Wagen umzudrehen.
Mit Mühe schaffte sie es in ihre Wohnung, wo sie im nächsten Sessel zusammenbrach. Sie konnte unmöglich ihre Habseligkeiten zusammenraffen und zum nächsten Flughafen rasen, wie sie es ursprünglich vorgehabt hatte. Vielleicht war es am besten so. Sich selbst in Gefahr zu bringen war manchmal die beste Tarnung. Wenn sie ebenfalls an Vergiftungserscheinungen litt, würde Rodrigo sie nicht verdächtigen und sich vielleicht nicht dafür interessieren, was aus ihr wurde, nachdem sie sich erholt hatte.
Vorausgesetzt, sie überlebte.
Ganz ruhig wartete sie ab, dass passieren würde, was passieren sollte.
2
Kurz nach neun Uhr am nächsten Morgen zersplitterte ihre Tür unter lautem Krachen. Drei Männer stürmten mit gezogenen Waffen herein. Lily versuchte, den Kopf zu heben, ließ ihn dann aber mit einem schwachen Stöhnen zurücksinken auf den Teppich, der das dunkel lackierte Parkett bedeckte.
Mit verschwommenem Blick bekam sie mit, dass einer der Männer neben ihr niederkniete und ihren Kopf grob zur Seite drehte. Blinzelnd versuchte sie, das Gesicht zu fixieren. Rodrigo. Sie schluckte und streckte in einer wortlosen Bitte eine zitternde Hand nach ihm aus.
Das war nicht gespielt. Die Nacht war lang und elend gewesen. Sie hatte sich mehrmals übergeben und war von heißkalten Schüttelfrostattacken gebeutelt worden. Wie Messerstiche hatten sich die Schmerzen durch ihren Magen gebohrt, bis sie sich zu einem kleinen Ball zusammengerollt und nur noch kläglich gewimmert hatte. Schreckliche Stunden lang hatte sie geglaubt, doch eine tödliche Dosis abbekommen zu haben, aber jetzt endlich schienen die Schmerzen abzunehmen. Ihr war immer noch zu flau und viel zu übel, um vom Boden auf die Couch zu klettern oder um auch nur telefonisch Hilfe zu holen. Einmal hatte sie gestern Nacht versucht, ans Telefon zu kommen, doch da war es bereits zu spät gewesen. Der Apparat war knapp außerhalb ihrer Reichweite geblieben.
Rodrigo zischte einen italienischen Fluch, schob die Waffe in das Holster und gab einem seiner Männer eine knappe, energische Anweisung.
Lily nahm ihre ganze Kraft zusammen und flüsterte leise: »Komm mir ... nicht zu nah. Vielleicht ist es ... ansteckend.«
»Nein«, widersprach er in seinem ausgezeichneten Französisch. »Ansteckend ist das nicht.« Sekunden später verschwand ihr Körper unter einer weichen Decke, die Rodrigo energisch um sie wickelte, bevor er Lily auf die Arme nahm und sie fast mühelos hochhob.
Er eilte aus der Wohnung die Treppe hinunter und durch eine Reihe von Hinterhöfen in eine Nebenstraße, wo sein Wagen mit laufendem Motor wartete. Sobald der Fahrer Rodrigo kommen sah, sprang er aus dem Wagen und riss die Hecktür auf.
Lily wurde wenig liebevoll in den Wagen verfrachtet, flankiert von Rodrigo und einem seiner Männer. Ihr Kopf kippte sofort gegen die Kopfstütze im Fond, und sie schloss wimmernd die Augen, weil sie schon wieder einen scharfen Stich in der Magengrube spürte. Sie hatte nicht die Kraft, sich aufrecht zu halten, und merkte, wie sie langsam zur Seite sank. Rodrigo schnaufte verärgert, setzte sich aber dicht neben sie, damit sie sich an ihn lehnen konnte.
Eigentlich war sie vollauf mit ihrem körperlichen Elend beschäftigt, aber ein kühler, klarer Punkt in ihrem Geist blieb davon unbehelligt und hellwach. Noch war sie nicht über den Berg, weder was das Gift noch was Rodrigo anging. Er hatte sein Urteil vorerst ausgesetzt, mehr nicht. Immerhin brachte er sie irgendwohin, wo sie behandelt wurde – hoffte sie. Wahrscheinlich würde er sie nicht quer durch die Stadt karren, nur um sie irgendwo abzuknallen und um ihre Leiche zu verscharren, denn es wäre für ihn viel einfacher gewesen, sie in ihrer Wohnung zu erledigen und danach zu verschwinden. Sie wusste nicht, ob jemand beobachtet hatte, wie er sie aus dem Haus getragen hatte, aber das war gut möglich, auch wenn er nicht den Hauptausgang genommen hatte. Nicht dass es ihm etwas ausgemacht hätte, wenn er beobachtet worden wäre, oder wenigstens nicht viel. Sie nahm an, dass Salvatore entweder schon tot war oder im Sterben lag und Rodrigo von nun an über das Nervi-Imperium herrschte; damit verfügte er über unvorstellbare Macht, finanziell wie politisch. Salvatore hatte eine Menge Leute in der Hand gehabt.
Sie kämpfte darum, die Augen offen zu halten, sich die Route einzuprägen, die der Fahrer einschlug, aber ihre Lider schlossen sich immer wieder. Schließlich hatte sie den Kampf satt und gab sich geschlagen. Wohin Rodrigo sie auch bringen würde, sie konnte sowieso nichts daran ändern.
Die Männer im Wagen schwiegen eisern; kein einziges Wort wurde gesprochen. Die Atmosphäre war gedrückt und angespannt vor Trauer oder Sorge oder auch Zorn. Genau konnte sie das nicht erspüren, und da niemand etwas sagte, gab es auch nichts zu belauschen. Selbst der Straßenlärm schien abzunehmen, bis irgendwann nur noch Schweigen herrschte.
Das Tor zum Gelände glitt bereits auf, als sich der Wagen näherte, und Tadeo, der Fahrer, rollte mit dem Mercedes durch den Spalt, sobald auf beiden Seiten eine knappe Handbreit Zwischenraum war. Rodrigo wartete, bis sie unter dem Vordach angehalten hatten und Tadeo herausgesprungen war, um die hintere Tür zu öffnen, ehe er Denise Morel zurechtrückte. Ihr Kopf rollte nach hinten; offenbar war sie bewusstlos. Ihr Teint war teigig und gelbweiß, die Augen lagen tief in ihren Höhlen, und sie dünstete einen eigenartigen Geruch aus – den gleichen Geruch, der ihm auch an seinem Vater aufgefallen war.
Rodrigos Magen krampfte sich zusammen, doch er rang die aufsteigenden Tränen rücksichtslos nieder. Er konnte es immer noch nicht wirklich begreifen – Salvatore war tot. Einfach so von ihnen gegangen. Noch hatte sich die Neuigkeit nicht herumgesprochen, aber das war nur eine Frage der Zeit. Rodrigo konnte sich nicht den Luxus gestatten, um Salvatore zu trauern; er musste sofort handeln, seine Position festigen und die Zügel in die Hand nehmen, ehe ihre zahllosen Rivalen wie eine Horde Schakale den Leichnam zu fleddern versuchten.
Als ihr Familienarzt erklärt hatte, Salvatores Beschwerden sähen nach einer Pilzvergiftung aus, hatte Rodrigo sofort reagiert. Er hatte drei Männer losgeschickt, die M. Durand aus seinem Restaurant geholt und ihn ins Haus gebracht hatten, während er selbst, gefahren von Tadeo, zusammen mit Lamberto und Cesare zu Denise Morel gerast war. Sie war die Letzte, mit der sein Vater gespeist hatte, und Gift war eine sehr weibliche Waffe, indirekt und ungezielt und mit zahllosen Mutmaßungen und Unwägbarkeiten verbunden. In diesem Fall hatte sie sich allerdings als äußerst effektiv erwiesen.
Aber falls ihr Vater durch ihre Hand gestorben war, dann hatte sie sich ebenfalls vergiftet, statt außer Landes zu fliehen. Er hatte eigentlich nicht damit gerechnet, sie in ihrer Wohnung zu finden, da Salvatore ihm erzählt hatte, sie würde nach Toulouse fahren, um ihre bettlägrige Mutter zu besuchen; Rodrigo hatte das für eine ziemlich praktische Ausrede gehalten. Anscheinend hatte er sich geirrt – oder zumindest war die Möglichkeit eines Irrtums so groß, dass er die Frau nicht auf der Stelle erschossen hatte.
Er rutschte aus dem Wagen, hakte die Arme unter ihre Achseln und hob sie von dem Sitz herab. Tadeo half ihm, sie aufrecht zu halten, bis Rodrigo einen Arm unter ihre Knie geschoben und sie an seine Brust gedrückt hatte. Sie war durchschnittlich groß, knapp unter eins siebzig, aber von der Statur her eher schlaksig; obwohl sie wie tot in seinen Armen hing, trug er sie mit Leichtigkeit ins Haus.
»Ist Dr. Giordano noch da?«, fragte er, was ihm bestätigt wurde. »Sag ihm, dass ich ihn brauche.« Er brachte sie nach oben in eines der Gästezimmer. In einem Krankenhaus wäre sie besser aufgehoben, aber Rodrigo war nicht in der Stimmung, Fragen zu beantworten. Diese Bürokraten konnten so verflucht bürokratisch werden. Und wenn sie starb, dann würde sie eben sterben; er hatte alles unternommen, wozu er bereit war. Immerhin war Vincenzo Giordano ein echter Arzt, auch wenn er keine Praxis mehr führte und seine gesamte Zeit in jenem Labor am Stadtrand von Paris verbrachte, das ihm Salvatore finanziert hatte – obwohl Salvatore möglicherweise noch am Leben wäre, wenn er früher Hilfe gesucht und darum gebeten hätte, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Trotzdem hatte Rodrigo die Entscheidung seines Vaters, Dr. Giordano zu holen, nicht in Zweifel gezogen und sogar verstanden. Gerade wenn man angreifbar war, war Diskretion überlebenswichtig.
Er legte Denise aufs Bett, betrachtete sie nachdenklich und rätselte, was sein Vater an dieser Frau so faszinierend gefunden hatte. Zwar hatte Salvatore immer einen Blick für schöne Frauen gehabt, aber diese Frau stach wirklich nicht aus der Masse heraus. Natürlich sah sie heute mit ihren strähnigen, ungekämmten Haaren und einem Teint, als wäre sie schon tot, besonders unansehnlich aus, aber selbst in ihren besten Momenten war sie nicht wirklich schön. Ihr Gesicht war ein bisschen zu hager, zu streng, und sie hatte einen leichten Überbiss. Immerhin hatte dieser Makel zur Folge, dass die Oberlippe voller wirkte als die Unterlippe, und das allein verlieh ihren Zügen etwas Pikantes, das ihr sonst völlig gefehlt hätte.
Paris war voller Frauen, die besser aussahen und mehr Stil hatten als diese Denise Morel, aber Salvatore hatte sich auf sie versteift, und zwar so sehr, dass er vor lauter Ungeduld darauf verzichtet hatte, sie gründlich durchleuchten zu lassen, ehe er sich ihr näherte. Zu Salvatores großem Erstaunen hatte sie seine ersten beiden Einladungen ausgeschlagen, woraufhin sich seine Ungeduld zur Besessenheit gesteigert hatte. War er aus lauter Gier unvorsichtig geworden? War diese Frau indirekt für seinen Tod verantwortlich?
Rodrigo war rasend vor Zorn und Schmerz. Der bloße Gedanke an diese Möglichkeit genügte, um sie erwürgen zu wollen, aber unter diesen Gefühlen warnte ihn eine kühle Stimme, dass sie ihm möglicherweise etwas erzählen konnte, das ihm bei seinen Nachforschungen weiterhelfen würde.
Er musste herausfinden, wer seinen Vater vergiftet hatte, und ihn – oder sie – eliminieren. Die Organisation konnte einen solchen Frevel nicht ohne Vergeltung hinnehmen, sonst würde Rodrigos Ruf leiden: Und da er eben dabei war, in Salvatores Fußstapfen zu treten, konnte er sich keine Zweifel an seinen Fähigkeiten oder seiner Entschlossenheit leisten. Er musste den Täter ausfindig machen. Leider gab es da unzählige Kandidaten. Wenn man mit Tod und Geld handelte, war praktisch alle Welt betroffen. Und da auch Denise vergiftet worden war, musste er auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Täter eine eifersüchtige ehemalige Geliebte seines Vaters war – oder einer von Denises Ex-Liebhabern.
Dr. Vincenzo Giordano klopfte höflich gegen den Holzrahmen der offenen Tür und trat dann ein. Rodrigo warf ihm einen kurzen Blick zu; der Mann sah abgezehrt aus, und seine sonst so ordentlichen grau melierten Locken wirkten zerzaust, so als hätte er sich die Haare gerauft. Der gute Doktor war seit seiner Jugend mit seinem Vater befreundet gewesen und hatte hemmungslos geweint, als Salvatore vor nicht einmal zwei Stunden dahingeschieden war.
»Warum ist sie nicht auch tot?« Rodrigo deutete auf die Frau im Bett.
Vincenzo nahm Denises Puls und hörte ihr Herz ab. »Sie könnte durchaus noch sterben«, sagte er und fuhr sich mit der Hand über das müde Gesicht. »Ihr Puls geht zu schnell und zu schwach. Aber vielleicht hat sie weniger von dem Gift abbekommen als Ihr Vater.«
»Glauben Sie immer noch, dass es Pilze waren?«
»Ich sagte, es sieht aus wie eine Pilzvergiftung – im Wesentlichen. Aber es gibt auch Unterschiede. Zum einen die Geschwindigkeit, mit der die Wirkung eingetreten ist. Salvatore war ein großer, kräftig gebauter Mann; als er gestern Nacht um eins nach Hause kam, fühlte er sich noch ausgezeichnet. Keine sechs Stunden später war er tot. Pilze wirken langsamer; selbst die giftigsten töten erst nach etwa zwei Tagen. Die Symptome waren demnach ähnlich; das Tempo nicht.«
»Und es war kein Cyanid oder Strichnin?«
»Strichnin war es auf keinen Fall. Das äußert sich ganz anders. Und Cyanid tötet innerhalb weniger Minuten und löst dabei starke Krämpfe aus. Salvatore hatte keine Krämpfe. Bei einer Arsenvergiftung sind die Symptome zwar ähnlich, aber sie weichen doch so weit ab, dass man Arsen ebenfalls ausschließen kann.«
»Können Sie irgendwie genau feststellen, was man ihm gegeben hat?«
Vincenzo seufzte. »Ich bin nicht einmal sicher, dass es tatsächlich ein Gift war. Es könnte auch ein Virus gewesen sein, dem wir dann aber alle ausgesetzt gewesen wären.«
»Und warum ist Salvatores Fahrer nichts passiert? Wenn dieses Virus schon nach wenigen Stunden wirkt, dann müsste er inzwischen ebenfalls krank sein.«
»Ich sagte, dass es ein Virus sein könnte, nicht dass es eines ist. Ich kann ein paar Tests machen oder mit Ihrer Erlaubnis Salvatores Leber und Nieren sezieren. Ich kann sein Blutbild mit dem der Frau vergleichen – wie heißt sie noch mal?«
»Denise Morel.«
»Ach ja, ich entsinne mich. Er hat mir von ihr erzählt.« Vincenzos dunkle Augen wurden traurig. »Ich glaube, er war verliebt.«
»Pah. Irgendwann hätte er das Interesse an ihr verloren. So wie immer.« Rodrigo schüttelte den Kopf, als wollte er ihn klar bekommen. »Das genügt. Können Sie sie retten?«
»Nein. Entweder sie überlebt, oder sie stirbt. Ich kann da gar nichts machen.«
Rodrigo überließ Vincenzo seinen Tests und ging in den Kellerraum, in dem seine Männer M. Durand gefangen hielten. Der Franzose sah mitgenommen aus, aus seiner Nase mäanderten dünne Blutrinnsale, aber ansonsten hatten Rodrigos Männer ihre Schläge auf den Rumpf beschränkt, wo sie schmerzhafter und weniger sichtbar waren.
»Monsieur Nervi!«, krächzte der Wirt, als er Rodrigo sah, und begann vor Erleichterung zu weinen. »Ich flehe Sie an! Was auch passiert ist, ich weiß nichts! Ehrenwort!«
Rodrigo zog einen Stuhl heran, setzte sich M. Durand gegenüber, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Mein Vater hat gestern Abend in Ihrem Restaurant etwas gegessen, das ihm nicht bekommen ist.« Das war eindeutig untertrieben.
Auf dem Gesicht des Franzosen zeichneten sich völlige Fassungslosigkeit und Verständnislosigkeit ab. Rodrigo konnte seine Gedanken lesen: Er wurde zu Brei geschlagen, weil Salvatore Nervi eine Magenverstimmung hatte? »Aber – aber –«, stotterte M. Durand. »Natürlich werde ich ihn entschädigen, er hätte doch nur zu fragen brauchen.« Dann erdreistete er sich zu sagen: »Das war wirklich nicht notwendig.«
»Hat er Pilze gegessen?«, fragte Rodrigo.
Wieder ein verständnisloser Blick. »Er weiß sehr gut, dass er keine Pilze gegessen hat. Für sich hat er Coq au vin mit Spargelspitzen bestellt, und Mademoiselle Morel hatte den Heilbutt. Zu keinem dieser Gerichte gab es Pilze.«
Einer der Männer im Raum war Salvatores Stammfahrer Fronte; er beugte sich vor und flüsterte Rodrigo etwas ins Ohr. Rodrigo nickte.
»Fronte sagt, dass Mademoiselle Morel sich übergeben musste, nachdem sie aus Ihrem Restaurant kam.« Sie hatte das Gift als Erste gespürt, erkannte Rodrigo. Hatte sie es demnach auch als Erste eingenommen? Oder hatte es bei ihr schneller gewirkt, weil sie leichter war als Salvatore?
»Das kann nicht an meinem Essen liegen, Monsieur.« Durand fühlte sich zutiefst getroffen. »Kein anderer Gast wurde krank oder hat sich beschwert. Der Heilbutt war auf keinen Fall schlecht, und selbst wenn es so gewesen wäre, hatte Monsieur Nervi nichts davon gegessen.«
»Was haben sie denn gemeinsam gegessen?«
»Gar nichts«, erwiderte M. Durand wie aus der Pistole geschossen. »Höchstens etwas Brot, obwohl mir nicht aufgefallen ist, dass Mademoiselle Morel welches genommen hat. Monsieur hatte eine Flasche Wein, einen ganz außerordentlichen Bordeaux Château Maximilien Jahrgang 1982, während Mademoiselle wie gewöhnlich Kaffee trank. Monsieur hat auf sie eingewirkt, den Wein zu probieren, aber er war nicht nach ihrem Geschmack.«
»Den Wein haben sie also gemeinsam getrunken.«
»Sie hat nur einen einzigen Schluck genommen. Wie gesagt, er schmeckte ihr nicht. Mademoiselle trinkt keinen Wein.« Durands typisch gallisches Achselzucken ließ erkennen, dass er diese Eigenart nicht nachvollziehen konnte, aber was wollte man da machen?
Und doch hatte sie gestern Abend Wein getrunken, wenn auch nur einen kleinen Schluck. War das Gift so hochwirksam, dass schon ein einziger Schluck lebensbedrohlich wirken konnte?
»Blieb etwas von dem Wein übrig?«
»Nein. Monsieur Nervi trank alles aus.«
Das war nicht ungewöhnlich. Salvatore war bemerkenswert standfest gewesen und hatte demzufolge auch mehr getrunken als die meisten Italiener.
»Die Flasche. Haben Sie die Flasche noch?«
»Die liegt bestimmt schon in der Altglastonne. Hinter dem Restaurant.«
Rodrigo befahl zweien seiner Männer, die Tonne nach der leeren Bordeauxflasche zu durchwühlen, und wandte sich dann wieder an M. Durand. »Na schön. Sie bleiben mein Gast« – er schenkte ihm ein freudloses Lächeln –, »bis diese Flasche und die Weinreste analysiert sind.«
»Aber das kann –«
»Tage dauern, genau. Sie werden das bestimmt verstehen.« Vielleicht würde Vincenzo in seinem eigenen Labor schneller zu einem Ergebnis kommen.
Mr. Durand wurde unsicher. »Ist Ihr Vater ... sehr krank?«
»Nein.« Rodrigo stand auf. »Er ist tot.« Und wieder bohrten sich die Worte direkt in sein Herz.
Am nächsten Tag spürte Lily, dass sie überleben würde; Dr. Giordano brauchte zwei weitere Tage, um die gleiche Prognose zu stellen. Es dauerte drei Tage, bis sie sich so weit erholt fühlte, dass sie aus dem Bett aufstehen und das dringend nötige Bad nehmen konnte. Ihre Beine waren immer noch so wacklig, dass sie sich auf dem Weg ins Bad von einem Möbelstück zum nächsten hangeln musste, mit dröhnendem Schädel und leicht verschwommenem Blick, aber sie wusste, dass sie das Schlimmste überstanden hatte.
Sie hatte verzweifelt darum gekämpft, nicht das Bewusstsein zu verlieren, und standhaft alle Mittel verweigert, die Dr. Giordano ihr gegen die Schmerzen oder für einen ruhigeren Schlaf geben wollte. Obwohl sie auf ihrer Fahrt hierher, offenbar der Familiensitz der Nervis, in Ohnmacht gefallen war, hatte sie sich keine Medikamente geben lassen, die ihren Verstand trübten. Sie sprach zwar exzellent Französisch, aber es war nicht ihre Muttersprache; wenn sie unter starken Beruhigungsmitteln stand, konnten ihr unversehens ein paar englische Wörter mit amerikanischem Akzent entschlüpfen. Darum hatte sie vorgegeben, sie hätte Angst, im Schlaf zu sterben, und außerdem das Gefühl, dass sie das Gift besser bekämpfen könnte, wenn sie bei Sinnen war, und obwohl Dr. Giordano wusste, dass das aus medizinischer Sicht unsinnig war, hatte er sich ihren Wünschen gebeugt. Manchmal, hatte er erklärt, sei die geistige Verfassung eines Patienten entscheidender für seine Erholung als die körperliche. Dass ihr anfangs immer wieder die Augen zugefallen waren, hatte sich als Glücksfall erwiesen, denn er hatte deshalb darauf verzichtet, ihre Pupillen zu untersuchen, wobei ihm mit Sicherheit die Kontaktlinsen aufgefallen wären.
Als sie sich langsam und unter Aufbietung aller Kräfte aus dem verschwenderisch ausgestatteten Bad in ihr Zimmer zurückkämpfte, saß Rodrigo bereits auf dem Stuhl neben dem Bett und wartete auf sie. Er war vom Rollkragenpullover bis zu den Schuhen in Schwarz gekleidet und wirkte in dem weiß und eierschalengelb eingerichteten Zimmer wie ein düsteres Omen.
Sofort wechselten alle ihre Instinkte auf eine höhere Alarmstufe. Rodrigo würde sich nicht so leicht manipulieren lassen wie Salvatore. Zum einen war Salvatore zwar gerissen gewesen, aber sein Sohn war schlauer, härter, verschlagener – und das wollte einiges heißen –, zum anderen hatte Salvatore einen Narren an ihr gefressen und Rodrigo nicht. Für den Vater war sie eine junge Frau gewesen, eine Eroberung, aber sie war drei Jahre älter als Rodrigo, der stets genug zu erobern gehabt hatte.
Sie trug ihren eigenen Pyjama, den man ihr gestern aus ihrer Wohnung geholt hatte, aber sie war dankbar für den zusätzlichen Schutz des dicken türkischen Morgenmantels, der an einem Haken im Bad gehangen hatte. Rodrigo gehörte zu jenen aggressiv erotischen Männern, deren Ausstrahlung sich keine Frau entziehen kann, und sie war durchaus empfänglich für diese Facette seiner Persönlichkeit, obwohl sie eigentlich genug über ihn wusste, um sich innerlich vor Abscheu zu schütteln. Er war an den meisten Sünden Salvatores nicht unschuldig, obwohl er tatsächlich unschuldig an den Morden war, die sie auf ihren Rachefeldzug getrieben hatten; zu jener Zeit hatte sich Rodrigo zufällig in Südamerika aufgehalten.
Sie kämpfte sich zum Bett vor, ließ sich auf die Matratze sinken und klammerte sich an einem Bettpfosten fest, um nicht umzukippen. Dann schluckte sie und sagte: »Sie haben mir das Leben gerettet.« Ihre Stimme war dünn und schwach. Sie war dünn und schwach und eindeutig nicht in der Lage, sich zu verteidigen.
Er zuckte die Achseln. »Das war ich nicht. Vincenzo – Dr. Giordano – sagt, er hätte Ihnen sowieso nicht helfen können. Sie haben sich von ganz allein erholt, aber Sie haben einen Schaden davongetragen. Eine Herzklappe, sagte er, wenn ich mich recht erinnere.«
Das wusste sie bereits, weil Dr. Giordano ihr am Morgen das Gleiche gesagt hatte. Sie hatte gewusst, was ihr passieren konnte, als sie diesen Plan gefasst hatte.
»Ihre Leber wird sich hingegen erholen. Sie sehen schon viel besser aus.«
»Niemand hat mir erklären können, was eigentlich passiert ist. Woher wussten Sie, dass ich krank war? War Salvatore auch krank?«
»Ja«, bestätigte er. »Er hat sich nicht wieder erholt.«
Ganz offensichtlich wurde eine andere Reaktion als »Na endlich« von ihr erwartet, darum dachte Lily mit aller Kraft an Averill und Tina und vor allem an die pubertär schlaksige Zia mit ihrem offenen, fröhlichen Gesicht und dem ununterbrochenen Geschnatter. Oh Gott, wie vermisste sie Zia; der Schmerz saß genau in ihrem Herzen. Tränen traten ihr in die Augen, und sie ließ sie über ihre Wangen rinnen.
»Es war Gift«, sagte Rodrigo mit so gelassener Miene und Stimme, als spräche er über das Wetter. Sie ließ sich nicht irreführen; bestimmt zerfraß ihn der Zorn. »In der Weinflasche des Restaurants. Es scheint ein synthetisches, sehr wirksames Designergift zu sein; wenn die ersten Symptome auftreten, ist es bereits zu spät. Monsieur Durand aus dem Restaurant sagte, Sie hätten von dem Wein gekostet.«
»Ja, einen Schluck.« Sie wischte die Tränen von ihren Wangen. »Ich mag keinen Wein, aber Salvatore gab keine Ruhe und wurde wütend, weil ich nicht probieren wollte, darum kostete ich ... aber nur einen kleinen Schluck, ihm zuliebe. Es schmeckte widerlich.«
»Sie haben Glück gehabt. Vincenzo sagt, das Gift ist so wirksam, dass Sie jetzt tot wären, wenn Sie mehr getrunken hätten oder der Schluck nicht ganz so klein gewesen wäre.«
Sie schauderte, weil sie an die Schmerzen und die Übelkeit denken musste; das Gift hatte sie krank gemacht, obwohl sie den Wein gar nicht getrunken, sondern nur ihre Lippen damit benetzt hatte. »Wer hat das getan? Jeder hätte diesen Wein trinken können; war es ein Terrorist, dem es egal war, wen er umbringen würde?«
»Ich glaube, der Täter hatte es durchaus auf meinen Vater abgesehen; dass er Weinliebhaber war, war überall bekannt. Der zweiundachtziger Château Maximilien ist sehr selten, und doch bekam Monsieur Durand auf mysteriöse Weise eine Flasche angeboten, und zwar genau einen Tag, bevor mein Vater einen Tisch in seinem Restaurant reserviert hatte.«
»Aber er hätte diesen Wein doch auch jedem anderen Gast anbieten können.«
»Und damit das Risiko eingehen, dass mein Vater davon erfährt und wütend wird, weil dieser seltene Wein nicht ihm angeboten wurde? Ich glaube nicht. Das sagt mir, dass der Attentäter sehr vertraut mit Monsieur Durand und seinem Restaurant und seinen Gästen ist.«
»Und wie soll er das bewerkstelligt haben? Die Flasche wurde vor unseren Augen entkorkt. Wie soll er den Wein vergiftet haben?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass das Gift mithilfe einer sehr dünnen Nadel durch den Korken injiziert wurde. Das hätte niemand bemerkt. Oder die Flasche wurde erst geöffnet und anschließend wieder verkorkt, wozu nur das geeignete Werkzeug nötig gewesen wäre. Monsieur Durand schätzt sich überglücklich, weil ich weder ihn noch den Ober, der Sie bedient hat, für schuldig halte.«
Lily saß inzwischen schon so lange, dass sie vor Schwäche zitterte. Rodrigo bemerkte das leise Zittern, das ihren Körper überlief. »Sie können hierbleiben, bis Sie sich wieder erholt haben«, bot er ihr höflich an und erhob sich. »Falls Sie irgendetwas brauchen sollten, dann lassen Sie es mich wissen.«
»Vielen Dank«, sagte sie und rang sich dann zur größten Lüge ihres Lebens durch: »Rodrigo, das mit Salvatore tut mir so unendlich leid. Er war so ... so ...« Ein gewissenloser, über Leichen gehender Hurensohn, aber jetzt war er ein toter gewissenloser, über Leichen gehender Hurensohn. Sie rang sich eine letzte Träne ab, indem sie an Zias kleines Gesicht dachte.
»Vielen Dank für Ihr Mitgefühl«, sagte er ausdruckslos und ging aus dem Raum.
Sie führte keinen Freudentanz auf; dazu war sie zu schwach, und sie konnte nicht sicher sein, dass es im Zimmer keine versteckten Kameras gab. Stattdessen kletterte sie in ihr Bett zurück und suchte Zuflucht in einem kräftigenden Schlaf, doch sie war zu euphorisch und konnte nur dösen.
Den ersten Teil ihrer Mission hatte sie erfüllt. Jetzt musste sie sich nur noch in Luft auflösen, ehe Rodrigo entdeckte, dass es keine Denise Morel gab.
3
Zwei Tage später stand Rodrigo neben seinem jüngeren Bruder Damone am Grab ihrer Eltern in ihrer italienischen Heimat. Ihre Mutter und ihr Vater waren im Tod wieder vereint, so wie sie es im Leben gewesen waren. Salvatores Grab war mit Kränzen überhäuft, aber Rodrigo und Damone hatten gemeinsam einige Gestecke aussortiert und sie auf dem Grab ihrer Mutter platziert.
Es war kühl, aber sonnig, und ein leichter Wind wehte. Damone schob die Hände in die Taschen und blickte, das markante Gesicht von Gram gezeichnet, in den blauen Himmel. »Was wirst du jetzt machen?«, fragte er.
»Denjenigen finden, der das getan hat, und ihn umbringen«, antwortete Rodrigo, ohne zu zögern. Gemeinsam drehten sie sich um und gingen von der Grabstätte weg. »Außerdem werde ich eine Pressemitteilung über Papas Tod herausgeben; länger lässt es sich nicht geheim halten. Die Nachricht wird einige Leute nervös machen, man wird sich fragen, wie es um diverse Abmachungen steht, nachdem ich die Geschäfte übernommen habe, deshalb werde ich mich zuerst mit unseren Partnern befassen müssen. Unter Umständen werden uns Einkünfte verloren gehen, aber nicht so viele, dass wir es nicht verschmerzen könnten. Außerdem werden die Verluste zeitlich begrenzt sein, und die Einkünfte durch den Impfstoff werden sie mehr als ausgleichen. Deutlich mehr sogar.«
Damone fragte: »Vincenzo konnte die verlorene Zeit wieder hereinarbeiten?« Weil sein Geschäftssinn noch ausgeprägter war als Rodrigos, verwaltete er von seinem Wohnsitz in der Schweiz aus die Mehrheit ihrer Finanzen.
»Nicht ganz, aber die Arbeit macht Fortschritte. Er hat mir versichert, dass er bis nächsten Sommer fertig ist.«
»Dann geht es besser voran, als ich angenommen hatte, wenn man bedenkt, wie viel ihm verloren gegangen ist.« Ein Zwischenfall in Vincenzos Labor hatte sein derzeitiges Forschungsprojekt weit zurückgeworfen.
»Er und seine Leute arbeiten praktisch rund um die Uhr.« Und würden noch länger arbeiten, falls Rodrigo feststellen sollte, dass sie in Verzug gerieten. Das Impfserum war zu wichtig, als dass Vincenzo den Einführungstermin platzen lassen durfte.
»Halte mich auf dem Laufenden«, bat Damone. Sie hatten vereinbart, dass sie sich sicherheitshalber nicht mehr sehen würden, bis der Attentäter identifiziert und ausgeschaltet war. Er drehte sich noch einmal um und blickte auf das frische Grab, und in seinen dunklen Augen stand der gleiche Kummer und Zorn, der auch Rodrigo peinigte. »Ich kann es immer noch nicht glauben«, sagte er fast unhörbar.
»Ich weiß.« Die beiden Brüder umarmten sich, ohne sich ihrer Gefühle zu schämen, und stiegen dann in verschiedene Autos, um getrennt zu ihrem Privatflughafen zurückzufahren, von wo aus jeder in einem eigenen Firmenflugzeug nach Hause fliegen würde. Rodrigo hatte aus dem Treffen mit seinem jüngeren Bruder, aus dem Zusammensein mit seinem einzigen noch lebenden Angehörigen, neue Kraft geschöpft. Obwohl sie aus einem so traurigen Anlass zusammengekommen waren, hatte ihnen die brüderliche Nähe Trost gespendet. Jetzt kehrten beide in ihre miteinander verwobenen und gleichzeitig eigenständigen Imperien zurück, Damone, um ihre Gelder zu mehren, Rodrigo, um ihren ermordeten Vater zu rächen. Rodrigo wusste genau, dass Damone ihn bei allen Schritten, zu denen er sich entschloss, unterstützen würde.
Trotzdem war nicht daran zu rütteln, dass er auf der Suche nach dem Mörder seines Vaters noch keinen Millimeter vorangekommen war. Vincenzo war immer noch damit beschäftigt, das Gift zu analysieren, weil ihnen das Aufschluss über seine Herkunft geben könnte, während Rodrigo seine Rivalen im Auge behalten hatte, ob sich einer von ihren irgendwie anders verhielt als sonst und dadurch erkennen ließ, dass er von Salvatores Tod wusste. Man hätte meinen können, dass ihre weniger gesetzestreuen Geschäftspartner am ehesten zu einem Mord fähig waren, aber Rodrigo nahm niemanden von seinem Verdacht aus. Möglicherweise steckte sogar jemand aus ihrer eigenen Organisation oder jemand aus der Regierung hinter dem Attentat. Salvatore hatte von vielen Tellern genascht, und ganz offenbar war jemand gierig geworden und hatte seinen Teller lieber für sich allein haben wollen. Rodrigo musste nur noch herausfinden, wer das war.
»Bring Mademoiselle Morel nach Hause«, befahl Rodrigo seinem Fahrer Tadeo, nachdem sie eine Woche bei ihm gewesen war. Inzwischen konnte sie sich besser auf den Beinen halten, und obwohl sie so gut wie nie aus ihrem Zimmer kam, war ihm nicht wohl dabei, eine Fremde unter seinem Dach zu beherbergen. Schließlich war er immer noch damit beschäftigt, seine Position zu festigen – leider hatten einige Leute gemeint, er könne seinem Vater nicht das Wasser reichen, und sich deshalb berufen gefühlt, Rodrigos Autorität anzuzweifeln, woraufhin er sich berufen gefühlt hatte, ihre Zweifel unwiderruflich auszuräumen – und es geschahen Dinge, die kein Fremder mitbekommen sollte. Er würde sich besser fühlen, wenn sein Haus wieder ein sicherer Hafen war.
Es dauerte nur wenige Minuten, bis der Wagen vorgefahren war und die Frau und ihre wenigen Habseligkeiten eingeladen waren. Nachdem Tadeo mit der Französin abgefahren war, verschwand Rodrigo in Salvatores Arbeitszimmer – jetzt seinem eigenen Arbeitszimmer – und setzte sich hinter den ausladenden, reich gedrechselten Schreibtisch, den Salvatore so geliebt hatte. Vor ihm lag Vincenzos Bericht über das Gift, das er aus dem Bodensatz der aus der Altglastonne geborgenen Weinflasche extrahiert hatte. Rodrigo hatte den Bericht kurz überflogen, als er ihn vorgefunden hatte, aber jetzt nahm er ihn noch einmal in die Hand und studierte ihn gründlich und in allen Einzelheiten.
Vincenzo zufolge handelte es sich um ein synthetisch erzeugtes Gift. Es zeigte typische Merkmale des Orellanin-Giftes, das im Orangefuchsigen Raukopfpilz vorkam, weshalb der Arzt anfänglich auf eine Pilzvergiftung getippt hatte. Das Orellanin griff verschiedene innere Organe gleichzeitig an, vor allem Leber, Nieren, Herz und Nervensystem, und war berüchtigt für seine verzögerte Wirkung. Meist zeigten sich erst nach zehn oder noch mehr Stunden die ersten Symptome, danach schien sich das Opfer wieder zu erholen, bevor es, oft Monate später, elend zugrunde ging. Es war kein Heilmittel oder Gegengift gegen Orellanin bekannt. Das verwendete Gift hatte außerdem charakteristische Eigenschaften des Minoxidil gezeigt, das Herzrasen, Herzstillstand, Bluthochdruck und Atemlähmung auslöste – wodurch mit tödlicher Sicherheit verhindert wurde, dass sich das Opfer von dem Orellanin-ähnlichen Gift erholen konnte. Minoxidil wirkte schnell, Orellanin langsam; irgendwie waren die beiden Komponenten so vermischt worden, dass die Wirkung verzögert eintrat, allerdings nur um ein paar Stunden.
Vincenzo zufolge gab es weltweit nur eine Handvoll Chemiker, die zu einer solchen Synthese fähig waren, und keiner davon arbeitete in Industrie und Forschung. Aufgrund ihrer Spezialisierung waren sie sehr teuer und schwierig zu kontaktieren. Dieses besondere Gift in so hoher Konzentration herzustellen, dass es einen siebzig Kilo schweren Mann – oder eine genauso schwere Frau – töten konnte, würde ein kleines Vermögen kosten.
Rodrigo legte die Fingerspitzen aneinander und tippte gedankenversunken gegen seine Lippen. Die Vernunft sagte ihm, dass der Killer höchstwahrscheinlich von einem Geschäftsrivalen beauftragt worden war oder dass sich jemand für ein erlittenes Leid rächen wollte, aber sein Instinkt verwies ihn immer wieder zu Denise Morel zurück. Etwas an ihr ließ ihm einfach keine Ruhe. Er konnte nicht genau sagen, was ihm solches Unbehagen bereitete; bislang hatten seine Nachforschungen ergeben, dass sie genau die Frau war, die sie zu sein behauptete. Außerdem war auch sie vergiftet worden und wäre um ein Haar gestorben, was bei logischer Betrachtung mehr oder weniger bewies, dass sie nicht schuldig war. Und sie hatte geweint, als er ihr von Salvatores Tod erzählt hatte.
Nichts deutete auf sie hin. Der Ober, der den Wein serviert hatte, war da schon viel verdächtiger, aber selbst die ausführlichste Befragung von M. Durand und seinem Ober hatte Rodrigo nur die Auskunft eingetragen, dass M. Durand die Flasche persönlich an den Ober übergeben hatte, der sie dann unter den Augen seines Chefs ohne jeden Umweg an Salvatores Tisch gebracht hatte. Nein, zuallererst musste Rodrigo herausfinden, wer M. Durand darauf aufmerksam gemacht hatte, dass dieser Wein zu kaufen war, und bis jetzt hatte er noch keine Spur von dieser Person entdecken können. Die Flasche war von einem Unternehmen erworben worden, das gar nicht existierte.
Demzufolge war der Mörder ziemlich erfahren in seinem Geschäft, sonst hätte er weder das Gift noch den Wein beschaffen können. Er – Rodrigo bezeichnete ihn der Einfachheit halber als »Er«, obwohl es sich auch um eine Frau handeln konnte – hatte sich genau über sein Opfer und dessen Angewohnheiten kundig gemacht; er hatte gewusst, dass Salvatore oft in diesem Restaurant verkehrte, er hatte gewusst, dass er an jenem Abend einen Tisch reserviert hatte, und er hatte mit einiger Sicherheit gewusst, dass M. Durand diese Flasche Wein für seinen wichtigsten Gast zurückhalten würde. Der Mörder war obendrein in der Lage gewesen, kurzfristig eine Scheinfirma ins Leben zu rufen. All das ließ einen Grad an Professionalität erkennen, der praktisch »Konkurrent« schrie.
Trotzdem konnte er nicht ausschließen, dass Denise damit zu tun hatte.