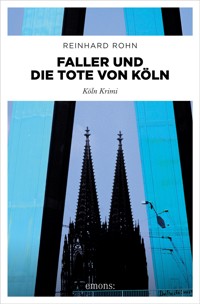9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lena Larcher ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sie hat alles verloren. Jetzt kämpft sie ums Überleben.
Ein Jahr ist vergangen, seit Hauptkommissarin Lena Larcher Mann und Sohn bei einem Autounfall verloren hat. Nur mühsam kämpft sie sich zurück ins Leben und in den Beruf. In einer Trauerbewältigungsgruppe begegnet sie einem Mann, der ihr Interesse weckt. Doch kurz darauf wird dieser tot in einem heruntergekommenen Hotel in Köln aufgefunden. Lena ist die Einzige, die nicht an einen Selbstmord glaubt. Beharrlich verfolgt sie eine gefährliche Spur und erkennt zu spät, dass sie in eine Falle gelockt wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Sie alles verloren. Jetzt kämpft sie ums Überleben.
Ein Jahr ist vergangen, seit Hauptkommissarin Lena Larcher Mann und Sohn bei einem Autounfall verloren hat. Nur mühsam kämpft sie sich zurück ins Leben und in den Beruf. In einer Trauerbewältigungsgruppe begegnet sie einem Mann, der ihr Interesse weckt. Doch kurz darauf wird dieser tot in einem heruntergekommenen Hotel in Köln aufgefunden. Lena ist die Einzige, die nicht an einen Selbstmord glaubt.
Beharrlich verfolgt sie eine gefährliche Spur und erkennt zu spät, dass sie in eine Falle gelockt wird …
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Morgen stirbst du
Kriminalroman
»Willst du recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht.«
Marshall Rosenberg
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Epilog
Nachbemerkung
Impressum
Kapitel 1
Als sie für einen Moment die Augen schloss, sah sie Vögel – eine Menge schwarzer Krähen, die sich auf einem kargen Feld niedergelassen hatten und sich in die Lüfte erhoben – eine dunkle Wolke, die sich formierte. Wieso dachte sie an Krähen? Am Morgen hatte ein Vogel vor ihrem Fenster gesessen und sie angestarrt.
Helen, eine zarte Frau mit blonden, künstlichen Locken, sprach weiter von ihrem Kind, dass es behindert auf die Welt gekommen und vor drei Wochen in ihren Armen gestorben sei. »Er hat mich angeschaut, mit ganz leerem Blick, fragend, ängstlich. Mein Herz hat sich zusammengezogen, dann fing er an zu krampfen. Die Zunge fiel ihm aus dem Mund, sein Gesicht war ganz fahl. Erst da habe ich begriffen, dass Kasper, mein kleiner Liebling, sterben würde …«
Helen schluchzte. Die anderen in der Runde sagten kein Wort – sechs Frauen und zwei Männer.
Die Namen der Männer kannte Lena nicht.
Silvana Roth, die Psychologin, blickte in die Runde, mit hochgezogenen Augenbrauen, um zu erkunden, ob jemand etwas zu Helen sagen wollte, ein Trostwort, eine Anregung, doch niemand ging darauf ein.
Lena war froh, dass sie heute nicht an der Reihe war. Bei ihrem zweiten Besuch hatte Silvana sie aufgefordert zu sprechen – von Robert und Simon und dem Autounfall, bei dem ihr Mann und ihr Sohn ums Leben gekommen waren und den sie verschuldet hatte. Eine Stunde hatte sie geredet, danach war sie völlig leer und ausgelaugt gewesen. Hinterher, als sie am Stadtgarten vorbei nach Hause lief, hatte sie gehofft, dass niemand im Präsidium davon erfahren würde, dass sie in eine Selbsthilfegruppe ging. Wie das schon klang! Nach sinnlosem Gerede, nach Hilflosigkeit, schlaflosen Nächten … Aber es stimmte ja, sie schlief schon lange nicht mehr länger als drei, vier Stunden in der Nacht.
Sie schloss wieder die Augen. Sofort kehrten die Krähen zurück. Eine einsame Krähe zog am Himmel entlang, scheinbar orientierungslos. Das bin ich, dachte sie. Ich bin eine Krähe, die sich immer weiter von den anderen entfernt.
»Helen«, sagte Silvana mit ihrer sanften, einfühlsamen Psychologenstimme, »ich danke dir für deine Offenheit. Wir wissen alle, dass es nicht einfach für dich ist, aber Offenheit ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Heilung – nicht im Sinne von Verdrängung, falls du verstehst.« Es gehörte zu Silvanas Methode, jeden in der Gruppe zu duzen, um so ein Gefühl der Nähe und des Vertrauens zu schaffen.
Helen schluchzte, und Lena öffnete ihre Augen wieder.
Die beiden Männer hatten sich schon erhoben, sie hatten kein Wort gesagt, der eine hatte einen dichten schwarzen Bart und war ziemlich korpulent, er hatte fast ununterbrochen auf seine Hände geschaut, der andere war höchstens Mitte zwanzig und hatte schon beinahe eine Glatze, ein schmaler, schüchterner Jüngling. Eilig, nachdem sie Silvana zum Abschied zugenickt hatten, steuerten sie auf die Tür zu.
Finn war nicht gekommen. Lena nahm ihre Jacke und streifte sie über. Sie war neugierig gewesen, ob er wieder versuchen würde, sie einzuladen. Nur in einem weißen, verwaschenen T-Shirt, schwarzen Jeans und einem dünnen Mantel hatte er bei ihrem letzten Treffen vor einer Woche dagesessen und von seinem Sohn erzählt, einem Säugling, der am plötzlichen Kindstod gestorben war. Er hatte fast druckreif gesprochen, langsam und zögerlich zwar, aber wohlüberlegt. Von einer Frau war nicht die Rede gewesen – so als wäre er mit seinem Sohn ganz allein auf der Welt gewesen. Finn mochte Mitte vierzig sein. Ein Künstler, hatte sie gedacht, Fotograf, Regisseur, etwas in der Art, jedenfalls niemand, der in irgendein Büro ging und einen langweiligen Job hatte.
Als hätte er auf sie gewartet, hatte er auf einer Bank im nahen Stadtgarten gesessen und sie herausfordernd angeschaut.
»Ich habe zu viel geredet«, hatte er gesagt. »Nun brauche ich Gesellschaft. Wollen wir etwas trinken gehen?«
Sie hatte abgelehnt, sie wollte nicht in das Stadtgartenrestaurant, stattdessen waren sie auf der Bank sitzen geblieben, obwohl es recht kalt war, und er hatte ihr verraten, dass er Journalist sei, dass er ein Buch schreibe – über eine große Sache, die Aufsehen erregen werde.
Er hatte sie zum Lachen gebracht, und für einen kurzen Moment, als sie sich verabschiedeten, hatte sie das Gefühl gehabt, er werde sie gleich fragen, ob er mit ihr kommen könne.
Nun war er zu seinem zweiten Treffen nicht erschienen. Wenn sie ehrlich war, war sie ein wenig enttäuscht.
Sie war die Letzte im Raum. Silvana ordnete Papiere und winkte ihr zu.
»Dreimal treffen wir uns noch vor Weihnachten«, sagte sie. »Ich hoffe, du kannst es einrichten.«
Lena nickte, spürte jedoch, wie ein scharfer Schmerz ihr durch die linke Schläfe fuhr. Die Kopfschmerzen waren wieder schlimmer geworden. Manchmal glaubte sie, blind zu werden vor Schmerzen. Deshalb hatte sie auch Silvanas Angebot angenommen, an ihrer Gruppe teilzunehmen.
Heute war der 27. November. Allmählich musste sie sich Gedanken machen. Weihnachten dürfte sie nicht in Köln verbringen – auf keinen Fall. Sie würde irgendwo hinfliegen, in die Karibik, nach Florida, ganz egal, wohin.
Sie ging die Venloer Straße hinauf und bog dann am Stadtgarten ab. Es war Freitagabend, halb zehn, sie hatte ein langes, dienstfreies Wochenende vor sich und fühlte sich hin- und hergerissen – einerseits war sie froh, nicht ins Präsidium zu müssen, andererseits hatte sie keine Pläne. Sie könnte aufräumen, Wäsche waschen, mit dem Fahrrad am Rhein entlangfahren, sich etwas kochen – oder sie würde endlich einmal die Wohnungsangebote im Internet studieren. Die Wohnung war zu groß und zu teuer für sie alleine.
Ein Mann stand am Eingang zum Stadtgarten und schaute sie an. Er trug einen Hut und einen langen dunklen Mantel und rauchte. Sie dachte an Finn. Hatte er geraucht? Ja, das hatte er. Sie kannte nicht einmal seinen Nachnamen.
Dann setzte der Mann sich in Bewegung, überquerte die Straße und kam auf sie zu. Er hob die Hand, in der er die Zigarette hielt.
Sie spürte, wie ihr Herz zu klopfen begann. Es war nicht Finn. Wie kam sie überhaupt auf diesen Gedanken? David Bauer warf seine Zigarette achtlos weg. Er lächelte.
»Wie schön, dass ich dich treffe«, sagte er und breitete die Arme aus.
Sie schaute ihn misstrauisch an. Hatte er ihr aufgelauert? Wusste er, dass sie eben von einer Gruppentherapie kam?
David küsste sie auf beide Wangen. »Wolltest du auch zum Konzert in den Stadtgarten? Da spielt gleich die Saxophon Mafia – eine tolle Band.« Er gab sich alle Mühe, ihre Begegnung wie einen Zufall aussehen zu lassen.
»Nein«, sagte sie, »ich bin nur spazieren gegangen. Wollte noch ein wenig an die frische Luft. Ich hatte Kopfschmerzen – Migräne.« Der letzte Satz war ein Fehler, sie bemerkte es sofort.
David nahm sie am Arm, als wäre sie eine Greisin. »Wir können auch irgendwo einen Wein trinken, wenn du magst.«
Eine Zeit lang war er der wichtigste Mann in ihrem Leben gewesen – der erste Junge, mit dem sie geschlafen hatte. Fünfzehn war sie gewesen, er war achtzehn und der Star der Schule. Alle Mädchen hatten sie beneidet. Nun war er Staatsanwalt, kinderlos und unglücklich verheiratet, und er war Roberts bester Freund gewesen.
Sie gingen in ein Café am Westbahnhof. Er werde den Anfang des Konzerts verpassen, aber das mache ihm nichts aus.
»Es gefällt mir«, sagte er, nachdem er zwei Gläser Rotwein bestellt hatte, »dass du wieder im Präsidium Fuß gefasst hast. Ich meine …« Er zögerte. »Du bist die beste Ermittlerin … besser als all die Männer, die immer auf dicke Hose machen.«
Lena schaute ihn über den Rand ihres Glases an. Sie suchte in seinem hageren Gesicht den Jungen zu entdecken, in den sie sich einmal verliebt hatte. Er war stets leicht gebräunt gewesen, mit langen zurückgekämmten Haaren, in denen immer der Wind zu spielen schien. Ihm fällt alles zu, hatte sie damals gedacht, wo andere sich anstrengen müssen, um etwas zu begreifen, ist er schon einen Schritt weiter. Nun wirkte er angestrengt, sein Haar trug er fast genauso lang wie einst, und seine Hände waren noch immer zart und flink.
»Könntest du dir vorstellen«, sagte er plötzlich in einem anderen Tonfall, hektischer, energischer, »dass wir uns wieder häufiger sehen? Ich habe Hiltrud verlassen. Wir konnten nicht mehr miteinander reden, konnten uns nicht einmal mehr riechen. Verstehst du?«
Fast hätte sie gelacht. Was sollte das jetzt – ein Geständnis, dass er wieder allein war, dass er eine Frau suchte?
»Ich weiß nicht …«, sagte sie vage. Ihr Smartphone klingelte. Henning Mahns Nummer leuchtete auf, ihr Kollege, der vermutlich allein in seiner schäbigen Zwei-Zimmer-Wohnung in Ehrenfeld saß und sich langweilte. Seit er seine Spielsucht bekämpfte, rief er abends manchmal an, um sie zu einem Kinobesuch zu überreden.
Die Welt schien voll von einsamen älteren Männern zu sein.
»Lena«, sagte Mahn. »Es gibt Arbeit. Ein Toter in einem Hotel, scheint ein Suizid zu sein. Wo kann ich dich abholen?«
Kapitel 2
Montag, 16. November
Der Hass überfiel ihn, als der Sarg aus der winzigen Kapelle getragen wurde. Da stand er, der Mann, der seine Ehe zerstört hatte, er stand da, rotgesichtig, aufgeschwemmt, ein Alkoholiker, und am liebsten hätte er eine Waffe gezogen und ihm eine Kugel in den Schädel gejagt, genau zwischen die Augen.
Kuhn wandte sich ab, als er an ihm vorbeiging. So war es schon früher gewesen, dass er keinem Blick standhielt, dass er sich klein machte, obwohl er mit fast ein Meter neunzig viel größer war, als es schien.
Als der Sarg in die Erde herabgelassen wurde, spürte er, dass ihm ein Schluchzen entfuhr; es war ein fremder Laut, den er so noch nicht gehört hatte und der ihn erschreckte. Er trauerte um Linda, er tat es wirklich, obwohl sie ihn betrogen hatte, mit Kuhn, mit anderen.
Dann baute er sich neben dem Grab auf, als wäre er wahrhaftig der Witwer, als wären Linda und er noch ein Paar gewesen. Berit trat auf ihn zu, Lindas älteste Freundin. Stumm drückte sie ihm die Hand, kein bisschen verwundert, dass er hier aufgetaucht war. Dann kamen Reimerts, ihre alten Nachbarn, Fischers, Möllns. Die halbe Straße hatte sich versammelt. Er hatte sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, seit dem Tag, als er ausgezogen war. Er schüttelte Hände, die Gesichter verschwammen vor seinen Augen. Lindas Kolleginnen aus der Redaktion, ältlich gewordene, verhärmte Feministinnen, die er nie hatte leiden können. Auch Heinz, Lindas Onkel, war gekommen, der ehemals stolze Banker, nun ein alter gebeugter Mann, der an einem Stock dahinkroch, eine junge Frau, wahrscheinlich seine Pflegerin, neben ihm. Er mochte sich wundern, dass kein Priester die Zeremonie geleitet hatte, sondern ein profaner Trauerredner, den der Bestatter engagiert hatte.
Zuletzt trat Kuhn an das Grab. Er hatte sich einen Kinnbart wachsen lassen, der lächerlich aussah. Er blickte an ihm vorbei, reichte ihm nicht die Hand. Sein aufgeschwemmtes Gesicht war voller Tränen. »Na, mimst du den traurigen Witwer?«, zischte er ihm zu.
Er hätte ihn am liebsten ins Gesicht geschlagen. »Sie war meine Frau«, sagte er, »immer noch. Bist du an dem Unfall schuld? Habt ihr euch gestritten?«
»Halt’s Maul«, sagte Kuhn voller Hass. »Was weißt du schon? Verschwinde!« Er starrte in das dunkle Grab und fingerte an einem weißen Taschentuch herum.
Eine Glocke erklang. Der Bestatter wandte sich dem Grab zu. Gleich würde man es mit schwarzer Erde schließen und es mit den Kränzen aus der Kapelle schmücken.
Linda war mit ihrem Golf auf gerader Strecke von der Straße abgekommen – irgendwann in der Nacht in der tiefsten Eifel. Vielleicht hatte sie noch gelebt, aber erst nach Stunden, im Morgengrauen, hatte man sie gefunden. Er mochte sich gar nicht vorstellen, ob sie gelitten hatte.
Kuhn wandte sich ab. Ein Weinkrampf schüttelte ihn. Auch dessen Frau entdeckte er nun, ein fahles, unscheinbares Wesen mit dünnen grauen Haaren, das offenbar alles ertrug, was ihm widerfuhr.
»Ich gehe in das Haus zurück«, sagte er. »Alles, was ich von dir finde, werde ich auf den Müll werfen.« Dann verließ er den Friedhof.
Erst im Auto, während er sich eine Zigarette ansteckte, begriff er, was er gesagt hatte. Er würde ins Haus zurückkehren. Ja, warum nicht? Wieso sollte er seine winzige Wohnung mit dem einen Dachfenster in der Mainzer Straße nicht aufgeben und wieder in dem Haus leben, das er einmal gebaut hatte? Köln-Fühlingen, eine ehrbare, grundsolide Adresse. Das Haus gehörte nun ihm allein. Schließlich waren Linda und er auf dem Papier noch immer verheiratet.
Wie glücklich waren sie gewesen, als sie dort eingezogen waren. Dreizehn Jahre war das her – sie hatten ihr Leben noch vor sich gehabt, zwei erfolgreiche dreißigjährige Journalisten in einem schneeweißen Haus mit riesigen Fenstern und einem Garten, in dem ein mächtiger Kirschbaum stand, der im Frühling voller Blüten war. Auf dem nackten Holzboden hatten sie sich in der ersten Nacht im Haus geliebt, er konnte den Geruch des Öls noch wahrnehmen, wenn er die Augen schloss. Lindas blonde Haare an seiner Schulter, ihr Atmen an seinem Ohr, ihr melodisches Summen … sie keuchte nicht, wenn sie einen Orgasmus hatte, sie summte, summte ein wirres, chaotisches Lied.
Er verlor sich in Erinnerungen. Nun war Linda tot. Die Affäre mit Kuhn, der sich nicht entscheiden konnte, ob er sie liebte oder bei seiner grauhaarigen, unscheinbaren Frau bleiben sollte, hatte sie getötet. Auch dafür hatte Kuhn eine Kugel zwischen die Augen verdient.
Er beobachtete, wie die kleine Trauergemeinde den Friedhof verließ. Nun hatte Kuhn die Führung übernommen, allein, ohne seine Frau, ging er voran. Er würde alle in den Gasthof an der Neußer Straße einladen, die halbe Straße und Lindas Freundinnen und Kolleginnen – Kuhn wusste, was sich gehörte. Er war schließlich Professor – Pädagoge und Professor. Gab es etwas Schlimmeres?
Rauchend blickte er ihnen nach, wie sie die Straße hinaufgingen. Manchmal in der letzten Zeit war er so voller Wut, dass er sich vorstellte, mit Handgranaten um sich zu werfen – hinein in laute, pöbelnde Menschenmengen.
Er war nicht mehr mit sich im Reinen, seit er Linda verlassen hatte – oder sie ihn.
Es war elf Uhr am Vormittag, ein trüber Montag im November. Er sollte in die Redaktion fahren, an seiner Serie über die Brücken von Köln arbeiten, doch zuvor würde er sich ein Frühstück im Café Central gönnen.
Seine Frau war tot. Den Gedanken konnte er immer noch nicht begreifen. Er hatte erst gestern Abend, kaum zwei Tage nach ihrem Unfall, davon erfahren.
Noldens Nummer leuchtete auf dem Display seines Smartphones auf.
Niemand beim ›Express‹ wusste, dass seine Frau ums Leben gekommen war.
Lustlos meldete er sich. Wenn Nolden jemanden vor zwölf Uhr mittags anrief, bedeutete es für gewöhnlich, dass Ärger ins Haus stand.
Vor zwei Tagen hatte er einen Artikel über einen ehemaligen Fernsehmoderator verfasst, der nun jeden Tag in sein leeres Studio fuhr und sich alte Sendungen anschaute, Quizshows mit Prominenten, die er einmal moderiert hatte. Teffy hatte er sich genannt, ein lächerlicher Name, der nun, da er vollkommen erfolglos war, noch lächerlicher anmutete. Bis hinauf zum Verleger hatte Teffy sich beschwert und eine Klage wegen Rufschädigung angekündigt.
»Wo bist du?«, fragte Nolden ohne jede Begrüßung. »Sitzt du noch im Central?«
»Ja«, log er. »Ich bin aber schon auf dem Weg.«
»Nicht nötig«, erwiderte Nolden. »Ich komme. Ich muss mit dir reden.«
Nolden hatte die Figur eines Marathonläufers, obwohl er viel rauchte und Sport verabscheute, ein Windhund, der auch zubeißen konnte. Seit zehn Jahren führte er den ›Express‹, hockte von zehn Uhr morgens bis spät am Abend an seinem Schreibtisch und überwachte die Redaktion. Er hatte eine Frau und zwei Kinder, aber er schien sich nichts aus ihnen zu machen. Nie hatte man ihn mit seiner Familie gesehen.
Das Café Central lag in dem Hotel Chelsea, ein paar Schritte vom Rudolfplatz entfernt. Nolden saß schon da und wischte an seinem iPad herum. Wie die meisten Journalisten war er ein Nachrichtenjunkie.
Er setzte sich. Nolden blickte mürrisch auf. Seine Augen hinter seiner modischen Hornbrille funkelten wütend.
»Tut mir leid«, sagte er. »Hatte noch was zu erledigen. Ist was mit Teffy? Bei wem hat er sich jetzt beschwert? Beim Erzbischof oder beim Oberbürgermeister?« Ein schwacher Scherz.
Nolden griff nach seiner Kaffeetasse. Er trank nur schwarzen Kaffee, jeden Tag mindestens zwei Kannen – eine Journalistenkrankheit. »Teffy geht mir am Arsch vorbei«, sagte er. »Es geht um was anderes – es geht um dich. Ich möchte, dass du Urlaub machst, einen langen Urlaub, ein paar Wochen, irgendwo im Ausland, Karibik, Lanzarote, und danach hast du keinen Schreibtisch mehr in der Redaktion.«
Er brauchte ein paar Momente, um zu begreifen, dass Nolden ihn soeben gefeuert hatte – auf eine für ihn wohl freundliche, geradezu zuvorkommende Art und Weise.
Maria, die junge Kellnerin, kam an den Tisch, sie hatte seinen Milchkaffee, den er hier immer trank, schon dabei. Er nickte ihr lächelnd zu.
Nolden blickte wieder auf sein iPad und schnaufte dann, offenbar unwillig, weil er noch keine Antwort erhalten hatte.
Ich habe vor einer Stunde meine Frau begraben, hätte er beinahe gesagt, und jetzt wirfst du mich raus, nach mehr als zehn Jahren?
»Es geht nicht mehr«, sagte Nolden dann und starrte ihm ins Gesicht. »Du weißt, wie schlecht die Geschäfte laufen. Die Auflage sinkt und sinkt, der Verleger steht mir auf den Füßen und fordert mich auf, die Kosten zu senken, und du hast schon lang nichts Richtiges mehr geliefert. Eine Serie über die Brücken von Köln – mein Gott!« Er hob die Hände und atmete theatralisch ein und aus. »Mit den Fernsehleuten hast du dich verkracht, und zum FC kann ich dich auch nicht schicken.«
»Ich mache keinen Sport mehr«, erwiderte er viel zu leise. »Habe ich dir schon oft gesagt.«
Noldens Telefon dudelte einen Van-Halen-Song. Verächtlich blickte er auf das Display, ohne das Gespräch anzunehmen.
»Du weißt, dass ich an einer ganz großen Geschichte arbeite – das Material bietet Stoff für eine Serie, sechs, sieben Folgen … Das Ganze wird großes Aufsehen erregen. Das schwöre ich dir.« Es war eine Lüge, und er begriff, dass er auch nicht allzu überzeugend klang.
»Ja, über die große Weltverschwörung … Ich weiß. Hast du mir letzte Woche schon erzählt.« Nolden kippte den Rest seines Kaffees hinunter. »Schreib es auf und mach dann ein Buch draus. Vielleicht findest du einen, der es druckt.« Er legte einen Zehneuroschein auf den Tisch und erhob sich.
»Linda«, sagte er nun doch, stockend und mit leiser Stimme. »Sie ist tot. Ist heute begraben worden.«
Nolden hielt einen Moment inne. Er blickte ihn an, ein kurzes Zögern, ein unsicheres Blinzeln, dann sagte er: »Mein herzliches Beileid.«
Maria brachte ihm einen Cognac. Eigentlich trank er nie; nicht einmal, als Berit ihm die Nachricht von Lindas Tod überbracht hatte, hatte er getrunken. Es war sein erstes Glas Cognac seit mehr als acht Jahren.
Sie schaute ihn beinahe fürsorglich an, als sie ihm das Glas hinstellte.
»Wie alt bist du, Maria?«, fragte er, eine Spur zu jovial, als wäre er selbst schon ein älterer Herr.
»Neunzehn«, erwiderte sie, »fast zwanzig.« Sie lächelte, ihre Lippen waren kirschrot, und in ihrem rechten Nasenflügel steckte eine kleine weiße Perle.
»Ich habe heute meine Frau beerdigt«, sagte er und kippte den Cognac hinunter.
»Oh«, erwiderte Maria. Ein ehrliches Erschrecken überzog ihr Gesicht.
Heiß floss der Alkohol seine Kehle hinab. Er sah, wie auf der Straße Noldens weißer Bugatti, sein Angeberauto, vorbeiglitt. Nun fuhr er in die Redaktion zurück und würde gleich verkünden, dass er einen seiner ältesten Reporter entlassen hatte – als Warnung für alle, die glaubten, noch einen sicheren Job zu haben.
Maria griff nach dem leeren Glas vor ihm. Sie hatte schöne Hände mit dunkelrot lackierten Fingernägeln.
»Tut mir wirklich leid«, sagte sie.
Er nickte. Er hätte gerne noch einen Cognac getrunken und dann noch einen und noch einen, bis er in einen betrunkenen Schlaf sinken würde … Aber nein, mehr als einen Cognac sollte er sich nicht gönnen.
»Weißt du, was ich tun werde?«, fragte er, als könnte die junge Kellnerin ihm wirklich eine Antwort geben. »Ich werde ein Buch schreiben – ein Buch über den größten Geheimbund der letzten Jahrzehnte. Kennst du die Bilderberger?«
»Sind das Maler – irgendwelche Künstler?«, fragte Maria und legte ihre Stirn in hübsche kleine Falten.
»Du musst mein Buch lesen«, sagte er. »Dann wirst du es wissen.«
Kapitel 3
Im Radio lief ein Song von Depeche Mode, als Lena einstieg.
Henning Mahn blickte sie sorgenvoll an. »Tut mir leid, wenn ich dich aufgeschreckt habe«, sagte er. »Wird wohl nicht lange dauern. Wir schauen uns den Toten an, und dann hauen wir wieder ab und machen uns noch einen schönen Abend …«
Sie schaltete das Radio aus. ›Enjoy the Silence‹ hatte zu Roberts Lieblingsliedern gehört.
»Alles in Ordnung?«, fragte Henning. Er war unrasiert und trug seine schwarze, abgewetzte Lederjacke. Eigentlich war heute sein freier Tag gewesen.
»Spielst du am Freitagabend nicht mit deiner Band?«, entgegnete Lena. Sie sah, dass David im Café immer noch an ihrem Tisch saß und ihr nachblickte. Er schien es nicht eilig zu haben, zu seinem Konzert zu kommen.
»Heute nicht.« Henning gab Gas und fuhr stadtauswärts. »Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Außerdem habe ich nicht genug geübt. Die Jungs werden schnell wütend, wenn ich mich verspiele.«
»Nicht wohlgefühlt« mochte bedeuten, dass er irgendwo in einer Kneipe in Ehrenfeld an einem Spielautomaten gehockt hatte. Wegen seiner Spielsucht hatte seine Frau ihn vor ein paar Wochen vor die Tür gesetzt.
»Nicht, was du denkst«, fügte er mit einem Blick auf Lena hastig hinzu. »Ich habe brav vor dem Fernseher gesessen. Manchmal sind die Jungs ganz froh, wenn ich nicht an meinem Bass herumzupfe und sie ein bisschen improvisieren können, ohne dass ich ihnen dazwischenfunke.«
Er fuhr weiter aus der Stadt hinaus – Militärring, Richtung Norden. Es herrschte wenig Verkehr, dann bog er in die Geestemünder Straße sein. Nun befanden sie sich in einer hässlichen, verlassenen Industriegegend.
»Gibt es hier nicht irgendwo einen Straßenstrich?«, fragte Lena. Sie schaute sich um, aber auf der dunklen Straße war niemand zu sehen. Lediglich zwei Trucks parkten am Rand.
»War hier wohl früher mal«, erwiderte Henning, dann hielt er vor einem zweistöckigen Haus, das einmal einen weißen Anstrich gehabt hatte, der aber mittlerweile fast vollkommen abgeblättert war. »Geestemünder Hof« verkündete eine Leuchtreklame. Eine echte Absteige.
Henning streifte sich bereits Handschuhe über, bevor er ausstieg. »Sieht nach einem Drogentoten aus, nicht wahr?« Er seufzte. »Na, ist dann schnell erledigt.«
Ein Streifenwagen stand mit eingeschaltetem Blaulicht vor dem Hotel.
Lena zog sich auch Handschuhe an. Sie wappnete sich. Auch wenn hier nicht mit einem Kapitalverbrechen zu rechnen war, hatte sie sich nie an den Anblick einer Leiche gewöhnen können. Henning ging voraus. Von einer Lobby konnte man bei diesem Hotel nicht sprechen. Ein schlecht beleuchteter Raum, in dem sich zwei schmale rote Sessel, ein winziger Tisch, auf dem eine Zeitung lag, und ein Tresen befanden. Ein dicker, glatzköpfiger Mann lehnte da. Ein Radio dudelte im Hintergrund. Henning hielt ihm seinen Ausweis entgegen.
Der Mann schnaufte und nickte dann. »Verdammter Mist, das …«, keuchte er. »So was passiert hier sonst nie … Hasse solchen Ärger …« Er deutete in einen Gang, der rechter Hand in den hinteren Teil des Gebäudes führte.
Der Gang war schwach erleuchtet. Es roch muffig und nach Insektenpulver. Sie liefen an drei unlackierten Sperrholztüren vorbei, die letzte Tür stand offen. Ein uniformierter Beamter hatte sich da postiert. Er schaute sie an.
»Schön, dass ihr endlich kommt«, sagte er mürrisch.
Offenkundig war er allein, ein zweiter Kollege war zumindest nicht zu entdecken.
In dem Raum brannte eine helle Neonröhre, die alles in ein kaltes, gnadenloses Licht tauchte. Selten hatte Lena ein trostloseres Hotelzimmer gesehen. Ein graues, breites Metallbett, das mit einer roten, zerschlissenen Tagesdecke überzogen war, ein Sperrholzschrank mit zwei Türen, zwei Metallstühle und ein Tisch mit einem tragbaren Fernseher, der zwanzig Jahre alt sein mochte und sich neben einer Terrassentür befand. Der Raum wirkte unbewohnt, nirgends persönliche Gegenstände, nur über einem der Stühle hing ein schwarzer Wollmantel, der teuer aussah und in dieses Ambiente überhaupt nicht passte.
»Wo ist der Tote?«, fragte Henning.
Der Beamte deutete in einen Nebenraum. »Liegt in der Badewanne – angezogen.«
»Ein Hotel mit Badewanne?«, fragte Henning verblüfft. Er schaute Lena an.
»Ist wahrscheinlich die Suite hier«, sagte der Polizist und lachte matt. Nun tauchte auch sein Kollege auf, ein junger Blonder mit Schnauzbart, der sein Smartphone noch am Ohr hatte und dann sein Telefonat beendete.
Das Bad war überraschend groß, fast so geräumig wie das Zimmer nebenan. Ein Waschbecken, eine Toilette und eine alte Badewanne, die auf vier Messingfüßen stand. Henning begann Fotos zu machen. Wasser tropfte.
Zuerst bemerkte Lena zwei Männerschuhe, die vor der Badewanne standen, nicht übermäßig groß, schwarz, elegant, mit einer dünnen Ledersohle.
»Scheiße«, sagte Henning, während er mit seinem Smartphone weiter Fotos schoss. »Das sieht nicht nach einem normalen Drogentoten aus.«
Über einer Heizung hingen zwei weiße Handtücher. Auf der Ablage vor dem Spiegel lagen ein Rasierapparat, daneben ein schwarzer Lederbeutel und ein Kabel, mit dem man Smartphones auflud.
»Wir haben einen Einsatz in Niehl«, erklärte der Beamte hinter ihnen. »Wir verschwinden – können hier sowieso nichts mehr machen. Den Bericht schreibt ihr, alles klar?«
Henning machte eine vage Handbewegung. »Idioten«, sagte er dann, als die beiden Streifenpolizisten verschwunden waren.
Wieder tropfte Wasser.
Der Tote hatte sich seine Schuhe ausgezogen und ordentlich vor der Wanne abgestellt, bevor er hineingestiegen war. Er trug einen grauen Anzug, eine dazu passende Weste und ein weißes Hemd. Eine Hand lag über der Umrandung der Wanne, der Kopf des Toten jedoch war unter die Wasseroberfläche gerutscht. Lena sah kurzes, offensichtlich blond gefärbtes Haar, offene, weit aufgerissene Augen, einen zusammengepressten Mund. Der Tote mochte etwa Mitte vierzig sein, ein typischer Junkie war er gewiss nicht.
»Wir brauchen die Rechtsmedizin«, sagte sie. »So einfach ist die Angelegenheit hier nicht zu klären.«
Henning stöhnte auf. »Wie schön, dass die Kollegen sich verdrückt haben.« Er beugte sich über die Wanne und machte weiter Fotos. Auch Lena näherte sich.
Der Schrecken traf sie wie ein Schlag ins Gesicht, den sie nicht hatte kommen sehen.
Den ganzen Abend hatte sie an Finn gedacht, warum er nicht zu ihrem Treffen gekommen war, und hier lag er, tot, mit gefärbten Haaren, in einem modischen Anzug in einer Badewanne.
Sie erinnerte sich an den Unfall. Der Lastwagen, den sie übersehen hatte, war wie ein Monster aus Stahl über sie hergefallen, mit Krach, Getöse und einem gewaltigen, furchterregenden Fauchen. Dann war eine eigentümliche kurze Stille eingetreten, in der sich ein Nichtbegreifen ausbreitete, ein Nichtbegreifen über das, was soeben Schreckliches passiert war. Die Realität war eine rissige Eisfläche, über die man ging, jeden Tag, ohne dass man es bemerkte, und nun war dieses Eis eingebrochen.
So empfand sie es auch hier, in diesem trostlosen Badezimmer, den toten Finn vor Augen.
Henning tauchte eine Hand in das Badewasser. »Eiskalt«, sagte er und zog die Hand wieder heraus. »Was ist mit dir? Alles in Ordnung?«
Die blond gefärbten Haare bewegten sich unter Wasser, trotzdem konnte man nicht den Eindruck haben, dass Finn noch lebte und jeden Moment auftauchen würde.
»Ich kenne den Mann«, sagte Lena. »Er heißt Finn, und er ist Journalist, glaube ich zumindest.«
Henning stöhnte auf, dann rief er die Rechtsmedizin an und die Spurensicherung hinzu.
Lena wandte sich ab. Was genau hatte Finn ihr erzählt, als sie da auf der Bank im Stadtgarten gesessen hatten? Obwohl es kalt gewesen war, hatte er über seinem T-Shirt nur einen dünnen beigefarbenen Trenchcoat getragen, wie sie eigentlich nicht mehr in Mode waren. Er hatte eine Zigarette geraucht und hatte auch ihr eine angeboten. Dann hatte er gesagt, dass er solche Therapiegespräche eigentlich nicht ausstehen könne, er sei ein Läufer, Halbmarathon mindestens, manchmal würde er auch vor seinen Problemen davonlaufen. Er hatte gelacht.
Was für Probleme konnte er gehabt haben?
Sie öffnete den Schrank. Zwei Hemden hingen da, der beigefarbene Trenchcoat und Trainingszeug: eine lange Hose und eine Outdoorjacke. Dazu in einem Seitenfach Unterwäsche und Laufschuhe. Sonst nichts. Kein Laptop, kein Smartphone. Finn war ein Mann, der offensichtlich ohne Gepäck unterwegs gewesen war. Oder jemand hatte es mitgenommen.
Henning kam ihr nach und blickte ihr über die Schulter. »Für mich sieht es wie der Suizid eines Mannes aus, der irgendwie feststeckte – Ehekrise, Schulden, das Übliche eben.«
Lena schloss die Tür wieder. Sollte sie von ihrer Therapie erzählen – dass sich da einmal in der Woche Frauen und Männer zusammenfanden, die ein Kind verloren hatten und nicht mit dem Verlust klarkamen?
Nein, dazu war später noch Zeit.
Der dicke Glatzkopf stand immer noch hinter dem Tresen. Er telefonierte und wimmelte unfreundlich einen Gast ab. »Keine Chance. Mitte Januar ist Messe, da sind wir ausgebucht.« Mit finsterer Miene legte er auf. »Wann wird der Kerl endlich abgeholt?«, fragte er Lena. »Ich habe Gäste im Haus. Die sollen nicht mitkriegen, dass …«
Lena griff über den Tresen und nahm das Buch an sich, das da lag. »Haben Sie hier die Personalien Ihrer Gäste aufgeschrieben?«
»Ja, wie es Vorschrift ist«, entgegnete der Glatzkopf. Er schwitzte unangenehm. »Der Mann hieß Helmut Müller, er stammte aus Gummersbach, Bahnhofstraße 7. Hat er jedenfalls angeben.« Er atmete schwer ein und aus. »Kann Ihnen den Meldezettel raussuchen.«
Helmut Müller? Finn hatte sich wenig Mühe gegeben, sich einen Namen auszudenken.
»Wann ist dieser Helmut Müller angereist?« Sie blätterte das Buch durch. Tatsächlich schien auch eine Absteige wie dieses Hotel Gäste zu haben, und es sah nicht aus, als würde es von Prostituierten, die auf der Geestemünder Straße standen, frequentiert werden.
»Vor drei Tagen – am Dienstag«, erklärte der Mann. »Er hat wenig gefrühstückt und war meistens auf seinem Zimmer. Kam mir gleich seltsam vor.«
»Hatte er Besuch?«
»Ich weiß nicht.« Er strich sich über die Glatze und schnaufte. »Ich bin nicht immer hier. Mache die Bücher, den Einkauf, die Wäsche … Ich glaube, einmal war ein junges Mädchen da, eine echte Schönheit, halblange blonde Haare. Sie ist wohl aus seinem Zimmer gekommen.«
»Wann war das?«, fragte Lena.
Henning trat nun auch zu ihr. Er hielt ein Stück Plastik hoch, einen Kabelbinder. »Habe ich unter dem Bett gefunden«, sagte er.
Der Glatzkopf blickte auf den Kabelbinder. »Das Mädchen? Vorgestern, glaube ich.«
»Haben Sie den Toten entdeckt?«, fragte Lena.
Der Mann nickte. »Ich habe angeklopft, weil ich wissen wollte, ob er morgen abreist. Die Tür war nicht abgeschlossen, das Licht brannte, und die Terrassentür stand auf. Eigentlich bin ich nur reingegangen, um die Tür zu schließen. Wegen der Kälte, die hereinzog. Verstehen Sie?«
Lena zog ein Notizbuch hervor. »Sie haben die Terrassentür geschlossen, und dann?«
»Dann habe ich noch einen Blick ins Bad geworfen. Ich habe sonst nichts angefasst.« Er breitete die Arme aus. »Hören Sie – Sie denken doch wohl nicht, dass ich irgendetwas mitgenommen habe? So einer bin ich nicht mehr. Krumme Sachen kommen für mich absolut nicht mehr infrage.«
Der Wirt hieß Markus Schwarzer, er war neunundvierzig Jahre alt, mit seiner Frau führte er das Hotel erst seit knapp zwei Jahren. Zuvor hatte er wegen Raubs und räuberischer Erpressung fast drei Jahre im Gefängnis gesessen.
Lena brauchte einen Telefonanruf, um das herauszufinden. Schwarzers Vorgeschichte beunruhigte sie nicht sonderlich. Er hätte dem Toten möglicherweise ein paar Geldscheine aus dem Portemonnaie nehmen können, quasi als Anzahlung für die Scherereien, die ihn wegen dessen Tod erwarteten, aber warum hätte er gleich die ganze Geldbörse und alle Papiere verschwinden lassen sollen?
»Vielleicht hat dieser Finn ja seine Papiere in der Anzugtasche«, sagte Henning. »Am besten mit einem Abschiedsbrief – wasserdicht verpackt.«
Seine Laune hatte sich deutlich eingetrübt.
Die Kriminaltechnik rückte mit zwei Mann an – die kleine Besetzung –, dann kam auch noch die Rechtsmedizinerin, Frau Doktor Margot Dreier, eine energische Frau Anfang vierzig mit hennarot gefärbten Haaren. Lena kannte sie lediglich vom Sehen.
Sie hörte, wie einer der Spurensicherer dem Wasser eine Probe entnahm, dann ließen sie es ab. Ein hässliches saugendes Geräusch entstand, und Lena stellte sich vor, wie Finns wächsernes Gesicht nun langsam auftauchte. Sie nahm ihr Smartphone hervor und ging erneut auf den schmalen Flur hinaus. Ein Gast hatte sich da eingefunden, ein älterer Mann in einem Lodenmantel. Er versuchte an ihr vorbei ins Zimmer zu blicken.
»Ist was passiert?«, fragte er.
»Ein Unfall«, erwiderte sie. »Haben Sie den Mann gekannt, der dieses Zimmer bewohnt hat?«
Der Mann kniff die Augen zusammen. »Sie sind Polizistin, was?«, fragte er. »Nein, den Mann kannte ich nicht. Ist er tot? Selbstmord?«
Sie ging wortlos an ihm vorbei und wählte. Es war fast Mitternacht. Silvana Roth meldete sich nach dem dritten Läuten.
Lena entschuldigte sich für die späte Störung, dann fragte sie: »An unserem vorletzten Treffen hat ein Mann teilgenommen – etwa Mitte vierzig, nicht sehr groß, braune Haare. Er heißt Finn mit Vornamen. Kannst du mir seinen Nachnamen geben und vielleicht seine Adresse?«
Silvana zögerte einen Moment. Ja, sie unterlag als Therapeutin der Schweigepflicht. Sie konnte nicht einfach einen Namen nennen, selbst wenn die Polizei sie darum bat.
»Es ist wirklich wichtig«, fügte Lena erklärend hinzu.
»Bedauere«, sagte Silvana Roth. »Aber ich habe noch nie einen Mann gekannt, der Finn heißt.«
Kapitel 4
In den letzten Jahren hatte er ihn niemals verspürt: den Drang zu trinken, Bier, Wein, Cognac, gleichgültig, ein Glas nach dem anderen. Aber nun … Er war dreiundvierzig Jahre alt, er hatte schon vor einiger Zeit seine Frau verloren, nun auch noch seinen Job. Er hatte genügend Gründe, sich das eine oder andere Glas zu gönnen, aber nein, er hatte geschworen, sich nie wieder zu betrinken, keinen Rausch mehr, nicht einmal einen Hauch von Leichtigkeit, die ein paar Gläser Wein mit sich bringen mochten.
Das Unglück … er hatte es tief in sich begraben, niemand würde es mehr hervorholen, nicht einmal er selbst.
Er gab Maria ein großzügiges Trinkgeld, dann setzte er sich in seinen Volvo und fuhr ziellos durch die Stadt, den Ring hinauf, dann über die Mülheimer Brücke. Köln erlebte einen recht warmen Novembertag. Wie hieß es nun immer häufiger? Zu warm für diese Jahreszeit. Er hätte sich auch seine Laufschuhe nehmen und am Rhein entlanglaufen können. Als er spürte, dass ihm plötzlich Tränen über das Gesicht liefen, fuhr er auf den Fahrradweg und hielt an.
War es die Trauer um Linda? Was war es genau? Er würde sie nie wiedersehen – die Art, wie ihre Nasenflügel bebten, wenn sie wütend war, oder wie sie konzentriert, mit einer Brille auf der Nasenspitze auf den Bildschirm starrte, wenn sie an einem längeren Artikel saß.
Er hätte Kuhn doch niederschießen sollen.
Wenn Kuhn nicht gewesen wäre … Sie hatte ihn wegen eines Artikels befragt, hatte ihn an der Universität aufgesucht, dann hatte er sie gebeten, an einem Buch mitzuarbeiten – immer später war sie abends nach Hause gekommen. Vor drei Jahren war das gewesen, vor drei langen Jahren …
Einmal hatte er die beiden zufällig in einem Restaurant gesehen, er hatte beobachtet, wie Linda Kuhn angelächelt hatte, und dann – er erstarrte noch immer bei dem Gedanken daran – hatte er zugeschaut, wie sie seine Hände ergriffen hatte, zärtlich, lächelnd und so, als wäre sie eine Handleserin, die ihm sein Schicksal vorhersagen könne. Da erst hatte er Bescheid gewusst. Linda liebte diesen Professor mit den wirren grauen Haaren, den geröteten Wangen, diesen Schönredner und Weintrinker.
Als Kathy ihn anrief, überlegte er, nicht an den Apparat zu gehen, doch sie war hartnäckig, sie ließ es klingeln, sie wusste, dass er irgendwann die Geduld verlieren würde.
»Meine Elfe«, sagte er sanft, »was willst du?« So nannte er sie eigentlich nur, wenn er guter Stimmung war. Sie war die schönste Frau, die er kannte, ein perfektes Gesicht, lange schwarze Haare und die Figur eines Models.
»Stimmt es, was Nolden erzählt hat? Du bist raus – du willst ein Buch schreiben?« Sie klang atemlos, als hätte sie diese Nachricht tatsächlich aufgebracht.
»Ja«, sagte er, »ich …« Nolden hatte nicht die Eier gehabt, die Wahrheit zu sagen, dieser Scheißkerl. »Du weißt, dass ich schon lange …«
»Willst du über diese Verschwörung schreiben … diese Geschichte aus dem Internet?«
Er konnte sich nicht erinnern, ihr davon erzählt zu haben. »Hör zu«, sagte er und bemerkte, wie sich seine Stimme veränderte, wie sie ernster und eindringlicher wurde. »Es haben sich ein paar Dinge verändert … meine Frau ist tot, ein Autounfall. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so weitermachen konnte. Ich meine, unser Job geht den Bach runter … Wer kauft sich noch eine Zeitung? Und für online bin ich nicht gemacht … Schnell eine Story zusammenschustern und dann gucken, wie oft sie angeklickt wird – das ist nichts für mich.« Er fand, dass er überzeugend klang.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Aber du hättest mir etwas sagen können.« Sie wirkte ehrlich bekümmert. Sie hatte einen Freund, irgendeinen Schauspieler, der in einer Vorabendserie mitspielte und da den arroganten Schönling mimte.
»Meine Elfe«, sagte er, »ich rufe dich wieder an, okay?«
Dann unterbrach er die Verbindung. Er fuhr weiter. Jetzt hatte er immerhin eine Story: Meine Frau ist gestorben – ich habe so nicht mehr weitermachen können.
Und eine Waffe könnte er sich auch besorgen – erst eine Kugel für Kuhn, dann für Nolden.
Es war seltsam, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und die Tür aufzuschieben. Er wusste gleich, dass in dem Haus niemand war. Leere und Verlassenheit wehten ihm entgegen. Kuhn würde hier nicht auf ihn lauern. Er schloss die Tür. Dann drückte er auf den Lichtschalter. Es war bereits dunkel, achtzehn Uhr, er hatte das Gefühl, nicht wie ein Einbrecher durch die Räume schleichen zu dürfen.
Das Licht funktionierte jedoch nicht, er ging durch den schmalen Flur, hinein in den Wohnraum. Auch hier kein Licht.
Er bewegte sich Richtung Küche. Der Kühlschrank stand offen. Jemand musste den Strom abgestellt haben. Er nahm sein Smartphone und schaltete die Funktion Taschenlampe an. Dann blickte er sich um. Alles wirkte geisterhaft und aufgeräumt, als hätte Linda eine lange Reise gemacht, und nichts schien zu fehlen. Der lange Holztisch mit den sechs Stühlen, die Sofaecke mit dem LED-Fernseher. Lediglich das Bild an der Wand kannte er nicht. Ein abstraktes Gemälde in Rot und Gelb hing da, wo ihr Foto gewesen war, Linda und er in einer innigen Umarmung. Das Foto war vor fast elf Jahren in Barcelona aufgenommen worden. Trauer überfiel ihn. Es war, als wäre dieses Haus, das sie zusammen gebaut hatten, ein lebendiges Wesen, das wusste, dass Linda nicht mehr am Leben war.
Er kehrte in den Flur zurück und ging die Holztreppe hinauf. Nun bewegte er sich doch wie ein Einbrecher durch das Haus. Das leise Knarren war der einzige Laut, den er hörte – neben seinem Herzschlag, den er bis in die Schläfen hinauf wahrnahm.
Er blickte kurz in sein ehemaliges Arbeitszimmer – es war so, wie er es verlassen hatte, der Glasschrank, in dem noch ein paar Hemden von ihm hingen, leere Regale, die schmale Arbeitsplatte mit dem defekten Radiowecker, die auf zwei Holzständern ruhte. Den Blick in Lindas Schlafzimmer ersparte er sich und lief gleich in ihr Arbeitszimmer. All ihre Bücher waren noch da, an der Wand die Auszeichnungen, die sie für zwei Reportagen bekommen hatte – eine über eine Sinti-Familie, die sie ein Jahr begleitet hatte, die andere über das Leben einer Arbeiterin in einer Schokoladenfabrik. Auf beide Preise war sie sehr stolz gewesen.
Auch hier funktionierte das Licht nicht. Langsam ging er hinunter, dann die Steintreppe hinab in den Keller. Die Klappe zum Sicherungskasten war angelehnt. Jemand hatte die Hauptsicherung herausgedreht.
Im Licht wirkte das Haus noch verlassener. Wo war Linda in der letzten Zeit gewesen? In der Küche fanden sich nur ein paar Dosen mit Pilzen und Tomaten. Die Spüle war staubtrocken und so sorgsam abgewischt worden, dass nicht einmal ein paar Wasserflecke zurückgeblieben waren. Auch in der Spülmaschine fand sich nichts, keine letzte schmutzige Tasse, kein benutztes, hastig weggeräumtes Glas. Und an der Kühlschranktür hing nichts mehr – keine Notiz, kein Einkaufszettel, keine Postkarte, lediglich die Weihnachtskarte von einer Hilfsorganisation. Oxfam – die Karte stammte aus dem letzten Jahr.
Hatte Linda bei Kuhn gewohnt? Waren die beiden irgendwo zusammengezogen? Aber Linda hatte dieses Haus geliebt, sie hatte es unbedingt halten wollen, auch wenn ihr Gehalt als Redakteurin nicht besonders üppig gewesen war.
Er stand in der Küche und blickte auf die Straße hinaus. Niemand war da zu sehen, er könnte zu Reimerts gehen, zu Möllns, sich erkundigen, was mit Linda geschehen war.
Als das Telefon klingelte, war es, als wäre ein Knallkörper explodiert, ein schriller, ungewohnter Laut, der ihn erschreckte.
Das Telefon befand sich im Wohnraum auf einer antiken Kommode, die Linda von ihrem Vater geerbt hatte, ein wuchtiges, dunkles Möbel, das eigentlich nie in das Haus gepasst hatte.
Er ließ es dreimal klingeln, dann meldete er sich mit einem heiseren »Ja?«.
Niemand antwortete. Er hörte zwei Atemzüge, er wiederholte sein »Ja?«, nur diesmal fester und fragender. Dann wurde aufgelegt.
Er hatte sofort Kuhn in Verdacht. Der feige Professor wollte wissen, ob er tatsächlich im Haus war.
Zurück in der Küche beobachtete er, wie draußen eine Frau mit einem Hund vorbeiging und sich nach ihm umschaute, zumindest blickte sie zu seinem erleuchteten Küchenfenster herüber. Kannte er sie? War sie eine Nachbarin? Rasch wandte sie sich ab und zog ihren Hund, einen Retriever, zu sich heran. Er überlegte, sein Smartphone zu nehmen und ein Foto von der Frau zu machen, doch nein, was sollte das? Irgendetwas war mit Linda geschehen, aber er durfte sich nicht verrückt machen lassen.
Er fand einen Rest Pulverkaffee, brühte ihn auf und trank ihn dann schwarz und ohne Zucker.
Sollte er tatsächlich wieder in dieses Haus einziehen? Er konnte es verkaufen, mit dem Geld könnte er eine Weile durch die Welt ziehen …
Wieder überkam ihn Trauer.
Er trank den Kaffee aus und legte sich auf den Holzboden. Er schloss die Augen, und plötzlich hörte er Linda, wie sie in der Küche hantierte, ein schnelles Essen kochte, ihre Spezialität, Essensgerüche zogen durchs Haus, der Duft von geschmolzener Butter und Curry, dann beugte sie sich über ihn, küsste ihn wie beiläufig auf den Mund …
Der Klang seines Smartphones riss ihn aus seinen Gedanken.
»Nun«, sagte Mitchi, »hast du endlich Zeit, das Buch zu schreiben. Hast du schon angefangen? Kommst du nachher vorbei?«
Mitchi war fast achtzig Jahre alt, sie wohnte in einem Bungalow in Rösrath, mit drei Hunden und vier Katzen. Sie war erst die heimliche Geliebte, dann die Ehefrau eines berühmten Komponisten gewesen, der ihr das Haus vermacht hatte. Sie war eine Künstlerin, malte und baute Installationen aus Steinen und abgestorbenen Bäumen, und sie liebte jüngere Männer. Er hatte sie auf dem Sommerfest seiner Zeitung getroffen und hatte ihren Avancen knapp entgehen können. Damals war auch Linda dabei gewesen, die Mitchis Annäherungsversuche amüsiert beobachtet hatte.
»Sie ist ein altes Hippiemädchen«, hatte sie gesagt. »Für sie gelten keine Regeln.«
Dreißigtausend Euro hatte Mitchi ihm angeboten, wenn er ein Buch über die Bilderberger schreiben würde und über Ruben, ihren mexikanischen Freund, der vor vier Wochen von einem Tag auf den anderen verschwunden war.
Mitchis Hunde sprangen aufgeregt bellend um ihn herum, nachdem er eingetreten war, die Katzen hatten sich verzogen. Mitchi empfing ihn mit einer Umarmung. Sie roch nach Marihuana. Im Haus lief laute Musik, irgendwelche Sphärenklänge, die vermutlich ihr Mann, der vor zehn Jahren gestorben war, komponiert hatte.
Er küsste sie auf die Wange und hielt sich theatralisch die Ohren zu.
Mitchi lachte, dann klatschte sie in die Hände, und die Musik und das Hundegebell verstummten. Sie trug ihr graues Haar in einem langen Zopf. Wenn sie lachte, wirkte sie schier alterslos, eine Göttin, die Segen schenkte oder auf freundliche Art bestrafte.
»Es ist schön, dass du kommen konntest«, sagte sie, und er wusste nicht, ob sie es spöttisch meinte.
Ihr Haus war auch ein Kunstwerk, ein wenig Bauhausstil mit einem gläsernen Innenhof, in dem sie ihre Gäste empfing.
Tee stand bereit, und daneben lagen ein Stapel Papiere, offenkundig Kopien, und ein Foto von Ruben.
Ruben Souza, ihr Lover, den er zwei- oder dreimal gesehen hatte, ein Kerl Mitte vierzig, mit einem schwarzen Zopf und einer Narbe auf der linken Wange. Er hatte überraschenderweise recht gutes Deutsch gesprochen.
Mitchi schenkte ihm Tee ein. Ihre Augen funkelten, ihre Hunde hatten sich wieder verzogen, nun war die Zeit der Katzen gekommen, die um sie herumschlichen.
»Woher weißt du, dass Nolden mich rausgeworfen hat?«, fragte er, und für einen Moment kam ihm der Gedanke, dass sie dahinterstecken konnte, damit er ihr Buch schrieb.
Sie nahm einen Schluck Tee und blickte auf zum schwarzen, wolkenlosen Himmel, ein paar Sterne funkelten da.
»Ich wusste schon länger von seinen Plänen«, sagte sie. »Ich telefoniere hin und wieder mit Nolden. Der Verleger hat ihn bedrängt, die Kosten zu senken. Außerdem hast du dich unbeliebt gemacht, der Verleger mag dich nicht … Du bist zu aufsässig, zu ambitioniert, zu …« Sie zögerte und strich sich über ihren Zopf. »Nolden ist kein Unmensch, er wird dir eine gute Abfindung zahlen, und dann kannst du endlich richtig an unserem Buch arbeiten.« Ihre Augen funkelten noch ein wenig intensiver, sie waren grün, grün wie Jade. Vor vierzig Jahren mochte Mitchi eine Frau gewesen sein, der kein Mann widerstehen konnte. Angeblich hatte sie vor Jahrzehnten auch mit dem Verleger eine Affäre gehabt – er war Professor wie Kuhn, ein angesehener Mann.
»Du könntest den Verleger anrufen«, sagte er. »Ein gutes Wort für mich einlegen … Es ist …« Er überlegte kurz, von Linda zu sprechen, verstummte dann aber abrupt.
»Der Verleger geht nicht mehr ans Telefon, wenn ich anrufe«, erwiderte sie und lachte lauthals. »Er nimmt es mir übel, dass ich seinen Namen in einer Anzeige aufgeführt habe – wegen der deutschen Flagge.« Sie lachte wieder.
Mitchi führte seit Jahren einen ganz eigenen, privaten Feldzug mit dem Ziel, die deutsche Flagge zu ändern. Sie wollte, dass man die Farben tauschte. Schwarz sei die Farbe der Erde, deshalb gehöre es an die erste Stelle, nicht das Gold. Man müsse die Flagge erden. Sie hatte auch ein paar Kunstwerke mit ihrer eigenen Flagge entworfen. Achenbach, dem Zeitungsverleger, war sie damit gehörig auf die Nerven gegangen.
»Die Zeitung ist schon lange nichts mehr für dich, das hat auch Nolden begriffen«, fuhr sie fort. Sie kraulte eine ihrer Katzen, die kleinste, die ganz weiß war und leise schnurrte. Die anderen drei beäugten die weiße neidisch.
»Du hast Nolden von dem Buch erzählt, du hast ihm gesagt, dass ich es schreiben werde?«, fragte er. Er verschwieg, dass er selbst auch schon von diesem Buch gesprochen hatte – um sich interessant zu machen und eine Unabhängigkeit vorzugaukeln, die er gar nicht empfunden hatte.
»Nicht direkt«, sagte sie. Sie beugte sich vor und nahm das Foto von Ruben. »Ich möchte, dass du es für mich tust. Ruben ist ermordet worden, das weiß ich genau, weil er zu viel über die Bilderberger zusammengetragen hat. Ihnen gefällt das nicht, wenn jemand darüber schreibt, was sie tun.« Sie schaute das Foto des Mexikaners voller Trauer an, furchte die Stirn und küsste es, wie ein Mädchen, das ihren Lieblingssänger anhimmelte.
»Ich habe schon ein wenig recherchiert«, entgegnete er. »Über die Bilderberger steht mittlerweile eine Menge im Internet, Listen und Termine. Möglicherweise ist Ruben nur abgehauen, zurück nach Mexiko. Vielleicht hat er dich nicht so geliebt wie du ihn.«
Sie legte das Foto zurück und nahm einen Stapel Papiere.
»Du bist Journalist«, sagte sie, »du solltest wissen, wie eine gute Story aussieht. Warum treffen sich hundert hochrangige Leute, Politiker, Militärs, Bankiers, Industriebosse, seit sechzig Jahren heimlich einmal im Jahr? Weil sie plaudern wollen? Guten Wein trinken und Zigarren rauchen? Nein!«, sagte sie entschieden. »Es stimmt, was Ruben mir erzählt hat. Diese Leute wollen eine neue Weltordnung. Sie sind eine heimliche Weltregierung, provozieren Krisen, schüchtern Politiker ein, und sie bringen Leute um.«
»Was also soll ich genau tun?«, fragte er.
»Du sollst herausfinden, was mit Ruben passiert ist, und du sollst dieses Buch schreiben, in dem alles über die Bilderberger steht. Wen sie alles umgebracht haben. Olof Palme, Alfred Herrhausen … Ruben hat schon eine Menge Material gesammelt. Morgen solltest du anfangen – und dass Linda tot ist, tut mir leid, aber ihr wart ja schon lange kein Paar mehr.«
Kapitel 5
Sie hatten einen Toten ohne Identität. Bei Silvana Roth hatte er sich Joachim Schmidt genannt, als er ohne Anmeldung bei ihr vor der Tür gestanden hatte. Offenkundig hatte er eine Schwäche für belanglose, ein wenig altmodisch klingende Namen gehabt. Wenigstens einen Fund hatte die Spurensicherung gemacht. In einem Abfallkorb fanden sich fünf verschiedene Barbiturate sowie ein Plastikbecher. Sah ganz so aus, als hätte der Tote sich selbst einen tödlichen Cocktail verabreicht, bevor er sich in die Badewanne gelegt hatte.
»Also doch ein Selbstmord?«, hatte Henning von der Rechtsmedizinerin wissen wollen.
»Möglich«, hatte Margot Dreier erwidert, kein Wort mehr.
Ein Pass, ein Portemonnaie, andere Ausweispapiere oder ein Smartphone hatte der Tote nicht bei sich gehabt. Auch in seiner Kleidung hatte sich kein Hinweis auf seine Identität gefunden. Jemand hatte sogar die Etiketten entfernt. Und warum hatte ein Kabelbinder unter dem Bett gelegen? Aber vielleicht hatte der gar nichts mit dem Toten zu tun.
Während der Tote in die Rechtsmedizin abtransportiert wurde, hatte sich Lena noch einmal den Glatzkopf vorgenommen. War sein Gast mit dem eigenen Wagen vorgefahren? Hatte er von einem Apparat des Hotels telefoniert? Oder hatte er einen offen zugänglichen Computer benutzt?
»Ich hätte gleich wissen müssen, dass es Ärger gibt«, erwiderte Schwarzer. »Der Kerl hat im Voraus bezahlt – in bar. Für vier Nächte, sogar mit einem Trinkgeld. Wer tut so etwas heute schon noch?« Sonst hatte er nichts Auffälliges beobachtet, und einen Computer für Gäste gab es im Geestemünder Hof nicht.
Sie fuhren ins Präsidium. Vielleicht gaben die Vermisstenanzeigen etwas her, die in den letzten zwei, drei Tagen eingegangen waren. Eine treusorgende Gattin, die ihren geliebten Ehemann vermisste … Lena gab sich da keinen großen Hoffnungen hin, und Henning ging die Dateien nur lustlos durch. Nichts. Ein paar Jugendliche wurden gesucht, ein achtzigjähriger Mann, der an Demenz litt und aus seinem Altenheim weggelaufen war.
»Etwas stimmt an diesem Toten nicht«, sagte Lena. »Das Zimmer … es war zu aufgeräumt, zu wenige persönliche Gegenstände. Und wieso hatte der Anzug kein Etikett?«
Henning gähnte. Es war halb zwei in der Nacht. Er verabschiedete sich. »Soll ich dich mitnehmen?«, fragte er dann, als er schon beinahe aus der Tür war.
Sie winkte ab. Hinter dem größeren Verhörzimmer gab es eine kleine Kammer mit einem Sofa. Dort hatte sie schon häufiger übernachtet, wenn sie sich davor gefürchtet hatte, nach Hause in die leere Wohnung zu fahren.
In den letzten zwei Nächten hatte sie nicht schlafen können und war gegen zwei Uhr in Simons Hochbett geklettert. Sie glaubte, dort immer noch seinen Geruch wahrzunehmen, obschon er nun fast ein Jahr tot war. Es war wie eine Niederlage gewesen – Silvana hatte ihr geraten, Strategien gegen diesen Impuls zu entwickeln, im Bett ihres toten Sohnes schlafen zu müssen: einen Spaziergang zu machen, sich einen Kaffee zu kochen, Musik zu hören, eine Kerze aufzustellen oder Simon einen Brief zu schreiben, aber nichts hatte geholfen. Im Traum war auch ihre Geisterkatze wieder aufgetaucht, ein dünnes, ausgemergeltes Wesen, das sie häufiger in unruhigen Nächten heimsuchte. Sie war immer erschrocken, wenn sie im Traum die Wohnungstür öffnete und die Katze auf sie zuschlich, von ihr vergessen und kurz vor dem Verhungern, weil sie nicht daran gedacht hatte, sie zu füttern.
Während sie auf dem Sofa unter einer Decke lag, dachte sie erneut an den Mann, der sich Finn genannt hatte. Abgehetzt war er ihr vorgekommen, als hätte er sich spontan entschlossen, zu diesem Treffen von Trauernden zu gehen. Als Silvana ihn angesprochen hatte, hatte er seinen Sohn erwähnt, aber statt von dessen Tod hatte er von der Geburt gesprochen – wie glücklich er gewesen war. Ausführlich hatte er geschildert, wie er zuerst den schwarzen Haarschopf, dann den Kopf, die winzigen Hände seines Kindes gesehen hatte. Ohne jede Scheu hatte sein Sohn sich umgesehen, stumm und neugierig auf das, was die Welt ihm bot. Hatte der Mann den Namen seines Kindes erwähnt? Sie konnte sich nicht daran erinnern. In einem gleichmütigen Tonfall hatte er gesprochen, gefasst, als hätte er seine Geschichte schon viele Male erzählt. Sein Sohn war am plötzlichen Kindstod gestorben. Mitten in der Nacht war er zu dem Bettchen in ein Nebenzimmer geeilt, aufgeschreckt, weil etwas plötzlich anders gewesen war – die Stille, die Abwesenheit von etwas. Eine Frau war in den Schilderungen nicht vorgekommen.
Hatte der Mann, der nicht Finn hieß, sich vielleicht deshalb umgebracht, weil sein Kind gestorben war? Weil seine Frau ihn verlassen hatte? Hatte es niemanden gegeben, an den er einen Abschiedsbrief hätte richten können?
Sie hörte einen Streifenwagen, der mit eingeschalteter Sirene vom Hof fuhr, dann schlief sie endlich ein, traumlos, ohne dass die Geisterkatze sie verfolgte.
Um neun Uhr begann Margot Dreier mit der Obduktion. Lena hatte nur einen Kaffee getrunken. Mit der Straßenbahn war sie zum Melatengürtel zur Rechtsmedizin hinausgefahren. Noch immer vermied sie es, sich selbst ans Steuer eines Wagens zu setzen. Henning sah auch nicht aus, als hätte er viel Schlaf erwischt.
Lena hielt sich abseits, sie blickte nicht zu der Rechtsmedizinerin hinüber, die routiniert in ihr Diktiergerät sprach, während sie die äußere Leichenschau vornahm. Ein blasser Mann mit Nickelbrille attestierte ihr.
Finn – immer noch hatte der Tote für sie diesen Namen – war Anfang bis Mitte vierzig, er war einen Meter fünfundsiebzig groß, sportlich, kein Übergewicht. Am Kopf entdeckte Margot Dreier eine kleine Wunde, möglicherweise hatte er sich in der Wanne verletzt. An einem Armgelenk hatte er eine leichte Schürfwunde …
Henning warf ihr einen fragenden Blick zu. Der Kabelbinder … hatte er doch etwas mit ihrem Fall zu tun?
Dann begann die Rechtsmedizinerin die Leiche zu öffnen. Lena hörte die Säge, und plötzlich sah sie Finns Hände vor sich, wie er auf der Bank gesessen hatte, er hatte eine Zigarette geraucht, leicht vorgebeugt, mit starrem Blick auf den Boden vor sich. »Man begreift es nicht«, hatte er leise gesagt. »Ein totes Kind … das eigene Kind, leblos, in den Armen …«
Die Worte waren grausam gewesen, doch sie hatte etwas anderes gefühlt – Nähe zu einem Menschen, das Gefühl, dass sie doch noch einmal einem anderen nahe sein könnte.
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Margot Dreier den Brustkorb öffnete, die Säge kreischte, ein absurdes Geräusch, als würde da jemand fachmännisch ein Stück Holz zurechtschneiden. Sie stürmte hinaus, weil ihr Magen sich vor Übelkeit zusammenzog.
Auf dem Gang stand David Bauer, wieder in Hut und Mantel, als hätte er auf sie gewartet. Er nickte ihr zu, ein wenig distanziert und zögernd.
»Euer neuer Fall?«, fragte er und deutete in den Sezierraum. »Der Tote aus dem Hotel?«
»Leitest du die Ermittlungen?«, fragte sie. Ihr war noch immer übel. Selbst durch die geschlossene Tür war die Säge zu hören.
»Nein«, erwiderte David, »aber ich habe die Fotos gesehen, die Mahn gemacht hat. Wisst ihr mittlerweile, wer der Tote ist?«
»Noch nicht«, erwiderte sie. »Aber nachher kriegen wir die Fingerabdrücke. Vielleicht haben wir etwas in den Dateien.«
David kam einen Schritt auf sie zu. Er war unrasiert und sah auch nicht aus, als hätte er viel geschlafen. Das Konzert im Stadtgarten fiel ihr ein – und dass er ja nicht mehr mit seiner Frau zusammen war. Hatte er nun eine eigene Wohnung? Oder war in ein Hotel gezogen? Seltsam, dass ihr diese Fragen erst jetzt kamen.
»Wenn wir nichts finden, werden wir ein Foto des Toten an die Presse geben müssen«, fügte sie hinzu.
»Nicht nötig«, erwiderte David. »Ich kenne den Mann, habe ihn sofort erkannt. Er hat einmal ein Interview mit mir gemacht, wird drei Jahre her sein – er war Reporter beim ›Express‹.« Er griff in seine Tasche und hielt ihr eine Visitenkarte hin.
Kapitel 6
Dienstag, 17. November
Es war seltsam, mitten in der Nacht in dem verlassenen Haus zu sein. Es war zwei Uhr in der Frühe. Mitchi hatte ihn zum Bleiben überreden wollen. Sie hatte zwei Gästezimmer im Haus, er hätte sich einrichten können, aber ihre Nähe störte ihn plötzlich, die Hunde, die sich wieder heranschlichen, die Gerüche, die durch das Haus wehten, Marihuana, Tee, Räucherstäbchen, Hundefutter. Ihr unaufhörliches Gerede – sie war achtzig Jahre alt, aber sie hatte mehr Energie als eine Vierzigjährige. Bevor er sich verabschiedete, drückte ihm Mitchi neben den zwei Aktentaschen Material über die Bilderberger noch eine kleine Schachtel in die Hand.
»Sie hat Ruben gehört«, sagte sie. »Er hatte sie vergessen. Vielleicht hätte sie ihm das Leben gerettet.«
Als er die Schachtel öffnete, lag eine Beretta darin.
Er hatte noch nie eine Waffe besessen.
»Nimm sie mit«, sagte Mitchi. »Sie ist geladen.«
Als würde er sich tatsächlich in Gefahr begeben.
In dem Haus ging er nicht in sein Arbeitszimmer, wo sich sein Bett befand, sondern legte sich auf das rote Samtsofa. Er löschte alle Lichter und lag nur da, die Pistole vor sich auf einem schmalen Glastisch.
Linda war noch zu spüren, dachte er. Sie war irgendwie anwesend, ihr Abdruck, als würde er ein Bett betrachten, auf dem sie eben noch gelegen hatte.
Er musste in Erfahrung bringen, wie sie genau gestorben war und wo sie sich zuletzt aufgehalten hatte.
Als er nicht einschlafen konnte, schaltete er die Leselampe über dem Sofa an und nahm die ersten Blätter hervor, die Ruben beschrieben hatte – mit der Hand, aber seine Schrift war groß und klar, sodass man sie leicht lesen konnte. Es waren Notizen in Englisch.