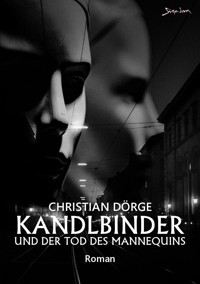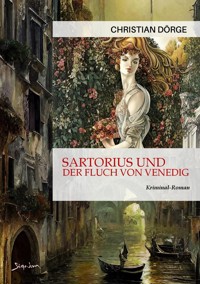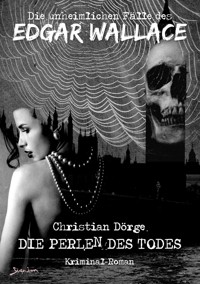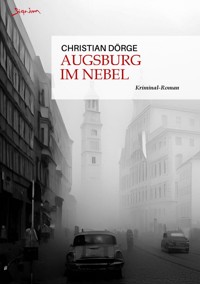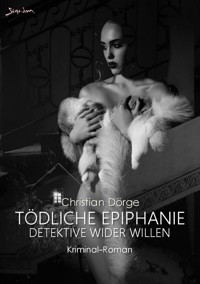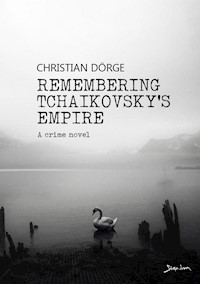5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
München, im Dezember 1969: Spät am Abend kommt Franzi Meerapfel, eine wunderschöne junge Frau, der das Schicksal übel mitgespielt hat, ins Hotel Erdinger Hof, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen versuchen zwei finster aussehende Kerle, Franzi gewaltsam aus dem Hotel zu entführen, was Geschäftsführer August Wittelsbacher und der Portier Alois Ritter nur mit allergrößter Mühe verhindern können. Noch am selben Abend wird Franzi in einem zwielichtigen Lokal am Starnberger See ermordet aufgefunden. Und in diesen Fall sind hochrangige Politiker und korrupte Polizisten ebenso verwickelt wie der brutale Gangsterboss Max Angelus... MÜNCHNER MÖRDER-WEIHNACHT ist ein ebenso spannender wie nostalgischer Kriminal-Roman um Mord, Korruption und Erpressung aus der Feder von Christian Dörge, Autor u. a. der Krimi-Serien EIN FALL FÜR REMIGIUS JUNGBLUT, JACK KANDLBINDER - DER MÜNCHEN-KRIMI und DIE UNHEIMLICHEN FÄLLE DES EDGAR WALLACE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CHRISTIAN DÖRGE
MÜNCHNER MÖRDER-
WEIHNACHT
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Autor
MÜNCHNER MÖRDER-WEIHNACHT
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Impressum
Copyright © 2022 by Christian Dörge/Signum-Verlag.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
München, im Dezember 1969:
Spät am Abend kommt Franzi Meerapfel, eine wunderschöne junge Frau, der das Schicksal übel mitgespielt hat, ins Hotel Erdinger Hof, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen versuchen zwei finster aussehende Kerle, Franzi gewaltsam aus dem Hotel zu entführen, was Geschäftsführer August Wittelsbacher und der Portier Alois Ritter nur mit allergrößter Mühe verhindern können.
Noch am selben Abend wird Franzi in einem zwielichtigen Lokal am Starnberger See ermordet aufgefunden. Und in diesen Fall sind hochrangige Politiker und korrupte Polizisten ebenso verwickelt wie der brutale Gangsterboss Max Angelus...
Münchner Mörder-Weihnacht ist ein ebenso spannender wie nostalgischer Kriminal-Roman um Mord, Korruption und Erpressung aus der FedervonChristian Dörge, Autor u. a. der Krimi-Serien Ein Fall für Remigius Jungblut, Jack Kandlbinder - Der München Krimi und Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace.
Der Autor
Christian Dörge, Jahrgang 1969.
Schriftsteller, Dramatiker, Musiker, Theater-Schauspieler und -Regisseur.
Erste Veröffentlichungen 1988 und 1989: Phenomena (Roman), Opera (Texte).
Von 1989 bis 1993 Leiter der Theatergruppe Orphée-Dramatiques und Inszenierung
eigener Werke, u.a. Eine Selbstspiegelung des Poeten (1990), Das Testament des Orpheus (1990), Das Gefängnis (1992) und Hamlet-Monologe (2014).
1988 bis 2018: Diverse Veröffentlichungen in Anthologien und Literatur-Periodika.
Veröffentlichung der Textsammlungen Automatik (1991) sowie Gift und Lichter von Paris (beide 1993).
Seit 1992 erfolgreich als Komponist und Sänger seiner Projekte Syria und Borgia Disco sowie als Spoken Words-Artist im Rahmen zahlreicher Literatur-Vertonungen; Veröffentlichung von über 60 Alben, u.a. Ozymandias Of Egypt (1994), Marrakesh Night Market (1995), Antiphon (1996), A Gift From Culture (1996), Metroland (1999), Slow Night (2003), Sixties Alien Love Story (2010), American Gothic (2011), Flower Mercy Needle Chain (2011), Analog (2010), Apotheosis (2011), Tristana 9212 (2012), On Glass (2014), The Sound Of Snow (2015), American Life (2015), Cyberpunk (2016), Ghost Of A Bad Idea – The Very Best Of Christian Dörge (2017).
Rückkehr zur Literatur im Jahr 2013: Veröffentlichung der Theaterstücke Hamlet-Monologe und Macbeth-Monologe (beide 2015) und von Kopernikus 8818 – Eine Werkausgabe (2019), einer ersten umfangreichen Werkschau seiner experimentelleren Arbeiten.
2021 veröffentlicht Christian Dörge mehrere Kriminal-Romane und beginnt drei Roman-Serien: Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace, Ein Fall für Remigius Jungblut und Friesland.
Künstler-Homepage: www.christiandoerge.de
MÜNCHNER MÖRDER-WEIHNACHT
Die Hauptpersonen dieses Romans
August 'Gustl' Wittelsbacher: Geschäftsführer im Hotel Erdinger Hof und Amateur-Detektiv.
Fidelius Brock: Besitzer des Hotels Erdinger Hof und Amateur-Detektiv.
Rupert Wolfskeel: Kommissar bei der Polizei von Starnberg und Murnau..
Franzi Meerapfel: eine junge Frau aus Feldmoching.
Ralph Meerapfel: ihr Vater.
Anne Meerapfel: ihre Mutter.
Marlene Brunner: Bedienung und Geschäftsführerin im Starnberger Seekrug.
Max Angelus: ein undurchsichtiger Geschäftsmann.
Nadine Kraemer: eine Freundin von Franzi Meerapfel.
Leo Urbach: Staatsanwalt.
Walburga Zirckl: Gustl Wittelsbachers Freundin.
Hansi Pirsch: Nachtportier im Erdinger Hof.
Alois Ritter: Tagportier im Erdinger Hof.
Dieser Roman spielt 1969 in München, Starnberg und in Murnau.
Erstes Kapitel
Franzi Meerapfels Haar hatte die Farbe reifen Weizens, und es schmiegte sich in üppigen Wellen um ihren Kopf. Ihre Augen waren himmelblau, ihre Haut weiß wie Milch. Sie war das hübscheste Mädchen von ganz München, und zweifellos eines der erfreulichsten. Ich stand am Empfang des Hotels Erdinger Hof und dachte darüber nach, dass es ziemliche Mühe kosten würde, sich nicht in Franzi Meerapfel zu verlieben.
Sie war aber nicht nur das hübscheste, sondern auch eines der traurigsten Mädchen in unserer Stadt, und keiner der Burschen, die sich bisher in sie verliebt hatten, hatte auch nur den geringsten Erfolg gehabt. Denn Franzis Verlobter, Georg Enzinger, war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und Franzi hatte ihn noch immer nicht vergessen. Sie war jetzt sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahre alt, und die Leute in der Stadt machten sich Gedanken, ob sie sich ihrem Kummer hingeben würde, bis sie eine alte Jungfer wäre, oder ob es Leo Urbach, dem jungen und begabten Stellvertretenden Staatsanwalt und einzigen Mann, mit dem Franzi ausging, sofern sie überhaupt noch ausging, gelingen würde, sie zum Altar zu führen.
Ich war überrascht, sie jetzt, an diesem Abend im Dezember, zu sehen, und noch mehr überrascht, als sie sagte:
»Ich möchte bitte ein Zimmer für heute Nacht, Gustl.«
Franzi hatte ein eigenes nettes Zuhause bei ihren Eltern, die in Feldmoching ein Futtermittelgeschäft betrieben.
Ich starrte sie an. Sie lächelte ein wenig, und ihr Atem wehte zu mir herüber. Er roch stark nach Alkohol. Sie wandte sich ab und ging quer durch die Hotelhalle zu einem Sessel, in den sie sich sinken ließ. Sie war nicht sehr gerade gegangen. Ich folgte ihr und setzte mich neben sie.
»Sind Sie nicht auch der Meinung, Gustl«, sagte sie, »dass dies nicht ganz die richtige Verfassung ist, um nach Hause zu gehen?«
Ich blickte auf meine Armbanduhr. Es war zwei Uhr nachts.
»Ist es wirklich besser, die Nacht in einem Hotel zu verbringen, als mit einem kleinen Schwips heimzugehen?«, fragte ich sie.
»Ich werde meinen Eltern sagen, dass ich bei einer Freundin geblieben bin. Sie sind zwar sehr tolerant, aber für sie bin ich immer noch ein kleines Mädchen. Sie machen sich Sorgen.«
Ich nahm einen Anmeldeschein vom Empfangspult und reichte ihn ihr. Sie gab ihn mir sofort zurück.
»Schon gut, Franzi«, sagte ich. »Lassen wir's.«
»Danke, Gustl.«
Es gibt alle möglichen Gründe, warum sich die Menschen einen antrinken. Ich selbst habe es auch schon getan und nehme es niemandem übel. Falls Franzi irgendein Kummer plagte, den sie zu ertränken versuchte, dann war das ihre Privatangelegenheit. Nur hatte ich Franzi noch nie zuvor in diesem Zustand gesehen.
Da saß sie, im Sessel zusammengesunken, die Hände um ihre kleine blau-weiße Handtasche gekrampft, die schönen blauen Augen geschlossen, während ich zum Empfang zurückging, eine freie Nummer fand und den Schlüssel abnahm. Dann stand sie auf und folgte mir in den ersten Stock zum Zimmer 214 hinten im Flur. Ich öffnete ihr das Fenster, kontrollierte die Bettwäsche und erbot mich, ihr kaltes Mineralwasser zu bringen.
Franzi saß auf der Bettkante und hielt sich mit beiden Händen den Kopf.
»Haben Sie irgendwas, das Sie ins Wasser tun könnten, Gustl?«, fragte sie.
»Vielleicht... habe ich etwas, ja.«
Sie lachte kurz auf, ein freudloses Lachen. »Finden Sie, ich hab’ schon genug? Kann sein! Aber noch einer könnte mir helfen einzuschlafen. Wenn ich Glück habe...«
Ich ging hinunter und mixte ihr einen Whisky-Soda, nicht allzu stark, und als ich zurückkam, lag sie auf dem Bett und starrte an die Decke. Nach einer Weile richtete sie sich auf und begann zu trinken. Die Art und Weise, wie ihre Augen über den Rand des Glases schauten, gefiel mir nicht, und so wartete ich, bis sie ausgetrunken hatte. Sie stellte das Glas auf den Nachttisch. Ich nahm es beiseite.
»Möchten Sie noch einen?«
»Nein, Gustl.«
Ich stellte das Glas wieder auf den Tisch, wandte mich um und wollte an ihr vorbeigehen. Aber sie streckte die Hand aus, fasste die meine und sagte: »Gustl!«, und der eigenartige Ton ihrer Stimme verriet Angst.
»Gustl«, sagte sie, »was tun Sie, wenn Sie sich fürchten? So sehr fürchten, dass Sie davonlaufen möchten, und wenn Sie wissen, es hat keinen Zweck? Und Sie können niemandem davon erzählen? Was tun Sie dann? Wie können Sie damit leben?«
Sie hielt meine Hand fest, ihre Finger zuckten. Ich glaube, sie merkte gar nicht mal, dass ich sie hielt.
Ich setzte mich neben sie auf den Bettrand.
»Was ist denn los, Franzi? Wo haben Sie denn so mächtig getankt?«
»Im Seekrug«, sagte sie. »In Starnberg.«
»Was ist passiert?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann darüber nicht sprechen. Das einzige, was ich tun konnte, war trinken. Ich habe getrunken – vor ein paar Jahren – als Georg –, aber ich glaubte, ich hätte es mir abgewöhnt. Damals half es. Ich dachte, es würde auch jetzt helfen.«
»Sie brauchen nicht darüber zu reden, wenn Sie nicht wollen, aber vielleicht würde es Ihnen guttun. Möchten Sie es mit Fidelius besprechen?«
Wieder versuchte sie zu lächeln. Es gelang ihr nicht.
»Nichts für ungut, Gustl«, seufzte sie, »aber ich glaube, wenn ich überhaupt darüber sprechen könnte, dann eher mit Fidelius Brock als mit sonst jemandem.«
»Würden Sie sich nicht besser fühlen, wenn Sie heimgingen?«
»Nein. Ich muss das mit mir allein abmachen.« Sie blickte mir ins Gesicht. »Machen Sie sich keine Sorgen, Gustl. Ich werde nichts tun – keine Verzweiflungstat, wie man so sagt. Jedenfalls nicht heute Nacht.«
Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte, und so blieb ich einfach sitzen.
»Sind Sie je im Seekrug gewesen, Gustl?«
»Noch nicht. Aber ich hörte, es wurde kürzlich von Grund auf renoviert, nicht wahr?«
»Oh, ja, es ist fast wie neu. Es ist schon ein tolles Lokal – und so reizende Leute. Sie müssen es irgendwann mal selbst ausprobieren. Laden Sie Walburga dorthin zum Abendessen ein. Es ist nicht allzu teuer. Sie gießen die Gläser nicht sehr voll, aber man kann ja immer einen Doppelten bestellen.«
Vielleicht tat es ihr gut, über irgendetwas zu plaudern, auch wenn es nichts Wichtiges war. Ich ließ sie reden.
Der Seekrug ein Strandcafé, das bereits in den 20er Jahren am Starnberger See eröffnet worden war. Dieser Seekrug, so hätte ich unlängst noch vermutet, hatte sich irgendein Kerl aufschwatzen lassen, und sobald er herausfand, wie schlecht das Geschäft ging, würde er zumachen und das Weite suchen. Aber heute vermute ich, dass der Laden vielleicht doch besser ging, als ich zunächst gedacht hatte. So kann man sich irren.
»Na gut, Gustl«, sagte Franzi schließlich. »Ich will ins Bett. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Wegen nichts und wieder nichts.«
»Gute Nacht, Franzi. Wenn ich irgendetwas...«
Als ich an der Tür war, flüsterte sie: »Gustl...«
»Ja?«
»Ich bin den Seekrug ziemlich übereilt verlassen. Es kann sein, dass jemand kommt und nach mir fragt. Würden Sie dann sagen – ich sei nicht hier?«
»Klar, Franzi! Machen Sie sich keine Gedanken.«
»Gute Nacht, Gustl.«
Sie sagte das in einem Ton, als ob sie wünschte, dass ich nicht ginge. Aber es wäre unangemessen, wenn ich bleiben würde.
»Danke, Gustl«, sagte sie. »Danke dafür, dass Sie in einer schmutzigen Welt ein netter Kerl geblieben sind.«
Ich ging hinaus und versicherte mich, dass der Schlüssel innen steckte. Eine Minute stand ich da und horchte, dann ging ich zurück in die Halle und ließ mich auf eines der Sofas fallen. Unser Nachtportier, Hansi Pirsch, hatte angerufen und über seinen Ischias geklagt, daher musste ich die Nacht aufbleiben und auf das Hotel aufpassen.
Es gab nicht viel aufzupassen. Der allgemeine Geschäftsrückgang hatte auch München nicht verschont. Es waren zwar noch immer Handlungsreisende unterwegs, aber sie fuhren jetzt längere Strecken, und manche Nacht waren wir nur halb belegt. Auch im Speisesaal war weniger los, und in den letzten paar Monaten hatten wir nicht mehr als die Unkosten hereinbekommen, und ein wenig Taschengeld, das wir für gute Zwecke spenden konnten. Ich bekam mein Gehalt immer, aber Fidelius Brock hätte auch dann dafür gesorgt, wenn wir nicht mal so viel eingenommen hätten. Er betrieb das Hotel, weil München der Ort war, wo er seit jeher gelebt hatte; und vermutlich würde er die Stadt niemals verlassen.
Es hatte den ganzen Tag über hin und wieder mal geschneit. Jetzt schneite es stärker; ich stand auf und ging ans große Fenster, um hinauszuschauen.
Ein Auto kam langsam die Glückburger Straße herunter, bog in die Brodersenstraße und parkte an der Kurve gegenüber dem Hoteleingang. Zwei Männer saßen darin. Ich konnte ihre Gesichter nicht erkennen, doch ich konnte sehen, wie ihre Zigaretten im Dunkel glühten und den Rand ihrer Hüte beleuchteten. Am Nummernschild konnte ich sehen, dass der Wagen aus Frankfurt stammte.
Sie stiegen nicht sofort aus. Sie saßen da und rauchten. Die herrlich weißen Schneeflocken tanzten in den Lichtkegeln ihrer Scheinwerfer. Dann erloschen die Scheinwerfer, und der Schnee wurde unsichtbar.
Einer der Männer stieg aus dem Wagen, blieb an der Kurve stehen und sah zum Hotel herüber. Der andere stieg eine Minute später aus, und so blieben beide stehen. Ich sah jetzt ihre Gesichter im gelben Licht der Laterne. Alles an ihnen deutete auf Großstadt und auf Gangster-Organisation. Es gibt zweifellos Hunderte von solchen Organisationen. Und es gibt Tausende von Kerlen wie diese, die in solche Dinge verwickelt sind.
Ich überlegte eine Minute lang, dann ging ich hinauf in den ersten Stock, den Flur entlang, bis zum Zimmer 214. Vorsichtig drehte ich am Knauf. Die Tür war verschlossen, und an der Art, wie sie zublieb, konnte ich erkennen, dass sie das Schnappschloss von innen zugedreht hatte.
Das war also in Ordnung.
Ich ging die Treppe hinunter, und die beiden Knaben standen jetzt nicht mehr vor dem Hotel, sondern am Empfangspult, die Ellbogen aufgestützt, und warteten.
Zweites Kapitel
Ich ging hinter das Pult und bemühte mich, wie der Geschäftsführer eines Hotels auszusehen. Sie bliesen mir ihren Zigarettenrauch leicht ins Gesicht, zufällig natürlich und ohne Absicht.
»Ein nettes Doppelzimmer«, sagte einer von ihnen, »für die Nacht.«
Irgendetwas in mir sagte unaufhörlich: Nein – und wieder: Nein.
»Ich bedaure«, sagte ich. »Wir sind ausgebucht.«
Er lachte leise vor sich hin und blickte seinen Kumpan an. »Ausgebucht«, sagte er.
Er hatte ein breites Gesicht mit großen ausdruckslosen Augen von grauer Farbe. Sein Gesicht war ebenfalls grau, mit Pockennarben am Kinn. Das Kinn war voller Buckel, als ob es viele Male mit einem Hammer bearbeitet worden wäre. Eine blasse Narbe lief vom äußeren Winkel seines linken Auges hinauf zur Schläfe. Sie gab ihm einen spöttischen Gesichtsausdruck.
»Nimm einen Schlüssel, Doc«, sagte er zu seinem Kumpel, »irgendeinen!«
Der Mann, den er Doc genannt hatte, kam um das Pult herum und sah auf die Tafel, die ich dort hängen habe. An der Tafel befinden sich Haken; und ich hänge die Schlüssel an die Haken, sofern Zimmer frei sind. Wenn ich ein Zimmer vermiete, nehme ich den Schlüssel ab und gebe ihn dem Gast. Wenn es zu einem Zimmer zwei Schlüssel gibt, lege ich den zweiten ins Schubfach. Die Schlüssel, die jetzt an der Tafel hingen, gehörten alle zu freien Zimmern, und dieser Doc griff nach einem und hob ihn vom Haken herunter.
Ich bin auch stur. Ich werde dafür bezahlt, dass ich stur bin. Ich schlug ihn auf das Handgelenk, hart, mit der Kante der rechten Hand, und der Schlüssel fiel klirrend zu Boden. Doc blickte erstaunt zu mir auf.
Dann zog der andere, der mit dem Narbengesicht, die Hand unter dem Pult hervor und hielt einen kleinen blauen Revolver darin. Seine Hand war so groß, dass ich nur die Spitze des Laufes sehen konnte. Sie zeigte auf meinen Gürtel, genau dahin, wo sich die Schließe befand.
Ich legte die Hände flach auf das Pult. Doc stand da, halb gebückt, mit nichtssagender Visage, dann streckte er die Hand aus und hob den Schlüssel auf.
»Ist das ein nettes Zimmer?«, fragte er. »Mit Dusche und so?«
»Ein sehr nettes Zimmer«, sagte ich. »Fünfzig Mark.«
Er griff in die Tasche. Er sah aus, wie er hieß, mager, ernst, ruhig, kein schlecht aussehender Kerl. Nur seine Augen waren flach und grau wie die Augen des anderen. Er zog ein paar Scheine aus der Tasche und ließ sie auf das Pult flattern. Der Bursche mit dem Revolver lachte leise.
»Vielleicht glaubte unser Freund, wir würden dafür nicht bezahlen«, sagte er. »Geh nur zu, Doc. Ich werde warten.«
»Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen«, schlug ich vor und wollte hinter dem Pult hervorkommen.
»Er wird’s schon finden. Sie bleiben hier.«
Ich dachte unaufhörlich an Zimmer 214. Doc nahm den Schlüssel und ging zur Treppe. Ich stand da und horchte aufmerksam. Ich hörte, wie er die Treppe hinaufstieg und den Korridor im ersten Stock entlangging. Ich hörte ihn stehenbleiben, den Schlüssel ins Schloss stecken und die Tür öffnen. Mir war klar, dass es nicht Franzis Zimmer sein konnte, doch mir war auch klar, dass es dem ihren genau gegenüberlag, und ich schloss aus alledem, dass ich die Nacht über höllisch aufpassen musste.
Der andere Herr entfernte sich von meinem Pult, setzte sich in einen Sessel und nahm eine Zeitung. Er legte den kleinen blauen Revolver auf die Lehne des Sessels.
»Wollen Sie nicht auch schlafen?«, fragte ich.
»Nicht doch. Ich habe noch allerhand zu lesen.«
»Auf wen warten wir?«, fragte ich.
Er antwortete nicht. Er war in seine Zeitung vertieft.
Ich habe eine Waffe im Pult. Es wäre leicht gewesen, danach zu greifen. Aber einer der Hauptvorzüge eines Hotels wie des unseren ist Ruhe und Frieden, besonders morgens um vier. Schließlich hatten sie für das Zimmer bezahlt. Wenn dieser Trottel aufbleiben und die Zeitung lesen wollte, gab es dagegen keine Vorschriften.
Also ließ ich ihn dort sitzen.
Da gab es nur noch eine Kleinigkeit. Falls dieser kleine Revolver auf jemand anderen gerichtet werden sollte, wünschte ich, dass er keinen Schaden anrichtete.
Der Bursche war vielleicht nicht schläfrig, aber er gähnte auffallend häufig. Er las ein bisschen, ließ dann die Zeitung sinken, starrte vor sich hin und blinzelte. Dann vertiefte er sich erneut in seine Zeitung.
Um ihn in Sicherheit zu wiegen, legte ich den Kopf auf meine Arme auf den Tisch. Ich ließ ihn dort lange Zeit ruhen. Endlich hörte ich die Zeitung rutschen, rascheln und leicht zu Boden fallen. Ich ließ den Kopf noch eine Weile unten. Dann hob ich ihn und sah ihn an.
Er saß in den Sessel zurückgelehnt, den Hut tief in der Stirn, den Kopf nach hinten. Seine Augen waren offen und beobachteten mich. Ich gähnte, legte den Kopf wieder auf die Arme und wartete.
Wir spielten dieses kleine Versteckspielchen etwa fünfzehn Minuten lang, und schließlich gewann ich. Ich sah auf, und er war immer noch in der gleichen Haltung, nur waren diesmal die Augen zu und der Mund offen.
Ich wartete noch zehn Minuten, damit er richtig fest einschlafen konnte. Dann zog ich die Schuhe aus, stellte sie auf den Fußboden und glitt von meinem Hocker hinunter. Ich ging um das Pult herum, quer durch die Halle zu seinem Sessel und nahm seine Waffe. Sein Atem blies über meinen Handrücken.
Ich brachte die Waffe zum Pult zurück und entlud sie; die Patronen steckte ich in die Tasche. Dann brachte ich sie zurück und legte sie wieder auf die Sessellehne. Erneut ging ich zum Pult zurück, setzte mich und nahm meine Illustrierte zur Hand.
Kaum hatte mein Blutdruck wieder seinen normalen Stand erreicht, als sich die Tür zu unserer Suite öffnete und Fidelius Brock in die Halle trat. Ich hielt den Atem an, aber der Schläfer im Sessel schlief seelenruhig weiter. Fidelius trug seinen alten Flanellbademantel und ein Paar Strohpantoffeln. Er schlurfte in den Hauptkorridor und zurück zur Küche. Wie er da in seinen abgewetzten Kleidern dahinwatschelte, ein wenig gebeugt, die lange Nase weit nach vorn gestreckt, sah er aus wie ein alter Mann. In Wirklichkeit ist er gar nicht alt. Er ist ein Jahr jünger als ich, und ich bin noch nicht vierzig – noch lange nicht. Ich vermute, Fidelius ist einfach zu früh erwachsen geworden.
Ich hörte, wie in der Küche eine Tür geöffnet und geschlossen wurde, dann ein plätscherndes Geräusch, und ich glaube, er goss sich ein Glas Milch ein. Als er zurückkam, blieb er an der Tür der Suite stehen, blickte zuerst zu meinem schlafenden Freund hinüber und dann zu mir. Ich winkte ihm hineinzugehen und kletterte vom Hocker.
Fidelius ging ans Fenster zu seinem Gröbner Schaukelstuhl und setzte sich.
»Nur ein nervöser Strolch auf der Durchreise«, sagte ich. »War allerhand los heut früh. Franzi Meerapfel ist auch bei uns.«
»Ralph Meerapfels Tochter?«
»Stimmt! Sie kam vor ein paar Stunden. Sie war – beschwipst.«
»Wie beschwipst?«
»Sie konnte nicht mehr gerade gehen.«
»Hast du sie einen Test machen lassen?«
»Nicht, was du denkst. Franzi ist wegen irgendetwas aufgeregt. Ich glaube, sie hat große Sorgen.«
Nach einiger Zeit sagte Fidelius: »Arme Franzi. Ein so schönes Mädchen.«
»Ich hätte nie geahnt, dass du es bemerkt hast.«
Er hat eine gewisse Art, sich aufzurichten, ohne sich allzu stark zu bewegen.
»Die Tatsache, dass man kein Don Juan ist, August«, sagte er, »schließt die Würdigung weiblicher Schönheit nicht aus.«
Fidelius war einer der wenigen Menschen, die mich August nannten.
»Entschuldige!«, grinste ich.
Es folgte ein langes Schweigen. Wir waren allein, und alles war still. Kein Grund, warum ich nicht mit Fidelius über etwas reden sollte, das sowieso einmal zur Sprache kommen musste.
»Da wir gerade von Don Juans reden«, sagte ich, und Fidelius antwortete mit leiser Stimme, die wie aus weiter Ferne klang:
»Ja, August?«
Er wusste, was jetzt kam. Er wusste es ganz genau. Aber er ließ mich fortfahren und es aussprechen.
Wie jeder normale Mann, denkt Fidelius Brock von Zeit zu Zeit daran, sich eine Frau zu nehmen. Das ist gut und schön. Es gibt manches nette, hübsche Mädchen in München und Umgebung – Franzi Meerapfel zum Beispiel –, von denen jedes eine gute Frau für Fidelius abgeben könnte.
Er ist aber ausgesprochen schüchtern. Ganz gleich, wie hingerissen er von einer der hiesigen Damen sein mag, er hätte nie den Mut, es ihr zu sagen.
Was geschieht also? Er wird eine Art Postwurf-Don-Juan. Mit Bleistift oder Feder hat er eine Menge Mut, und er schreibt gern Briefe. Er schreibt an diese Einsame-Herzen-Vermittlungen. Sie wissen schon:
Einsam? Jeder normale Mensch sehnt sich nach einem verständnisvollen Gefährten. Wir haben eine erstklassige Liste kultivierter, sympathischer Damen und Herren...
Ja, und diesen Leute schreibt er.
Ich will damit nicht sagen, dass es nicht massenhaft feine, ehrbare, gutbetuchte Frauen gibt, die an diese Vermittlungen schreiben. Aber ich behaupte, dass die Aussicht, unter ihnen die richtige Ehefrau zu finden, eher gering ist.
Fidelius weiß, was ich davon halte, und im Stillen weiß er auch, dass ich recht habe. Er schwört jedes Mal, er würde es nie wieder tun. Nach einiger Zeit fällt er aber wieder um, und wir müssen alles von vorn durchmachen. Erst neulich hatte ich eine solche aus der Zeitung geschnittene Anzeige gefunden. Sie steckte in einem seiner Bücher und rutschte heraus, als ich das Buch vom Tisch nahm. Diesmal hoffte ich, ich könnte die Sache im Keim ersticken; mich rechtzeitig einschalten, ehe die große Liebe erblühte.
»Da wir gerade von Don Juans reden«, sagte ich, »bist du nicht wieder mal dabei, deine Seele dem Teufel zu verschreiben?«
Er betrachtete mich ernst. »Trotz deiner entsetzlich unpassenden Metapher«, murmelte er, »muss ich bekennen, dass ich weiß, was du meinst.«
»Wer ist es diesmal?«
Er unterzog sich nochmals der Prozedur des Sich-Aufrichtens.
»Dieses Mal führe ich eine freundschaftliche Korrespondenz mit einer Dame namens Martha. Martha de Lattre, eine Frau von Geschmack und spiritueller Gewandtheit. Ich finde dieses Fräulein de Lattre wahrhaft faszinierend. Durch einen seltsamen Zufall wohnt sie ganz nahe bei München, auf ihrem eigenen Hof bei Starnberg. Ich habe mich mit ihr für morgen zum Abendessen verabredet, das heißt, für heute Abend.«
Er schien entschlossen. Da er schon eine Verabredung getroffen hatte, konnte ich nicht mehr viel ausrichten.
»Wie sieht denn dieses Fräulein de Lattre aus?«
»Es trifft sich zufällig«, sagte Fidelius, »dass ich eine Fotografie von ihr in der Tasche habe. Möchtest du sie gern sehen?«
Sein Gesicht hatte einen verschlagenen Ausdruck, als er mir das Bild reichte. Sie müssen wissen, dass Fidelius während der ganzen Zeit, da er sich mit diesen einsamen Herzen abgab, noch nie an ein Weibsbild geraten war, das Sie oder ich zweimal anschauen würden. In den meisten Fällen hätte ich es – wenn ich rechtzeitig gewarnt worden wäre – schon beim ersten Mal vermieden, hinzusehen. Als er mir Martha de Lattres Bild reichte, hatte ich das Gefühl, dass er dachte: Diesmal habe ich eine, die sogar Gustl gefallen wird.
Auf den ersten Blick gefiel sie mir tatsächlich. Es war geradezu ein Schock. Eine sehr gut aussehende Frau. Um die Achtunddreißig, vielleicht Vierzig herum, dunkles Haar und tiefbraune Augen, ein angenehmes Gesicht. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht.
Dann schaute ich etwas genauer hin, und so nach und nach schwand der gute Eindruck.
»Schau mal!«, sagte ich. »Siehst du dieses Kleid mit den gepolsterten Schultern und dem langen Rock? 1947 war das der letzte Schrei. Siehst du die Frisur? Das gleiche Jahr. Dieses Bild, mein Freund, wurde vor mehr als zwanzig Jahren aufgenommen. Sie ist sechzig, wenn nicht älter.«
Fidelius sah bestürzt aus.
»Ich gieße nicht gern Wasser in deinen Wein«, beteuerte ich. »Aber du würdest dich ganz schön erschrecken, wenn ich dich nicht gewarnt hätte.«
Er antwortete etwas steif: »Ich weiß deine gute Absicht zu würdigen, August, aber wenn du nichts dagegen hast, behalte ich mir mein eigenes Urteil vor.«
»Klar!«, winkte ich ab. »Lass dir die Sache nicht durch mich vermiesen. Nur – halte die Augen offen. Unterschreibe kein Papier, das du nicht vorher gelesen hast!«
»Papier?«
Ich zuckte die Schultern: »Ist nur so ’ne Redensart.«
»Hervorragend! Gute Nacht, August. Wenn du draußen abgelöst werden willst, kann ich in der Halle genauso gut lesen wie hier.«
»Du könntest sogar unter Wasser lesen«, sagte ich, »mit verbundenen Augen.«
»Ein interessantes Problem«, murmelte er.
Die Schlafmütze in der Halle träumte immer noch. Der Kerl pennte einfach so weiter. Er wachte nicht einmal auf, als Alois Ritter, der Tagportier, um sechs Uhr zum Dienst erschien.
Alois' Zimmer liegt hinten neben der Küche. Er kam durch den rückwärtigen Korridor in die Halle, barfuß, die Schuhe in der Hand, und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Es gelang ihm nie, den Schlaf ganz herauszureiben. Er konnte in der Zeit eindösen, die ein Gast brauchte, um seinen Namen auf unseren Anmeldeschein zu kritzeln.
Ich instruierte ihn im Flüsterton. Ich holte mein eigenes Schießeisen unter dem Pult hervor und gab es ihm.
»Herr Capone dort«, sagte ich zu ihm, »wartet auf jemanden. Er hat ein Schießeisen. Wenn er aufwacht, behalte ihn im Auge, aber erschieß ihn nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss.«
Alois strich sich mit der Hand über das Gesicht. »Du kennst mich, Gustl«, brummte er. »Ich werde ihn bewachen wie ein Luchs.«
Ich ließ ihn dort und ging in unsere Suite, die Schuhe in der Hand. Fidelius hatte sein Schlafzimmer an einem Ende des Wohnzimmers, und meins lag gegenüber.