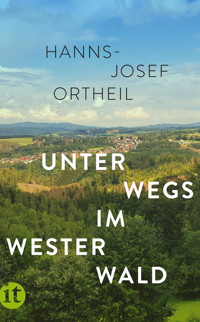9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil hat in seinen Romanen immer wieder von starken Momenten der Musik erzählt, in denen die handelnden Akteure sich hörend, spielend oder deutend mit großen Kompositionen beschäftigen. Mal handelt es sich um die Passionen Johann Sebastian Bachs, mal um die Klavierwerke Robert Schumanns oder Frédéric Chopins – besonders häufig aber um das Gesamtwerk von Wolfgang Amadeus Mozart, dem sich der ausgebildete Pianist Ortheil besonders ausführlich und intensiv gewidmet hat. In dieser Anthologie stellt er die wichtigsten Klangmomente seines stark von der Musik geprägten Lebens vor, erläutert die kulturellen Hintergründe seines lebenslangen Musikhörens und erzählt davon, wie die Musik sein Empfinden und Denken geformt und gestaltet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Hanns-Josef Ortheil hat in seinen Romanen immer wieder von starken Momenten der Musik erzählt, in denen die handelnden Akteure sich hörend, spielend oder deutend mit großen Kompositionen der verschiedensten Genres beschäftigen. Mal handelt es sich um die Passionen Johann Sebastian Bachs, mal um die Klavierwerke Robert Schumanns oder Frédéric Chopins – besonders häufig aber um das Gesamtwerk von Wolfgang Amadeus Mozart, dem sich der ausgebildete Pianist Ortheil besonders intensiv gewidmet hat. In dieser Anthologie gibt der Autor Einblick in sein von der Musik geprägtes Leben, erläutert die kulturellen Hintergründe und erzählt, wie die Musik sein Empfinden und Denken geformt hat.
Zum Autor
HANNS-JOSEF ORTHEIL wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, darunter mit dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und zuletzt dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
HANNS-JOSEF ORTHEIL
Musikmomente
Inhaltsverzeichnis
Musikmomente
Die Sekunde, die über mein Leben entschied
Frühes Klavierüben
Klavier üben und schreiben
Musik hören 1
Die russische Klavierlehrerin
Mozart spielen
Der Meister und sein Schüler
Musik hören 2
Unterwegs Mozart hören
Das große Vorspielen
Konzertieren
Kleines Vorspiel 1
Kleines Vorspiel 2
Kleines Vorspiel 3
Kleines Vorspiel 4
Die Stunden vor einem Konzert
In Konzerte gehen 1
In Konzerte gehen 2
In Konzerte gehen 3
Unerwartet Musik hören
Das Ende eines großen Traums
Der Musikschriftsteller 1
Der Musikschriftsteller 2
Musik beim Schreiben
Mein Leben mit Robert Schumann
Quellenverzeichnis
Musikmomente
Seit ich im Alter von vier Jahren zum ersten Mal an einem Klavier saß und einige Tasten anschlug, bin ich der Musik verfallen. Zunächst erhielt ich Klavierunterricht von meiner Mutter, später von anderen Lehrern, unter denen sich bald auch ein wahrer »Meister des Fachs« befand.
Er führte mich von den technischen Übungen hin zu den theoretischen Kenntnissen über Harmonie- und Kompositionslehre, mit deren Hilfe ich die gespielten Stücke noch besser verstand. Gleichzeitig geriet ich in einen Kreis von bereits erfahrenen Schülern, die sich alle paar Wochen zu einem internen Vorspiel im Haus des »Meisters« trafen.
Ein solcher Unterricht war von vornherein professionell und erlaubte in keinem Moment die vage Idee, ich könne das Klavierspiel in Zukunft auch als Hobby betreiben und mich anderen Interessen zuwenden. Seit ich der Musik verfallen war, habe ich auch nie an so etwas gedacht. Für meine Eltern und mich stand fest, dass ich ein Pianist werden und einmal auf großen Konzertbühnen auftreten würde.
Dagegen spielte die Schulausbildung in meinem Leben eher eine untergeordnete Rolle, ja, sie war manchmal sogar ausgesprochen lästig, weil sie mir viel von der dringend notwendigen Zeit für das Üben von Klavierstücken raubte. Vor allem der nachmittägliche Schulunterricht (Sport, Arbeitsgruppen etc.) störte oft, so dass ich mir immer neue Ausreden einfallen lassen musste, wenn ich ihm fernblieb. Die meisten Lehrer waren in dieser Hinsicht jedoch nachsichtig. Sie wussten, dass ich nicht aus Faulheit oder Trotz fehlte, sondern weil ich mit dem Wichtigsten beschäftigt war, das ich für mein Leben entdeckt hatte: Töne, Klänge, Akkorde, Melodien – das rauschhafte Spielen!
Unter Anleitung des »Meisterlehrers« kam es dann auch zu Teilnahmen an Wettbewerben und ersten öffentlichen Auftritten. Längst war ich so musikfixiert, dass ich beinahe den ganzen Tag mit Musik (selbst spielend oder auch hörend) verbrachte. Geriet ich auf den Wegen rund um die elterliche Wohnung oder unterwegs auf Reisen irgendwo zufällig an ein Klavier, konnte ich mich nicht von ihm trennen, ohne auf ihm gespielt zu haben. Der Musik verfallen zu sein, bedeutete, ganz in ihr, von ihr und für sie zu leben.
Natürlich führte das zu einer starken Abschottung gegenüber den anderen Themen der Welt und nicht zuletzt auch gegenüber anderen Menschen. Das stundenlange Üben am Tag isolierte, und wenn ich nicht übte, brachte ich nicht viel Interesse für anderes auf. Ich las Bücher über Musik, über Komponisten und bestimmte Stücke, und ich las daneben Bücher, die meine Klavierlehrer mir empfahlen, weil ich sie unbedingt kennen sollte. Auch diese Lektüren standen aber meist unter dem Vorzeichen der Musik oder führte zu ihr hin, so etwa, wenn ich den Stil eines großen Autors daraufhin las, wie »musikalisch« er war.
Um die Isolation zumindest versuchsweise zu bekämpfen, wurde meinen Eltern und mir der Besuch eines Musikinternats angeraten. Dort hätte ich Zeit genug, täglich zu üben, und dort wäre ich unter Gleichgesinnten und damit nicht mehr allein. Kurze Zeit habe ich in einem solchen Internat verbracht, es dort aber aus den verschiedensten Gründen nicht ausgehalten. Ich sehnte mich nach meinem früheren Zuhause und meinem Lehrer zurück – und so habe ich bis zum Abitur weiter intensiv Klavier geübt und erste Konzerte gegeben.
Dieser lange Anlauf hin zu einem Pianistenleben brach in Rom während eines Stipendienaufenthaltes zusammen. Ich litt von einem Tag auf den andern unter starken Sehnenscheidenentzündungen, die schließlich dazu führten, dass ich die Pianistenlaufbahn aufgeben musste. Danach habe ich mich einige Zeit von jeder Musik ferngehalten, schon das bloße Anhören löste Trauer und Panik aus, so dass ich selbst irgendwo im normalen Alltag die Flucht antrat, wenn mich bekannte Klänge und Melodien erreichten.
Die Metamorphose eines Pianisten in einen Schriftsteller ist mir erst in einem langen Prozess und auf nicht vorherseh- oder planbaren Wegen gelungen. Schriftsteller hatte ich nie werden wollen, obwohl ich seit der Kindheit viel notiert und geschrieben habe. Schritt für Schritt hat sich dann aber meine Begeisterung für die Musik in eine Begeisterung für das Schreiben über Musik und das »musikalische Schreiben« (tönend, klangvoll, rhythmisiert) verwandelt.
So habe ich Texte und Bücher über meine Lieblingskomponisten (Mozart und Schumann) und viele kürzere Texte vor allem über das Hören von Musik geschrieben. Mit der Zeit hat diese Arbeit das Üben am Klavier ersetzt, das ich jetzt nur noch spärlich, aber immer noch regelmäßig betreibe. Mein Interesse an der Musik hat sich verlagert, aber es ist im Grunde von derselben Besessenheit bestimmt wie in den frühsten Kinderzeiten.
Gehe ich in Konzerte, leben die alten Emphasen besonders stark auf. Ich höre von mir hochgeschätzte Pianistinnen (Martha Argerich, Hélène Grimaud) und andere Pianisten (Bruno Leonardo Gelber, Arcadi Volodos) und kann ihr jeweiliges Spiel mit der Version vergleichen, die ich selbst einem gerade gespielten Stück geben würde.
Am stärksten lebt die Nähe zur Musik aber während der Lesungen aus meinen Büchern weiter. Wie in pianistischen Zeiten betrete ich eine Bühne, nehme Kontakt mit den Zuhörern auf, lese und verbeuge mich hinterher, als hätte ich gerade ein Musikstück gespielt. In Wahrheit habe ich auch das Gefühl, genau das getan zu haben: Ich habe (ersatzweise) Musik gemacht, nicht so enthusiastisch und unbedingt wie früher, aber immerhin doch stark begeistert und von den eigenen Klängen getragen.
Hanns-Josef OrtheilStuttgart, Köln, Wissen an der Sieg, im Frühjahr 2017
Die Sekunde, die über mein Leben entschied
Ich war vier Jahre alt, als meine Eltern ein großes Geschenk in Form eines Klaviers erhielten. Wir wohnten damals, Mitte der Fünfziger Jahre, im ersten Stock eines Kölner Mietshauses. Einen Fernseher gab es noch nicht, und Radio wurde während des Tages nur selten gehört. Keine Nachrichten, nur ab und zu Musik, viel Klassik und manchmal französische Chansons, die meine Mutter besonders liebte.
Während des Krieges und in der Nachkriegszeit hatten meine Eltern vier Söhne verloren, und dieser schmerzliche Verlust hatte seine Spuren hinterlassen. Nach dem Tod des vierten Kindes war meine Mutter verstummt, und im Alter von etwas über drei Jahren hatte ich es ihr nachgetan und ebenfalls aufgehört zu sprechen.
So war es in unserer Kölner Wohnung oft gespenstisch still. Sie war eine abgeschottete Klause, in der es keine lebhafteren Szenen und kaum Besuche gab. Wollten wir mit Verwandten zusammen sein, fuhren wir aufs Land, wo die meisten von ihnen lebten. In unserer Wohnung aber blieben wir unter uns: Mutter, Vater und Sohn, ohne eine Ahnung, was wir gegen die Stille hätten ausrichten können.
Das Klavier, das meine Eltern von einem Bruder meiner Mutter als Geschenk erhielten, erregte vom ersten Moment seines Erscheinens an meine Aufmerksamkeit. Es war, als hätte ich geahnt, dass ich gerade mit diesem zunächst fremd und sonderbar erscheinenden Möbel zu tun bekommen würde. Als es von meiner Mutter zum ersten Mal gespielt wurde, empfand ich diesen Moment als den bis dahin schönsten meines Lebens. Was für ein Rauschen und Singen! Die ganze Wohnung lebte auf, als besäßen die Töne eine magische Kraft.
Von einem Moment auf den andern erlebte ich aber nicht nur klangvolle, selbstgespielte Musik, sondern nahm auch meine Mutter ganz anders wahr als bisher. Plötzlich war sie nicht mehr die stumme, ruhige Frau, die sich von den anderen Menschen weitgehend fernhielt. Indem sie Klavier spielte, begann sie zu sprechen, schöner als sie es mit Worten und Sätzen hätte tun können! Und wie gut sie spielte! Nicht wie eine Anfängerin, sondern wie eine Klavierspielerin, die bereits viel Zeit ihres Lebens an einem solchen Instrument verbracht hatte.
Dass die Rückkehr an ein Klavier sie überforderte und ihre große Trauer wiederbelebte – diesen Zusammenhang verstand ich damals noch nicht. Wohl aber spürte ich, dass ihr Klavierspiel sie an die Vergangenheit erinnerte. Irgendetwas Schlimmes, das die vielen Tränen auslöste, musste in diesen früheren Zeiten geschehen sein.
Nicht nur meine Mutter, auch ich selbst war als kleines, nichts ahnendes Kind von der gleichzeitigen Präsenz des Schönen und Schrecklichen überfordert. Hätte sie sich damals gänzlich vom Klavier abgewandt, wäre mein Leben anders verlaufen. Möglicherweise hätten meine Eltern das alte Instrument, das mit so vielen Erinnerungen an die Vergangenheit verbunden war, rasch wieder aus der Wohnung geschafft.
Die Sekunde, in der alles anders kam, war der Moment, in dem meine Mutter aus ihrer Verzweiflung und Trauer erwachte und auf mich, ihr übrig gebliebenes fünftes Kind, aufmerksam wurde. Es war der Moment, in dem sie instinktiv erkannte, dass dieses stumme Kind doch eine Zukunft (als »Kind am Klavier«) haben könnte. Deshalb ließ sie mich neben sich Platz nehmen. Das »Kind am Klavier« saß nun an ihrer Seite, und es spielte von da an (im wahrsten Sinne des Wortes) »um sein Leben«.
Gab der Glaube meinem kindlichen Leben ein Fundament und eine Bedeutung, so konnte er mir, was mein Stummsein betraf, nicht wirklich helfen. Manchmal stelle ich mir vor, wo ich wohl gelandet und was aus mir geworden wäre, wenn dieses Leben immer so weiter verlaufen wäre, wie ich es bisher beschrieben habe. Im Grunde war ich zu nichts anderem geeignet als dazu, ein ewiger Idiot zu werden, einer, der sich aus dem Staub machte, wenn die anderen ihm zu nahe kamen, einer, der niemals etwas begreifen und lernen würde von dem, was sie so leicht und selbstverständlich lernten.
Dass es nicht zu diesem Idiotendasein gekommen ist, verdanke ich einem nicht einmal geplanten Anstoß von außen, im Grunde war es sogar nur ein Zufall in Form einer Eingebung, die ein Bruder meiner Mutter plötzlich hatte. Dieser ältere Bruder lebte als Pfarrer in Essen, wo er eine große Pfarrei betreute und mit seinen imponierenden Predigten gut unterhielt.
Im Arbeitszimmer seines Pfarrhauses stand damals bereits seit einiger Zeit ein Klavier, das ihm seine Gemeinde in dem guten Glauben geschenkt hatte, er werde es täglich benutzen. Wahrscheinlich hatten die Gläubigen es sich wahrhaftig so ausgemalt: den allabendlich Bachs Choräle spielenden Herrn Pfarrer, der während des Klavierspiels über die nächsten Predigten nachdachte.
In späteren Jahren hat mir mein Onkel einmal erzählt, dass er ausgerechnet dieses Klavier immer gehasst habe. Es habe ihn an den Klavierunterricht erinnert und daran, dass seine Mutter (und damit meine Großmutter) von ihm immer ein gutes, ja sogar ein sehr gutes Klavierspiel erwartet habe. In Wirklichkeit sei er jedoch dafür gar nicht geeignet gewesen, es habe ihn nicht im Mindesten interessiert, vielmehr sei die eigentlich gute Klavierspielerin der Familie meine Mutter gewesen.
Um sich von der Last falscher Zumutungen zu befreien, hatte mein Onkel an einem Nachmittag beim Blick auf das ungespielt dastehende, lästige und zudem noch vorwurfsvoll dreinschauende Klavier plötzlich beschlossen, sich für immer von ihm zu trennen. Aus den Augen wollte er das Klavier haben, niemals mehr wollte er erinnert werden an all die Ermahnungen und all den Ärger, den er wegen seines schlechten Klavierspiels hatte ausstehen müssen. Und so hatte er den Pfarrgemeinderat seiner Pfarrei darüber informiert, dass er sein Arbeitszimmer anders und zeitgemäß und aus eigener Tasche neu möblieren wolle.
Das dunkelbraune Klavier war ein Klavier der Marke Sailer, es wurde an einem Vormittag von zwei Möbelpackerndas Treppenhaus hinauf in unsere Wohnung geschleppt und dort in unser Esszimmer geschoben. Ich habe das Aufsehen, das die Lieferung dieses Möbels machte, noch genau in Erinnerung. Die Hausnachbarn versammelten sich im Treppenhaus, und wir bekamen den üblichen Spott zu hören, ausgerechnet die Familie der Sprachlosen schaffte sich ein Klavier an, das war in den Augen unserer Nachbarn ein weiterer Anlass für deftige Witze.
Als die Möbelpacker verschwunden waren, machte sich meine Mutter daran, das Instrument gründlich zu reinigen. Sie säuberte das Holz mit einer hellen Tinktur und nahm sich dann Taste für Taste vor, bis das ganze Möbel glänzte und einen betäubenden Tinktur-Duft ausstrahlte. Ich saß neben ihr auf dem Boden und schaute ihr zu, ich hatte schon davon gehört, dass Mutter gut Klavier spielen könne, aber ich konnte mir so etwas nicht vorstellen, deshalb wartete ich geduldig auf den großen Moment.
Der aber ließ auf sich warten, denn nachdem das Instrument gereinigt worden war, klappte meine Mutter den Deckel zu, strich noch einmal prüfend mit der rechten Hand über das Holz und entfernte sich dann. Sie entfernte sich aber auf seltsame Art, denn sie ging langsam rückwärts, Schritt für Schritt, den Blick weiter prüfend und bewundernd auf das Instrument gerichtet, als wollte sie es nicht mehr aus den Augen lassen.
Ich stand langsam auf und folgte ihr, auch ich verließ das Esszimmer rückwärts, Schritt für Schritt, es muss ein merkwürdiger Anblick gewesen sein, wie Mutter und Sohn sich da bewegten, als entfernten sie sich von einer Hoheit oder Exzellenz, die nach den Strapazen einer langen Reise im Möbelwagen nun der Ruhe bedurfte.
Hatte ich erwartet, das Reinigen des Klaviers sei die Vorstufe zu Mutters Klavierspiel, so sah ich mich bald getäuscht. Jeden Tag wartete ich darauf, dass Mutter Ernst machen würde, doch sie tat nichts anderes als immer wieder den Deckel des Klaviers zu öffnen und die Tasten erneut so vorsichtig mit Tinktur zu säubern, dass kaum einmal ein richtiger Ton zu hören war.
Am liebsten hätte ich mich selbst an das Instrument gesetzt und seinen Klang ausprobiert, das aber wagte ich nicht, weil ich Mutter den Vortritt lassen wollte. Vater schließlich warf jeden Nachmittag nur einen kurzen Blick auf das Instrument, als wollte er nachschauen, ob es noch da sei und ob es ihm gut gehe. Es war, als sei ein Gast bei uns eingezogen, dem man eine allzu große Nähe noch nicht zumuten könne.
Ich selbst aber ließ das Klavier nicht mehr aus den Augen. Vom ersten Moment seines Erscheinens in unserer Wohnung an hatte ich zu ihm eine besondere Verbindung, die mit seinem seltsamen Status zu tun hatte. Zum einen schien es zu meiner Mutter und ihrer Vergangenheit zu gehören, zum anderen aber war es ein fremdes Wesen, das in unseren geschlossenen Kreis eingedrungen war und seinen eigentlichen Ort noch nicht gefunden hatte. Stattdessen stand es da wie eine kapriziöse Erscheinung, die man päppeln und pflegen musste, ohne dass es sich durch seinen Einsatz hätte bedanken können. Anscheinend wussten wir nichts anderes mit ihm anzufangen als es zu polieren und anzustarren, während es doch geradezu ideal dafür geeignet war, in unseren stummen Haushalt endlich etwas Leben und Klang zu bringen.
Mit der Zeit ärgerte mich das alles, ich wollte nicht länger warten, und ich begriff nicht, warum Mutter es mit dem Säubern und Polieren derart übertrieb. Der braune, meist geschlossene Kasten glänzte längst so strahlend, dass man sich darin spiegeln konnte. Manchmal robbte ich langsam auf dem Boden zu ihm heran und betastete die beiden kühlen Pedale, ich schob den Deckel etwas nach oben und richtete mich auf Knien in die Höhe, um die Parade der schwarz-weißen Tasten zu überblicken. Es roch ein wenig nach Kirche, nach Geheimnis, Holz und Weihrauch, ich schloss die Augen und sog diesen seltsamen Geruch ein, ja, wahrhaftig, irgendwie hatte dieser Geruch mit den Gottesdiensten zu tun, mit dem Rauschen der Orgel, den Flügen der Engel, dem Gesang der Gemeinde. Wie schön wäre es, diese Tasten anzuschlagen, welche Festlichkeit hätte so auch in unsere Wohnung einziehen können!
Der große Moment ereignete sich völlig unerwartet an einem frühen Abend, als ich mit Vater in der Küche saß. Wir blätterten und lasen in unseren Zeitungen und Zeitschriften, ich erinnere mich genau, dass es etwas zu dunkel war und nur ein diffus schwaches Oberlicht die Küche erhellte. Die Tür der Küche stand weit offen, als wir Mutter spielen hörten. Es war ein Perlen, ein allmählich immer lauter werdendes Hineinströmen eines großen Klangs in den Flur, als hätte eine starke Erscheinung die Mauern des Schweigens plötzlich durchbrochen und als dränge die lange ausgesperrte Außenwelt endlich triumphal und mächtig herein.
Heute weiß ich, dass ich einen stärkeren und schöneren Augenblick nie erlebt habe. Von einem Moment zum andern verwandelte sich alles: Jetzt spürte ich plötzlich das Leben, da war es, frisch, überwältigend, hinreißend, als wollte es einen mit Gewalt packen und von den bloßen Träumereien befreien! Es war wie eine Offenbarung, die mich sofort berauschte, ja, diese Musik war ein Sog, dem ich ohne jedes Nachdenken folgte, denn sie sang und erzählte von Freiheit und Glück und ließ mich alles Leiden mit einem Schlag vergessen.
Ich starrte Vater an und sah, wie entgeistert er war, sein Mund stand offen, und die Augen waren so weit geöffnet, als habe die Musik ihn geschockt, ich sah, wie er ungläubig den Kopf schüttelte, sich durch die Haare fuhr und einen Handrücken gegen die Lippen presste, er wusste nicht, was er tun sollte, dieses Klingen und Strömen schien ihn zu treffen, als müsste er sich dagegen wehren.
All das dauerte vier, fünf Minuten, in denen aus unserer Mietwohnung ein Schloss mit weiten Fluren und großen Sälen wurde, weit hinten, am Ende aller Gemächer und Gänge war der Festsaal, der blaue Salon, in dem uns ein Musikwunder aufspielte, eine geniale Spielerin aus der Fremde, aus Russland oder dem Orient, die eigens gekommen war, nur um uns zu verzaubern.
Wir blieben sitzen und rührten uns nicht, ich sah, wie Vater sich schließlich mit beiden Händen am Tisch festklammerte, ein wenig bekam ich es mit der Angst zu tun, so hilflos hatte ich ihn noch nicht gesehen. Stärker als dieses leicht flackernde Angstgefühl war aber das Glück, diese Musik erschien mir instinktiv wie ein Ausweg ins Freie und in jene schönere Welt, von der ich bisher nur in den Gottesdiensten eine schwache Ahnung erhalten hatte. War es schwer, so zu spielen? Oder gelang so etwas bereits nach einigem Üben?
Ich wollte hinüber ins Esszimmer schleichen, als alles zusammenbrach. Ich hörte noch einige Akkorde, dann laute, dissonante Schläge, schließlich einzelne Töne, mal sehr hoch, mal wie ein dröhnendes Pochen aus tiefsten Kellern, als hacke jemand voller Wut und außer Kontrolle auf das Instrument ein. Dann aber war es still, und wir hörten die Mutter schluchzen und krächzen, es hörte sich an wie ein wilder Schreckens-Gesang, als sei sie von Sinnen oder als habe sie sich verletzt. Seltsamerweise passte das alles aber noch zu den lauten Akkorden und Tönen, es klang wie eine zweite, andere Musik, wie eine Musik des Teufels, die sich jetzt unaufhaltsam ihren Weg durch die Engelsklänge bahnte, um sie zu vernichten.
Vater stand sofort auf und gab mir ein deutliches Zeichen, dass ich auf meinem Platz in der Küche bleiben solle, es war klar, ich sollte das Schreckliche nicht sehen, auf keinen Fall. Einen Moment kämpfte ich mit mir, ob ich wirklich in der Küche bleiben sollte, dann aber stand ich auf und ging vorsichtig in den Flur, wo ich mich an der Wand entlang bis zur Tür des Esszimmers drückte. Einen kurzen Blick wollte ich hineinwerfen, nur eine Sekunde, sie konnten mich doch nicht so ausschließen, nein, warum ließen sie mich denn einfach sitzen?
Nie habe ich etwas Schrecklicheres zu sehen bekommen. Mutter saß noch auf dem Klavierhocker, hatte ihn jedoch weit vom Klavier weggeschoben. Mit dem Kopf tief nach unten saß sie zusammengekrümmt und heftig weinend da, während Vater sie zu halten und an sich zu ziehen versuchte. Er bewegte sich nicht, sondern hielt nur ihre Schultern und presste sie unbeholfen, sein Gesicht war starr, wie versteinert, er mahlte mit den Zähnen und hielt die Lippen fest aufeinander gepresst, der Blick aber richtete sich nicht auf Mutter, sondern ging hoch hinauf an die Decke. Mit aller Macht versuchte er sich zu beherrschen, vor lauter Anstrengung traten die Adern an den Schläfen hervor, hellrote Rinnsale waren es, die das glatte Gesicht plötzlich furchten und rapide altern ließen. Warum schreit er bloß nicht?, dachte ich, er soll schreien, Vater, so schrei doch endlich, schrei, so laut du kannst!
Ich spürte, wie mir eiskalt wurde, ich konnte mich nicht mehr bewegen, aus einem Traum-Schloss war ich in einen düsteren Film geraten, ein fremder Horror hatte von meinen Eltern Besitz ergriffen und sie waren nun nicht mehr zu retten. Ich konnte nicht länger im Flur stehen bleiben und mich verstecken, ich musste ihnen jetzt helfen, deshalb atmete ich tief durch und ging dann auf sie zu, ohne irgendeine Idee zu haben, was ich hätte tun können. Dicht vor ihrer Zweiergruppe blieb ich stehen und ließ die Arme hängen, ich wagte es nicht, sie zu berühren, als könnte ich ihnen etwas antun oder als würde mich ihr Kummer ebenfalls derartig erschrecken wie sie.
Das Einzige, was mir vorläufig zu tun blieb, war, ganz in ihrer Nähe darauf zu warten, dass sich ihr Zustand besserte. Ich konnte Mutters Gesicht in der aufgelösten Haarflut nicht erkennen, daher blickte ich zu Vater hinauf und sah, dass seine versteinerte Miene sich wahrhaftig langsam wieder belebte. Er hatte es anscheinend geschafft, er war über den Berg, und dann sah ich, dass er sich wieder bewegte und Mutter mit einer kalkweißen Hand übers Haar strich, immer wieder. Dann aber tastete sich diese Hand bis zu seiner Hosentasche vor und zog aus ihr ein Taschentuch, zum Glück hatte Vater immer große Stoff-Taschentücher dabei, er benutzte sie ganz selten, steckte aber an jedem frühen Morgen ein neues ein. Seine Hand zitterte noch ein wenig, als er Mutter dieses Taschentuch hinhielt, direkt vor meinen Augen, nur wenige Zentimeter von mir entfernt, sah ich dieses zitternde Vater-Taschentuch, es war eine Geste, die mir einen Stich versetzte und mich zugleich so sehr rührte, dass ich fast auch zu weinen begonnen hätte. Dabei begriff ich nicht, was da vor mir geschah. Warum hatte Mutter so plötzlich zu weinen begonnen, und warum wurden meine Eltern von der Musik so gepackt? Sie hatten doch auch sonst immer Musik gehört, Musik aus dem Radio, Musik in der Kirche! Nie aber hatte ich sie bei derartigen Anlässen weinen sehen. Ich vermutete, es musste etwas mit der Vergangenheit zu tun haben, mit dieser dunklen, verfluchten Vergangenheit, irgendetwas Schlimmes musste da geschehen sein, das dem Klavierspiel der Mutter dieses furchtbare Ende gesetzt hatte.
Da Mutter aber das Taschentuch gar nicht sehen konnte, nahm ich es Vater aus der Hand und hielt es ihr hin, indem ich sie mit der Hand an der Seite berührte. Sie richtete sich ein wenig auf und fuhr sich mit der Rechten durchs Haar, jetzt erkannte ich ihr Gesicht wieder, die langen schwarzen Haare fielen zu beiden Seiten wie durcheinander geratene, verdrehte Lianen herab, es war, als erwachte sie aus einem hässlichen Traum, so benommen kam sie mir vor. Erleichtert sah ich, dass sie mich erkannte, ganz selbstverständlich nahm sie mir das Taschentuch ab und trocknete und rieb sich die Augen, und dann umarmte sie mich, als hätten wir uns nach einer langen Irrfahrt endlich wiedergefunden.
Vater aber verließ das Esszimmer und ging hinüber ins Bad. Ich hörte, wie er Wasser laufen ließ und aus der offenen, hohlen Hand trank. Bestimmt würde er sich jetzt auch mit der nassen Hand durchs Gesicht fahren und den Kopf daraufhin mit einem Handtuch massieren. Ich konnte mir das alles genau vorstellen, in dieser Hinsicht wusste ich wenigstens einmal Bescheid.
Mutter aber stand auf und schnäuzte sich noch ein letztes Mal, dann hielt sie einen Moment inne, als käme ihr ein guter Gedanke. Ich spürte förmlich, wie dieser Gedanke entstand und sich in ihr festsetzte. Er hatte mit ihrer Verzweiflung, dem Klavier und mit mir zu tun, es war die eine Sekunde, die über mein ganzes, weiteres Leben entschied.
Während sie sich nämlich vom Klavierhocker erhob, zog sie mich näher an sich heran, näher, immer näher. Sie brauchte mich nur noch ein wenig zu drehen und zu führen, damit ich begriff, was sie wollte. Sie wollte, dass ich mich auf den Hocker setzte und an ihrer Stelle dort Platz nahm. Ich setzte mich und ließ die Füße wie auf der Bank am Rhein baumeln, ich saß jetzt vor der schwarz-weißen Tastatur, die ich schon einige Male heimlich betrachtet hatte. Sollte ich jetzt darauf spielen, hatte sie das mit mir vor?
Die schwarz-weißen Tasten starrten mich an und schienen darauf zu warten, was nun geschehen würde. Ich wollte ein Zeichen geben, dass ich bereit war, deshalb legte ich meine beiden Hände mit weit ausgestreckten Fingern vorsichtig auf die Tastatur, ohne eine einzige Taste niederzudrücken. Wie Geisterhände lagen meine Hände nun auf den Tasten, da beugte meine Mutter sich über mich und schlug mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand eine einzelne Taste an, dreimal, viermal tippte sie auf das weiße Elfenbeinholz, dann war es still. Ich streckte den Zeigefinger meiner rechten Hand aus und schlug dieselbe Taste an, ich blickte mich kurz nach Mutter um, ja, sie war einverstanden damit, dass ich nun spielte. Und so begann ich, mit dem Zeigefinger der rechten Hand langsam von Taste zu Taste hinaufzuwandern, erst die weißen, dann nur die schwarzen, dann abwechselnd weiß und schwarz, dann von oben nach unten, erst nur die weißen, dann nur die schwarzen, dann abwechselnd weiß und schwarz, bis ich die ganze Tastatur durch hatte.
Ich hörte aber nicht auf, sondern machte mit dem Zeigefinger der linken Hand weiter, die weißen, die schwarzen, ich hatte alles andere aus dem Blick verloren, ich hörte und achtete auf nichts mehr als auf die Musik, es war meine Musik, ich machte Musik, ich hatte endlich etwas gefunden, mit dem ich mich bemerkbar machen konnte.
Frühes Klavierüben
Als junge Frau hatte meine Mutter (wie ich viel später erfuhr) einen kleinen Kreis von Kindern im Klavierspiel unterrichtet. Das hatte sie noch im Haus ihrer Eltern auf dem Land getan, und anscheinend hatte ihr dieser Unterricht Freude gemacht.
Auf diese frühen Erfahrungen konnte sie zurückgreifen, als sie mich zu unterrichten begann. Dass Noten längere Zeit dabei kaum eine Rolle spielten, halte ich heute für ein Glück. Noten und Notenhefte hätten mir anfänglich unnötig Angst machen können. Dann hätte ich sie womöglich als starre Gesetzestafeln verstanden, die einem bestimmte Gebote auferlegten: Spiele in diesem oder jenem Tempo! Spiele nur diese Noten und keine anderen!
Viel wichtiger als »fehlerfreies Spielen« war, dass ich die Tasten langsam nacheinander anschlug. So konnte ich den Tönen folgen und hörte sofort, wie sie in einem Musikstück harmonierten. Der Grundsatz, nur so schnell zu spielen, dass man jeden einzelnen Ton einer Komposition für sich wahrnahm und gleichsam »unter Kontrolle« hatte, war von großer Bedeutung. Denn so ein Spielen erzog zum genauen Hinhören und Unterscheiden.
Daneben kam mir das freie Improvisieren zugute. Im Allgemeinen mögen es Klavierlehrer nicht, wenn ihre noch unbedarften Schüler sich ohne Noten oder andere Vorgaben auf dem Klavier austoben. »Klimpere nie!« stand in manchen Übungsheften als goldene Regel auf den vordersten Seiten. Daran hat meine Mutter sich nicht gehalten, sondern mich so viel »klimpern« lassen, wie ich wollte.
Das hatte den guten Effekt, dass ich die gesamte Tastatur nach und nach erkundete und kennenlernte. Mal schlug ich eine Viertelstunde lang nur tiefe Basstöne an und kletterte mit den Fingern von einer schwarzen Taste zur andern, mal legte ich eine Hand quer auf einige weiße Tasten und horchte auf das Klanggemisch, das so entstand. Improvisieren war der Versuch, sich das Klavier mit allen mir damals zur Verfügung stehenden Mitteln anzueignen. Ich tastete es ab, schaute in seinen Körper und behandelte es wie ein Lebewesen, mit dem ich eine enge Freundschaft eingegangen war.
Ich habe meine Mutter erst sehr viel später wieder richtig spielen hören, zunächst aber wurde sie meine erste Klavierlehrerin. Man muss sich das vorstellen: Mutter und Sohn sitzen vor einem Klavier und erforschen, ohne miteinander sprechen zu können, gemeinsam das Instrument.
Es begann damit, dass der Deckel des dunkelbraunen Gehäuses aufgeklappt wurde. Von oben war die gesamte Mechanik zu sehen: die weißen Filzhämmer, die straff gespannten Saiten. Man konnte an ihnen zupfen oder die Filzhämmer auf die Saiten prallen lassen, man konnte mit allen fünf Fingern an ihnen entlang streichen und ein rauschendes Glissando erzeugen, man konnte aber auch mit beiden Händen wild in die Saiten greifen, um einige ekstatisch wirkende Tonfolgen zu erfinden. Das Innere des Klaviers ähnelte einem kleinen Orchester, das toben und rauschen und in dem man mit immer heißer werdenden Fingern eine freie Komposition spielen konnte.
Viel schwieriger waren dagegen die Fingerübungen, mit denen wir auch sofort begannen. In den ersten Unterrichts-Monaten lernte ich keine Noten, sondern spielte immer wieder die kurzen Phrasen und Melodien nach, die Mutter mir vorspielte. Zunächst waren es kleine Motive für die rechte, dann Bassübungen für die linke Hand, nach etwa einem Monat spielte ich mit beiden Händen zugleich.
Ich begriff sofort, dass es darum ging, sich die Motive und Phrasen gut einzuprägen und sie dann wieder und wieder zu spielen, zuerst im Zeitlupentempo, allmählich dann immer schneller, jedoch immer so, dass man die Bewegung der Finger noch kontrollieren konnte. Schluderte ich und spielte zu schnell, zog Mutter meine Hände abrupt von der Tastatur zurück und spielte die jeweilige Passage noch einmal in langsamem Tempo.
Es war ein hartes, große Geduld erforderndes Training, ja es war eine Art Sport, der darauf zielte, jeden einzelnen Finger zu kräftigen und ihm zu immer schnellerer und leichterer Bewegung zu verhelfen. Mit der Zeit hörte ich mit diesem Training auch in den Stunden abseits vom Klavier nicht mehr auf. Ich ertappte mich dabei, dass ich während des Zeitschriften-Blätterns die Finger bewegte, ja ich trommelte manchmal sogar während des Essens mit den Fingern rasch auf der Stelle, als wäre ich ununterbrochen im Einsatz.
Erst später begriff ich, dass Mutter ihrem Unterricht die Fingerübungen von Czerny zugrunde gelegt hatte. Aus diesem Lehrbuch stellte sie ein kleines Übungsprogramm zusammen, ohne sich an die von Czerny empfohlene Reihenfolge zu halten. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, diese Noten in den ersten Monaten des Unterrichts jemals gesehen zu haben, nein, es gab keine Noten, Mutter hielt sie vor mir verborgen, erst Jahre später entdeckte ich sie mit vielen Anstreichungen und eigens von Mutter zusammengestellten Listen.