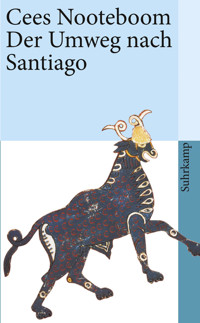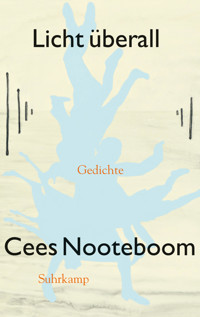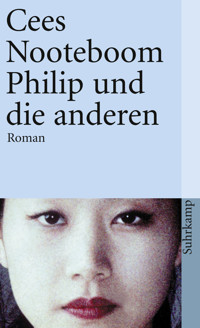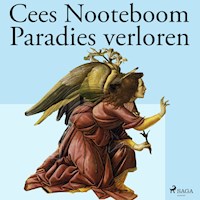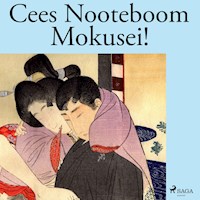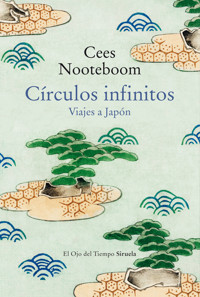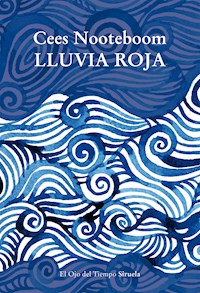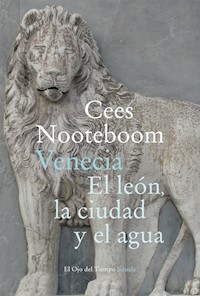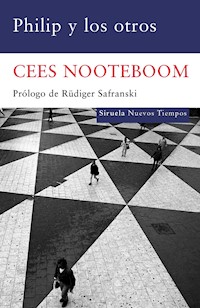7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachts, wenn die Füchse kommen – das sind die Momente, in denen man sich das eigene Leben nicht mehr zutraut, in denen die Angst vor der Dunkelheit überhandnimmt. Daß der Erzähler in schöner Regelmäßigkeit von diesen Füchsen, diesen Ängsten heimgesucht wird, meist morgens gegen fünf, das wissen wenige. Paula weiß es, die Begehrenswerte, die auf dem Cover der Vogue abgebildet war, die rätselhafte Paula. Sie ist der geheime Mittelpunkt der Clique, in der mit Leidenschaft Bakkarat gespielt und mit Verve Geld verloren wird. Daß sie mit dem Erzähler etwas ganz Besonderes verbunden hat, begreift er erst, als der Kasinobesuch in Deauville schon beschlossene Sache ist, als Paula auf die 23 setzt, als der große Hotelbrand von Saragossa längst Geschichte ist. Helle Melancholie und große Weisheit schwingen in den Meistererzählungen des großen niederländischen Autors. So gelassen wie leidenschaftlich schreibt Cees Nooteboom von Menschen, die nicht mehr da sind, und jenen, die sich ihrer erinnern. »Nootebooms Erinnerungen an all das Vergangene sind melancholisch und bleiben dennoch dem Leben zugewandt. « Claus-Ulrich Bielefeld, Focus »Still, dezent und von unglaublicher Wucht.« Marko Martin, Literarische Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Cees Nooteboom
Nachts kommen die Füchse
Erzählungen
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Suhrkamp
Die niederländische Ausgabe erschien 2009 unter dem Titel
’s Nachts komen de vossen
bei Bezige Bij, Amsterdam.
Umschlagabbildung: © Max Neumann
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags
sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,
auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73880-1
»You might have got yourself a story«, I said.
»Sure. But up here we’re just people.«
Raymond Chandler, The Lady in the Lake
Gondeln
Gondeln sind atavistisch, er wußte nicht mehr, wo er das gelesen hatte, und wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken, weil dann, so meinte er, etwas vom Pathos des Augenblicks verfliegen würde. Tiefstehende Sonne, die schwarze vogelartige Form einer Gondel im Nebel über der Lagune, die schweren Duckdalben wie eine vorrückende einsame Phalanx von Soldaten, die am unsichtbaren anderen Ufer verschwand zu einer Mission von Tod und Verderben, und er selbst hier an der Riva degli Schiavoni mit einem vergilbten, eingerissenen Foto in der Hand, wenn das kein Pathos war? Hier ungefähr hatte die Gondel angelegt, hier, an dieser Treppe oder der nächsten, noch dichter am halb im Wasser ruhenden Denkmal der standrechtlich erschossenen Partisanin, waren sie ausgestiegen. Es war ähnliches Wetter gewesen, das konnte man auf dem Foto noch erkennen. Sie hatten sich auf die Treppe gesetzt, und fast im gleichen Augenblick war ein junger Offizier gekommen, der ihnen sagte, diese Treppe habe frei zu bleiben für die Wasserschutzpolizei, und dabei auf ein Schild deutete. Dieses Schild mußte er jetzt also suchen, das konnte nicht schwer sein. Und wenn ich es finde, was dann? Dann stehe ich genau an derselben Stelle wie vor vierzig Jahren, und dann? Er zuckte mit den Achseln, als hätte jemand anders diese Frage gestellt. Dann also nichts, und genau darum, dachte er, ging es. Den Auftrag, etwas über die Ausstellung im Palazzo Grassi zu schreiben, hatte er angenommen, um diese eigenartige Pilgerfahrt anzutreten. Zu einem Schemen, nein, nicht einmal das, zu einer Abwesenheit. Die Treppe hatte er schnell gefunden, in ewigen Städten neigen die Dinge dazu, sich nicht zu verändern, nach wie vor legte die Wasserschutzpolizei hier an. Das Schild war noch da, an der Seitenmauer aus Backstein befestigt. Neu gepinselt, das denn doch. Er setzte sich auf die oberste Stufe. Der junge Offizier von damals mußte längst pensioniert sein, und auch wenn er in diesen vierzig Jahren nicht gealtert wäre, würde er den älteren Mann, der jetzt dort saß, nicht wiedererkennen. Das Foto war damals von einem Unbekannten gemacht worden, der sich ein Stück von ihnen entfernt, mit dem Rücken zur Lagune, an den Rand des Kais gestellt hatte. Ein Winkel von dreißig Grad, so daß der Dogenpalast in der Ferne noch drauf war. Er betrachtete das Foto und wunderte sich wie immer über das Trügerische daran. Nicht nur, daß ein Foto eine Tote abbilden konnte, es konnte einem auch eine ungültig gewordene Version der eigenen Person auftischen, einen nicht mehr erkennbaren Langhaarigen, der einst so perfekt ins damalige Bild gepaßt hatte, das diesem Foto das schal gewordene Aroma einer endgültig vergangenen Zeit gab. Daß man noch immer denselben Körper hatte, war das eigentliche Wunder. Aber natürlich war es nicht derselbe Körper. Sein Besitzer hatte noch immer denselben Namen, das war alles.
Was dieses Foto im Grunde sagen wollte, dachte er, mehr als Feststellung denn als Ausdruck von Tragik oder Selbstmitleid, war, daß auch für ihn allmählich die Zeit kam, daß auch er verschwinden mußte. Er hatte links von ihr gesessen, damals. Sie hatte den Kopf lachend zu dem unbekannten Fotografen erhoben, schnell noch das rote Haar etwas nach hinten geschoben und den Körper etwas zurückgebeugt, halb an die Seitenmauer der Treppe gelehnt, so daß das Schild nur zur Hälfte sichtbar war. Er blickte auf das sich leicht bewegende gräuliche Wasser am Fuße der Treppe. Wie erstaunlich, daß alles unverändert blieb! Das Wasser, die Form der Gondeln, die Marmorstufe, auf der er saß. Nur wir stehlen uns davon, dachte er, lassen die Kulisse unseres Lebens zurück. Er fuhr mit der Hand über die körnige steinerne Fläche neben sich, als wolle er ihre Abwesenheit fühlen. Daß alles, was man dabei denken konnte, ein Klischee war, wußte er selbst, nur hatte niemand diese Rätsel je gelöst. Unter Wirklichkeit und Vollkommenheit verstehe ich dasselbe, von wem dieser Satz stammte, wußte er ebenfalls. Ob Hegel die Situation, in der er sich befand, gemeint hatte, durfte bezweifelt werden, aber es schien doch zu stimmen. Er verspürte ein merkwürdiges Entzücken, weil die Dinge so waren, wie sie waren, weil man sie mit keinem einzigen Gedanken lösen konnte. Der Tod war etwas Natürliches, ging jedoch mit fast unzulässigen Formen von Kummer einher, die so groß waren, daß man am liebsten in ihnen verschwinden würde, um sich der vollkommenen Wirklichkeit des Rätsels hinzugeben.
Der Anfang war ganz einfach gewesen. Eine griechische Insel, das Haus von Freunden von Freunden, von ihnen arrangiert, weil es ihm nach seiner Scheidung schlechtging. Nicht gewöhnt, allein zu sein, ein Hunger nach allem, was weiblich war. Ein steinerner Spazierweg entlang dem Meer, auf dem all diese weiblichen Gestalten gingen oder schlenderten, die er gern angesprochen hätte, was er sich aber nicht traute, um nicht als Schwachkopf lachend abgewimmelt zu werden. Ankatzen nannte sein Freund Wintrop das. Das Wort war hübsch, aber er hatte es nie gekonnt. Wie lautete diese Gedichtzeile von Lucebert? Des Abends entlang weiblichen Schiffen ich schlendre. Das stimmte schon mal. Den Spazierweg hin und dann wieder zurück und dann noch einmal von vorn. Schlendern, bummeln, schauen. Hydra, Fischerboote, weiß in der sich verdunkelnden Nacht, sanft schaukelnd, beschienen vom Neonlicht der hohen Laternen am Kai. Schwalben, Zypressen, oder dachte er sich das jetzt aus? Gab es damals schon Neonlicht? Aber warum sollte seine Erinnerung stimmen müssen? Mach gelbes Lampenlicht daraus, hör eine Eule, sieh die dunklen Formen von Pinien. Das Meer bleibt das Meer und schwappt sanft an die Kaimauer. Alles andere ist austauschbar, das Arsenal, mit dem du die Erinnerung ausstaffierst.
Wie ein Schiff hatte sie nicht ausgesehen, als sie vorbeikam. Oder vielleicht doch, wie ein ganz leichtes mit nur einem kleinen Segel, das übers Wasser zu schweben scheint. Lächerlich mußte das gewesen sein, wie er plötzlich von der Kaimauer aufgestanden war und diese Handbewegung gemacht hatte wie ein Polizist, der den Verkehr stoppen will. Und genau das hatte er auch gesagt, STOP! Sogar jetzt empfand er noch Verlegenheit, obwohl sie später in Kalifornien, als alles lange vorbei gewesen war, oft darüber gelacht hatten. Sie war so erstaunt gewesen, daß sie sofort stehenblieb. Merkwürdigerweise wußte er nicht mehr, ob sie gleich an jenem ersten Abend mitgegangen war. Sie hatten lange in einer Kneipe im Hafen miteinander geredet. Amerikanerin, mit einem italienischen Namen. Sechzehn, achtzehn, er hatte es wissen wollen, aber nicht zu fragen gewagt. Schon da hatte er die Zeichen gesehen, mit denen sie Hände und Arme geschmückt hatte, Tierkreiszeichen, nicht tätowiert, wie man es heutzutage oft sah, sondern mit schwarzer Tinte auf diese braune Haut gemalt. Als er gefragt hatte, was das sei, hatte sie nur gesagt, oh, ich bin eine Hexe. Auch darüber hatten sie später gelacht, aber er besaß noch ihre Briefe aus jenen Tagen voller Geplapper über Zauberei und Verhexung, Schwärmerei, die, wie ihm schon bald klar wurde, nichts bedeutete, ihn aber doch erregt hatte. Es paßte zur Zeit, viel mehr aber noch zu diesem roten Haar, den schieferfarbenen Augen, der überraschend tiefen, ein wenig heiseren Stimme. In den Tagen danach hatte sie bei ihm in dem großen weißen Haus geschlafen. Bei ihm, aber nicht mit ihm. So lautete die Bedingung. Sie ließ sich mit abgewandtem Gesicht streicheln und sank dann auf beeindruckende Weise in Schlaf, mit der Abwesenheit eines Tiers, für das die Welt nicht mehr existiert. Er war sich ein wenig lächerlich und überflüssig vorgekommen, war aber gerührt gewesen über ihr Vertrauen. Lieber Gesellschaft als Liebe, etwas in der Art hatte er in sein Tagebuch geschrieben. Später hatte er dieses Tagebuch weggeworfen, was ihm jetzt leid tat – doch diesen Satz wußte er noch. Und ein paar Tage darauf war alles anders geworden. Vielleicht dachte er sich das jetzt aus, meinte sich jedoch zu erinnern, wie sie auf eines dieser merkwürdigen Zeichen deutete, die sie auch an anderen Stellen ihres Körpers trug, und etwas sagte wie: Der Augenblick ist jetzt gekommen. Etwas mit Planeten, alles, was er schon damals für Unsinn gehalten hatte. In der Liebe war sie gleichzeitig durchtrieben und kindlich gewesen, andere Wörter waren ihm dafür nicht eingefallen. Durchtrieben, das Wort hatte ihn nie befriedigt, es war das falsche, zielbewußt und berechnend vielleicht, aber auch das waren nicht die richtigen Wörter. Es hatte ihn erregt, weil sich durch das gewollt Kindliche etwas von einem verbotenen Spiel eingeschlichen hatte, als habe sie ihm im Grunde suggerieren wollen, er gehe mit einem Kind ins Bett, etwas, was er weder davor noch danach je so erlebt hatte.
Er ging zurück Richtung Stadt. Die Ausstellung von Piero della Francesca hatte ihn tief berührt. Weshalb er darin nun eine Parallele zu dieser Geschichte vor langer Zeit sehen mußte, wußte er selbst nicht, vielleicht einfach, weil sowohl der Maler wie die Erinnerung ihn jetzt beschäftigten, vielleicht auch, weil in diesen Gemälden etwas war, an das man nicht herankam, etwas, das mit diesen kurzen, gemeinsam verbrachten Wochen übereinstimmte. Man konnte nicht behaupten, daß sie geheimnisvoll war, diese Hexerei war purer Unsinn gewesen, doch die anwesende Abwesenheit von damals, neben ihm, ließ ihn jetzt an die hieratischen Gestalten in den Gemälden denken. Man stand davor, wollte mit aller Gewalt zu ihnen vordringen, aber es war eine Welt, zu der es keinen Zugang gab. Er hatte weder eine Ahnung, wie er seinen Essay schreiben, noch wie er mit seiner Erinnerung umgehen sollte.
Sie hatten einen Zug genommen, damals, quer durch Griechenland nach Jugoslawien. Nichts wußte er mehr davon, abgesehen von ärmlichen Hotelzimmern und einem Kranz roter Haare auf einem Kissen. Eine Nacht in Belgrad, eine Art Biergarten, in dem erregte Männer ihnen Slibowitz spendiert und die Gläser über die Schulter auf den Kies geworfen hatten, wo sie zersplitterten. So waren sie nach Venedig gekommen. In welchem Hotel sie abgestiegen waren, wußte er auch nicht mehr, aber immerhin noch, an welcher Stelle dieses Foto entstanden war. Er drehte sich um und ging wieder zurück. Eigentlich war es undenkbar, daß Menschen einfach aus einem Leben verschwanden. Hundert parallele Leben müßte man haben. Abschied auf dem großen Bahnhof, danach verstört herumtaumeln auf der Fondamenta Santa Lucia, plötzlich wieder allein, ein Mann in einer flanierenden Menge, der erlebt hatte, wie sich jemand wieder in der Welt auflöste, ein schmaler, dünner Arm aus einem Zugfenster, dann der Zug selbst, der über den Ponte della Ferrovia entschwand, ein viereckiges Ding mit Lichtern, und dann nichts mehr. Im Jetzt vierzig Jahre später ging er in sein Hotelzimmer zurück und blätterte im Ausstellungskatalog. Unsinn natürlich, eine Verbindung mit Piero della Francesca zu sehen. Was war sie gewesen? Ein Kind der Flower-Power-Zeit, und er aus Einsamkeit nur allzu bereit, sich zu verlieben und dem Geplapper über Planeten und Sterne zu lauschen, die ihrer Meinung nach in ihrer aller Leben eingriffen. Als ob sie nichts anderes zu tun hätten! Doch wenn ihre Stimme, nachts am Wasser, vor sich hin mäanderte über Saturn und Pluto, als seien es Lebewesen, die vom All aus die Fäden spannen, an denen entlang das Leben einer Siebzehnjährigen aus Mills Valley und das eines freiberuflichen Kunstjournalisten aus Amsterdam verlaufen würden, hatte er eine schwer zu bestimmende Verzauberung gespürt, die nicht durch ihre Worte ausgelöst wurde, sondern durch das Schiefergrau dieser Augen, das im Dunkel aufzuleuchten schien. Liebe war das Bedürfnis nach Liebe, soviel hatte er verstanden. Die Absichten einer Reihe unbelebter Gas- und Eiskugeln irgendwo im Universum, das war eine Geschichte, die Menschen sich selbst erzählten, um jetzt, da die anderen Märchen ungültig geworden waren, in Gottesnamen irgendwo dazuzugehören, wenn man das nicht ertrug, mußte man nicht Stop! sagen zu einer beliebigen Passantin. In seinem leeren Haus in Amsterdam hatte er dann auf die Briefe in der unästhetischen amerikanischen Beinahe-Kinderschrift gewartet, mit wieder dem halben Tierkreis am Rand und sizilianischen Zeichen zur Abwehrung des bösen Blicks, jetzt fragte er sich, was um Himmels willen er darauf geantwortet hatte. Wer als erster das Schreiben eingestellt hatte, daran erinnerte er sich nicht mehr, wohl aber an die aufgeregte Überraschung, als gut zwanzig Jahre später plötzlich wieder ein Brief in dieser unbeholfenen Handschrift gekommen war. Sie hatte seinen Essay über Jacoba van Heemskerk in einem Katalog über spirituelle Kunst gelesen, der eine Ausstellung in San Francisco begleitete. Bei ihr sei sehr viel passiert, schrieb sie. Heirat, Scheidung, zwei Söhne, und sie male Bilder, die vielleicht Ähnlichkeit mit denen Jacoba van Heemskerks hätten. Zwei Fotos hatte sie mitgeschickt, nebulöse Flächen von der Farbe, die seiner Erinnerung nach ihre Augen hatten, grau mit leuchtenden, schwebenden Flecken, Kunst für die Wände eines Meditationszentrums. Es sei ihr nicht gut ergangen, aber der Buddhismus habe ihr sehr geholfen. Es gebe ein Kloster bei ihr in der Nähe, das ihr viel Kraft schenke, wenn sie ihre Söhne nicht hätte, wäre sie da eingetreten. Sie habe noch oft an ihn gedacht, und es müsse doch so etwas wie Seelenverwandtschaft geben, wenn er über die Gemälde von Jacoba schreibe, schließlich kenne die in Amerika so gut wie niemand, doch für sie sei sie eine große Inspirationsquelle gewesen und vor allem auch Trost, denn in ihrem Leben seien schlimme Dinge passiert, mit denen sie ihn nicht langweilen wolle. Sie hoffe, daß der Brief ihn erreiche, und meine, ihr Besuch in dieser Ausstellung sei ein Zeichen gewesen. Denn sei es nicht eigenartig, daß Menschen einander in der Welt einfach verlieren könnten? Daß man nicht mehr wisse, ob jemand noch lebe, obwohl es, wie auch immer, doch eine gemeinsame Reise gegeben habe, eine Erfahrung, die man geteilt habe? Eigentlich sei sie noch ein Kind gewesen, damals, in einer Art Traumschlaf habe sie gelebt, mit diesem alten Haus auf Hydra und dieser langen Bahnfahrt durch die ausgetrockneten Landschaften und schließlich Venedig, das sie irgendwann einmal wiederzusehen hoffe. Sie habe wahrscheinlich viel Unsinn geredet in jenen Tagen, liebe Güte, aber er habe sie so respektiert, wie sie damals gewesen sei, dafür sei sie ihm dankbar, es hätte auch anders laufen können. Sie wisse nicht, ob er verstehe, was sie meine, aber sie wolle damit sagen, daß er sie nicht mißbraucht habe. Sie hoffe, ihm sei klar, daß sie nichts von ihm wolle, daß es aber doch ein Wunder sei, wenn man sich unter Milliarden von Menschen wiederfinde. Er brauche natürlich nicht zu antworten, darum gehe es nicht, obgleich sie gern wüßte, ob es ihm gutgehe.
Nicht besonders, wäre die richtige Antwort gewesen. Das würde er also nicht schreiben und auch nicht, daß der Essay über Jacoba van Heemskerk eine Auftragsarbeit gewesen war, daß er zwar Respekt vor ihren Werken hatte, sie aber eigentlich auch ein wenig wesenlos fand und daß er das erneute Interesse an ihr als Teil der allgemeinen Vagheit sah, die in den letzten Jahren von den Seelen Besitz ergriffen hatte und deren Vorbotin sie, die Briefschreiberin, im Grunde gewesen war. Farbe genug, mit vielleicht der gleichen Spannung wie bei Kandinsky, aber nicht die Geschichte, die er suchte. Diese Kunst war pure Reaktion auf das neunzehnte Jahrhundert gewesen, das ihm selbst so zuwider war. Statt dessen schrieb er in seinem Brief, er arbeite an einer Dissertation über Piero della Francesca. Ob sie diesen Maler kenne? Und ja, er freue sich, daß sie geschrieben habe. Wie es wohl wäre, wenn sie sich wiedersähen? Er habe noch immer das kleine Foto von ihr auf dem Poller an der Riva degli Schiavoni, habe er ihr das seinerzeit geschickt? Er wisse es nicht mehr. Und das mit dem neunzehnten Jahrhundert stimmte eigentlich auch nicht. Flaubert, Stendhal, Balzac, die waren selbst bereits die Reaktion auf die antike Trägheit gewesen, in der so viel Erwartung erstickt war, er brauchte sich nur die ersten Fotos jener Zeit anzusehen, die Bewegungslosigkeit dieser langen Belichtungszeiten, um zu wissen, daß er nie in diesem Vorhof des Modernismus hätte wohnen wollen. Dieses Foto! Mädchen auf einem Poller, so groß, daß ein ganzes Seeschiff daran hätte festmachen können. Ein hauchdünnes Kleid mit etwas Violettem darin, und darüber das ephemere Gesicht eines menschlichen Wesens, durch und durch wegzupustende Vergänglichkeit. Eine Madonna von Bellini, das hatte er wohlweislich nicht gesagt. Wer Kunstgeschichte studiert hat, muß jedem Vergleich mißtrauen. Und dennoch, auch ohne Kind war sie eine Madonna gewesen. Auch bei ihr ein Schatten auf der linken Gesichtsseite, der nichts Gutes verhieß, fast nach innen gerichtete Augen, die die künftige Tragödie des abgewandten Kindes auf ihrem Schoß schon hundertmal gesehen hatten, und dann das Kind selbst, ein uralter Philosoph, der wußte, daß die schützende Hand seiner Mutter in der Stunde seines Todes nichts zu bedeuten haben würde.
Bevor er ihren Brief zu Ende gelesen hatte, stand sein Entschluß fest. Er würde sie aufsuchen, und das hatte er auch getan. Fällt in die Rubrik sinnlose Exerzitien, hatte einer seiner Freunde gesagt, aber daran glaubte er nicht. Dinge mußten zu Ende geführt werden. Dazu gehörte eine Reise nach Amerika, eine Frau, die einen auf dem Flughafen in San Francisco erwartete, jemand, an dem man erkannte, wie alt man selbst geworden war. Menschen waren phantastisch, eigentlich müßten sie immerzu Preise bekommen. Dieser rasend schnelle Blick, mit dem sie sich gegenseitig binnen einer Sekunde taxiert hatten, ein inneres Foto von bestechender Schärfe, über das vorläufig nicht gesprochen würde. Falten um die Augen, das Haar noch immer mit dieser roten Glut, nun aber von einem Schleier überzogen, die Schrift der Zeit, und dadurch eine plötzliche Kollegialität, vielleicht sogar Gerührtheit. Mehr Liebe als damals, das wußte er sofort, und zwar eine, mit der er nichts anfangen würde, das wußte er genauso schnell. Die Verletzbarkeit war größer geworden. Ein Holzhaus, Vorstadt einer Vorstadt, Aquarelle aus der Provinz Rudolf Steiners, Kunst, die er nie gemocht hatte, Dinge, die er früher gesagt hätte und bei denen er jetzt mit einer Leichtigkeit lügen konnte, die ihn selbst wunderte. Du lebst noch immer in einer Traumwelt, hatte er gesagt, und sie war sich treu geblieben und behauptete mehr oder weniger, Saturn habe diese nebulösen Kleckse gemacht, eine Woche höchster Ekstase, Nacht um Nacht habe sie diese Kraft gespürt, als es vorbei gewesen sei, habe sie sich so leer gefühlt wie noch nie, leer, aber glücklich. Kurz danach habe sie diese Ausstellung gesehen und verstanden, es sei ein Zeichen, daß sie ihm schreiben müsse. Aber sie hätte nie gedacht, daß er kommen würde.