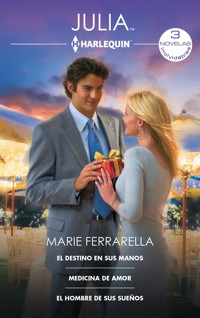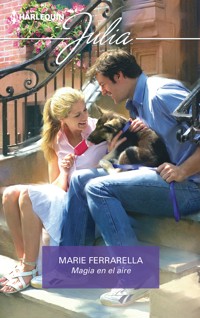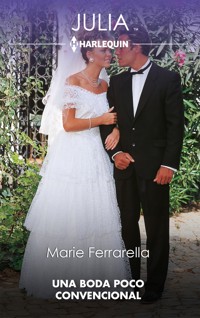2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
Der Traum von der großen Liebe ist nach dem Tod ihres Verlobten vorbei, davon ist die hübsche Melanie überzeugt. Bis Dr. Mitchell Stewart ehrenamtlicher Mitarbeiter in ihrem Waisenhaus wird. Nach tausend Tränen erwacht in Melanie ein Gefühl, das sie für immer verloren glaubte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
IMPRESSUM
Schenk mir tausend Träume erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2016 by Marie Rydzynski-Ferrarella Originaltitel: „Dr. Forget-Me-Not“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe BIANCA EXTRA, Band 79 Übersetzung: Meike Stewen
Umschlagsmotive: Harlequin Books S.A., Getty Images / Roman Rybalko
Veröffentlicht im ePub Format in 06/2023
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751521994
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
PROLOG
Maizie Connors hatte gleich geahnt, dass ihre langjährige Freundin Charlotte Stewart etwas auf dem Herzen hatte. Charlotte hatte die Maklerin morgens angerufen und sie gebeten, sich mit ihr zum Lunch zu treffen: Sie bräuchte einen professionellen Rat, waren ihre Worte gewesen. Erst abschließend schob sie ein, dass sie ihre Hilfe beim Verkauf ihres Hauses brauchen würde – aber das konnte Maizie sich nicht vorstellen. Schließlich wusste sie, wie sehr Charlotte an dem Gebäude hing, das eine Vielzahl von unermesslich wertvollen Erinnerungen an ihren inzwischen verstorbenen Mann beherbergen musste.
Jetzt saßen sich die beiden Frauen im neuen, angesagten Restaurant Jake’s Hideway in der kalifornischen Kleinstadt Bedford gegenüber.
Nachdem sie die Vorspeise bestellt hatten, beugte sich Maizie verschwörerisch zu ihrer Freundin und legte eine Hand auf ihre. „Charlotte“, begann sie, „wir sind inzwischen fast vierzig Jahre befreundet. Sag mir doch bitte, was du auf dem Herzen hast. Egal, was es ist – in meinem Alter kann mich so leicht nichts mehr erschüttern.“
Charlotte wirkte immer noch so, als wäre ihr die Angelegenheit äußerst unangenehm. „Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll …“
Maizie lächelte sie ermutigend an. „Am besten mittendrin, ich melde mich schon, wenn ich etwas nicht verstehe.“
„Es geht um Mitchell“, brachte Charlotte schließlich hervor. Mitchell war ihr einziger Sohn.
Obwohl Maizie schon eine Ahnung hatte, worum Charlotte sie bitten wollte, beschloss sie, vorsichtig vorzugehen, um ihre Freundin nicht gleich zu verschrecken. „Ach so. Wie geht es Dr. Mitch denn so?“, erkundigte sie sich.
„Er ist sehr einsam“, erwiderte Charlotte sofort.
„Wirklich?“, hakte Maizie interessiert nach. Sie liebte ihren eigentlichen Beruf als Maklerin und suchte mit viel Herzblut die jeweils perfekten Traumhäuser für ihre Klienten. Noch viel lieber jedoch fand sie für einsame Menschen die jeweils perfekten Traumpartner, gemeinsam mit ihren beiden besten Freundinnen Theresa Manetti und Cecilia Parnell. Und obwohl sie diesen besonderen Service nie in Rechnung stellte, fand sie ihn doch unendlich bereichernd.
„Mein Sohn weiß allerdings noch gar nicht, wie einsam er ist“, ergänzte Charlotte schnell.
„Das musst du mir etwas genauer erklären“, forderte Maizie sie auf.
„Wenn er wüsste, dass ich mit dir darüber spreche, wäre er richtig sauer.“
„Dann sagen wir ihm eben nichts davon“, versicherte Maizie ihr. Bisher hatte sowieso keines der Paare, die sie und ihre Freundinnen schon miteinander verbandelt hatten, gewusst, dass sie sich nicht rein zufällig kennengelernt hatten. „Aber wenn alles gut laufen soll, brauche ich schon etwas mehr Hintergrundwissen.“
Charlotte atmete tief durch. „Mitchell ist ein fantastischer Chirurg.“
Maizie nickte. „Ja, genau wie sein Vater.“
Das quittierte ihre Freundin mit einem dankbaren Lächeln. „Im Gegensatz zu Matthew hat er aber keinerlei Talent für das Zwischenmenschliche.“ Einen Moment lang zögerte Charlotte, dann fuhr sie fort: „Er schafft es einfach nicht, sich in andere hineinzuversetzen oder auch nur Kontakte zu knüpfen.“
„Du meinst, er hat Probleme mit seinen Patienten?“, erkundigte sich Maizie. Sie hatte den Sohn ihrer Freundin als sehr ruhig und ernst in Erinnerung, kannte ihn aber kaum.
„Nein.“ Charlotte seufzte und beugte sich zu Maizie hinüber. „Er ist ein erstklassiger Arzt, sieht blendend aus, und er ist der wunderbarste Sohn, den ich mir wünschen könnte.“
„Aber …?“, hakte Maizie nach.
„Aber wenn das so weitergeht, bekomme ich keine Enkelkinder“, platzte Charlotte heraus und blickte sofort nach unten, als würde sie sich für ihre Worte schämen. „Mir ist ja klar, wie lächerlich sich das anhört …“
„Nein, ich verstehe dich sehr gut“, unterbrach Maizie ihre Freundin. „Genauso habe ich mich selbst mal gefühlt. Und einige meiner Freundinnen auch. Manchmal kann man einfach nicht tatenlos zusehen und hoffen, dass die Dinge schon ihren Lauf nehmen. Manchmal muss man ihnen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben.“
Maizie zwinkerte Charlotte zu, dann kam sie zum Punkt. „Weißt du denn, ob Mitchell schon mal eine ernsthafte Beziehung hatte?“
„Das weiß ich allerdings – und die Antwort lautet Nein. Ich habe sogar mal live miterlebt, wie sich ihm eine junge Frau praktisch an den Hals geworfen hat. Das war auf einer Benefizveranstaltung für das Krankenhaus, in dem er arbeitet. Und Mitchell hat es entweder nicht gemerkt oder sie mit Absicht ignoriert.“ Charlotte presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. „Allmählich glaube ich, dass er ein hoffnungsloser Fall ist.“
Bei vermeintlich hoffnungslosen Fällen fuhr Maizie zu Höchstformen auf. „Das glaube ich nicht“, sagte sie. „Ich höre mich mal um und schaue, was ich machen kann.“
1. KAPITEL
Melanie McAdams genoss nichts mehr, als sich mit den Problemen anderer Menschen beschäftigen zu können. Denn nur das erlaubte ihr, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Gutes zu tun und gleichzeitig kurzzeitig vergessen zu können, dass ihr Leben jeden Sinn verloren hatte, ohne Hoffnung auf Besserung. Die Bedford Rescue Mission, für die sie tätig war, nahm als Notunterkunft ausschließlich alleinstehende Mütter mit ihren Kindern auf und gab ihnen ein Dach über dem Kopf – so lange, wie es eben nötig war.
Inzwischen half Melanie hier schon seit fast drei Jahren aus. Zunächst nur, wenn es ihr eigentlicher Beruf als Grundschullehrerin zuließ. Doch als vor einiger Zeit ihre ganze Welt zusammengebrochen war, hatte sie sich von ihrer Schuldirektorin beurlauben lassen, um ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Vollzeit auszuüben.
Heute war allerdings einer dieser Tage, an denen sie machen konnte, was sie wollte – sie kam nicht gegen die düsteren Erinnerungen an, die ihr immer wieder durch den Kopf spukten.
Genau heute war es neun Monate her, dass der schwarze Wagen direkt vor ihrem Haus gehalten hatte … dem Haus, in dem sie mit Jeremy hatte leben wollen. Sie hatte die Eingangstür geöffnet, und draußen stand Oberleutnant John Walters, zusammen mit einem Militärgeistlichen. Die beiden waren gekommen, um ihr mit ernster Miene die schrecklichste Nachricht zu überbringen, die sie je erhalten hatte: Jeremy Williams, ihre Jugendliebe und ihr Verlobter, der ihr alles bedeutet hatte, würde nie mehr zu ihr zurückkommen. Nur sein lebloser Körper sollte noch in seine Heimatstadt Bedford überführt werden.
Die Erinnerung an diesen Tag ließ Melanie nicht mehr los. Sie zitterte, und immer wieder rutschten die Kinderbücher, die sie in einem der Aufenthaltsräume auf einem Beistelltisch stapeln wollte, auf den Boden.
Vier Tage, dachte sie. Jeremy hätte nur noch vier Tage durchhalten müssen, dann wäre er für immer in Sicherheit gewesen. Dann hätte er nämlich seinen Militärdienst beendet und wäre zu ihr zurückgekehrt – um sie zu heiraten.
Aber dazu war es nicht gekommen, und würde es auch nicht mehr kommen. Denn jetzt lag Jeremy in einem kühlen Grab, und nicht in ihrem warmen Bett.
„Alles okay, Miss Melody?“, erkundigte sich eine hohe Kinderstimme.
Melanie versuchte, sich so gut es ging zusammenzureißen, als sie sich zu dem kleinen grünäugigen Mädchen umdrehte, das ihr die Frage gestellt hatte: April O’Neill war eine hübsche, aufgeweckte Fünfjährige, die mit ihrem siebenjährigen Bruder Jimmy und ihrer Mutter Brenda inzwischen seit über einem Monat in der Unterkunft wohnte. Davor hatten sie in einer nahe gelegenen Stadt auf der Straße gelebt – wie lange genau, das hatte die Mutter nicht verraten wollen.
Als das Mädchen sie anfangs fälschlicherweise Melody genannt hatte, hatte Melanie noch versucht, sie aufzuklären. Mit der Zeit hatte sie sich aber daran gewöhnt. Die kleine Familie, die schon so viel hatte durchmachen müssen, war ihr schnell ans Herz gewachsen. Brenda war verwitwet und hatte dazu noch ihren Job verloren. Nachdem sie zwei Monate mit der Miete im Rückstand gewesen war, hatte der Vermieter sie und die Kinder einfach vor die Tür gesetzt.
Die kleine Familie hatte lange auf der Straße gelebt … bis sich irgendwann ein Polizist erbarmt und sie im Streifenwagen zur Notunterkunft für alleinerziehende Mütter gebracht hatte.
Jetzt zwang Melanie sich zu einem Lächeln und blickte das Mädchen an. „Ja, mit mir ist alles okay, meine Süße.“
Die Antwort schien April nicht zu überzeugen. Sie runzelte die Stirn. „Aber da läuft Wasser aus deinen Augen. Genau wie bei Mama, wenn sie gerade wieder an etwas Trauriges denkt. Zum Beispiel an Dad.“
„Ach, das liegt nur am Staub“, erwiderte Melanie schnell. „Ich habe eine Hausstauballergie, und wenn zu viel Staub in der Luft ist, dann läuft mir schon mal … Wasser aus den Augen“, schloss sie mit Aprils Worten und in der Hoffnung, die Erklärung würde das Mädchen befriedigen.
„Ach so. Aber dagegen gibt es doch Medizin“, sagte das Mädchen. „Das weiß ich schon.“
Melanie lächelte und legte der Kleinen einen Arm um die schmalen Schultern, um sie kurz an sich zu drücken. „Gute Idee, das muss ich mal ausprobieren“, versprach sie. „Aber verrate mir doch mal, was du eigentlich von mir wolltest.“
Jetzt wirkte April sogar noch ernster. „Mama meint, dass Jimmy wieder krank ist.“
Melanie überschlug ein paar Daten in ihrem Kopf. Dann war der Junge in den letzten sechs Wochen ja schon dreimal krank gewesen! Das Leben auf der Straße hatte ihn wahrscheinlich ganz schön geschwächt. „Hat er wieder das Gleiche wie vorher?“, erkundigte sie sich.
April nickte, dass die blonden Haare nur so wippten. „Er niest und hustet die ganze Zeit. Mama sagt, dass er lieber nicht mit den anderen Kindern spielen soll, sonst stecken sie sich noch an.“
„Das ist richtig“, stimmte Melanie zu.
Gemeinsam gingen die beiden den Flur hinunter zu den Schlafräumen, in denen sowohl die Frauen als auch ihre Kinder untergebracht waren. April schob ihre kleine Hand in Melanies und drückte sie fest. „Ich glaube, Jimmy muss mal zum Arzt“, urteilte sie und schaute Melanie tief in die Augen.
„Das ist eine noch bessere Idee“, erwiderte diese leise.
„Wir haben aber kein Geld, und Jimmy fühlt sich zu schwach, um zum Krankenhaus rüberzugehen. Außerdem mag Mama nicht gern fragen, ob sie etwas ohne Geld bekommen kann“, schloss April mit ernster Stimme.
Melanie nickte. „Deine Mama ist eine stolze Frau“, sagte sie. „Aber manchmal muss man seinen Stolz auch vergessen. Nämlich dann, wenn man einem geliebten Menschen helfen will.“
April betrachtete sie wissend. „Jimmy zum Beispiel?“
„Ganz genau.“
Das Mädchen bog um die Ecke und drückte eine große Tür auf. Dahinter lag einer der drei Schlafsäle, in dem sie so viele Familien untergebracht hatten, wie sie konnten, ohne dabei gegen die Brandschutzauflagen zu verstoßen. Im Moment hielt sich kaum ein Bewohner im Raum auf – mit Ausnahme einer kleinen dunkelhaarigen Frau, die in der hintersten Ecke auf einer Bettkante saß. Gegen sie gelehnt saß ein zerbrechlich wirkender rothaariger Junge im Bett, der ununterbrochen hustete. Der Husten wurde immer schlimmer und klang so, als wäre er ohne fremde Hilfe nicht mehr zu stoppen.
Weil erfahrungsgemäß manchmal schon ein Glas Wasser half, wollte Melanie es erst mal damit versuchen. „April, läufst du schnell in die Küche und fragst Theresa, ob sie dir ein Glas Wasser für deinen Bruder gibt?“
Sofort rannte die Kleine los.
Kaum hatte sie den Raum verlassen, wandte Melanie sich Jimmys Mutter zu. „Wir sollten ihn wirklich von einem Arzt untersuchen lassen“, schlug sie vorsichtig vor.
Brenda O’Neill hob den Kopf. Sie wirkte viel älter, als sie eigentlich war, dazu unendlich müde und erschöpft. „Danke, aber wir kommen schon zurecht. Er hat diesen Husten ja nicht zum ersten Mal“, erwiderte sie. „Er kommt und geht, das ist bei manchen Kindern eben so.“
„Das kann sein“, begann Melanie. „Trotzdem wäre es besser, wenn Jimmy sich mal richtig auskurieren könnte.“ Sie hielt kurz inne, dann fuhr sie fort: „Mir ist schon klar, dass ihr euch das im Moment nicht leisten könnt, aber ich bezahle das gern.“
Sofort verschloss sich Brendas Miene. „Ach was, das wird schon wieder“, sagte sie. „Kinder in dem Alter haben doch ständig irgendwas.“
Melanie seufzte. Ohne das Einverständnis seiner Mutter konnte sie den Jungen schlecht in das hochmoderne Krankenhaus bringen, das nur wenige Kilometer von der Unterkunft entfernt lag.
In diesem Moment kam April wieder ins Zimmer. „Hier, ich habe Wasser geholt“, rief das Mädchen. „Und Theresa ist gleich mitgekommen.“
Theresa Manetti, die freiwillig in der Küche aushalf, reichte Jimmy das Glas. „Hier, trink einen Schluck. Vielleicht wird es dann besser.“ Sie lächelte dem Jungen zu. „Wenn nicht, habe ich noch etwas in der Hinterhand.“
Brenda blickte die ältere Frau skeptisch an. „Die Diskussion habe ich eben schon mit der Dame hier geführt.“ Sie wies auf Melanie. „Einen Arzt können wir uns nicht leisten, und in ein paar Tagen geht es Jimmy bestimmt wieder besser.“
„Das ist gut möglich“, gab Theresa zurück und berührte kurz Brendas Schulter. „Aber Dr. Mitch kann ihn sich ja trotzdem mal ansehen, wenn Sie einverstanden sind.“
Melanie runzelte die Stirn. „Dr. Mitch?“ Den Namen hatte sie noch nie gehört. Wollte Theresa jetzt etwa ihren Hausarzt rufen?
„Ja, sorry, meine Freundin Maizie nennt ihn immer so“, erwiderte Theresa. „Eigentlich heißt er Dr. Mitchell Stewart, und arbeitet als Chirurg am Bedford Memorial Hospital … also gar nicht weit von hier“, fügte sie als Erklärung für Brenda hinzu. „In den letzten Jahren hat er sich eine gute Position erarbeitet, und jetzt will er etwas für die Allgemeinheit tun, habe ich gehört. Und als ich Polly davon erzählt habe, hat sie ihn sofort angerufen und darum gebeten, doch für ein paar Stunden hier vorbeizuschauen.“
Polly French war die Leiterin der Notunterkunft.
Brenda wirkte immer noch misstrauisch. „Danke, aber wir brauchen keine Gefälligkeiten.“
„Eigentlich würden Sie dem Arzt damit ja einen Gefallen tun“, meinte Theresa. „Wenn er sich unbedingt nützlich machen will, dann lassen Sie ihn doch.“ Jetzt wandte sich die ehrenamtliche Köchin dem Jungen zu, der inzwischen aufgehört hatte zu husten – zumindest vorübergehend. „Was sagst du denn dazu, Jimmy?“
Er betrachtete sie skeptisch, vom vielen Husten standen ihm noch die Tränen in den Augen. „Er gibt mir aber keine Spritze, oder?“
„Das kann ich mir nicht vorstellen“, entgegnete sie. „Er will dir nur helfen.“
„Okay“, antwortete der Junge. „Aber nur, wenn er mich auch wirklich nicht pikst.“
Theresa lächelte Brenda zu. „Ihr Sohn ist ja ein knallharter Verhandlungspartner. Er erinnert mich ein bisschen an meinen Sohn in dem Alter. Der ist inzwischen übrigens Anwalt“, fügte sie mit Stolz in der Stimme hinzu. „Vielleicht wird Jimmy ja auch mal einer.“
Brenda sah nicht so aus, als könnte sie sich das vorstellen, schwieg aber.
Erneut legte Theresa ihr eine Hand auf die Schulter und drückte sie sanft. „Es wird auch wieder besser, glauben Sie mir“, sagte sie ruhig. „Selbst wenn es sich jetzt so anfühlt, als würden Sie da nie wieder rauskommen.“ Sie ging zur Tür. „So, und jetzt kümmere ich mich um das Abendessen.“
Melanie folgte ihr. „Stimmt das, was du da gerade gesagt hast?“, hakte sie nach. „Hast du uns wirklich einen Arzt organisiert?“ Das konnte sie sich kaum vorstellen, weil es zu schön wäre, um wahr zu sein. Viel zu schön.
„Na ja, nicht ich persönlich“, klärte Theresa sie auf. „Aber die Freundin einer Freundin von mir … na ja, kurz gesagt: Morgen schaut hier wirklich ein Arzt vorbei. Ein ganz ausgezeichneter sogar. Meine Freundin Maizie ist sehr gut mit seiner Mutter befreundet. Dr. Mitch ist bloß ein bisschen … steif, wie ich gehört habe“, räumte sie ein. „Darum wäre es vielleicht ganz gut, wenn du an seinem ersten Tag hier an seiner Seite bleiben könntest, um zwischen ihm und den Bewohnern, na ja, zu vermitteln? Ihn ein bisschen einzuweisen? Ich hoffe, es ist nicht zu viel, um das ich dich da bitte.“
Aus Melanies Sicht würde sich Polly, die Leiterin der Unterkunft, viel besser für diese Aufgabe eignen. „Ich habe doch gar keine medizinischen Kenntnisse.“
„Dafür kennst du dich umso besser mit Menschen aus“, gab Theresa sofort zurück. „Und unsere Bewohnerinnen vertrauen dir. Jetzt muss ich aber schnell zurück in die Küche – sonst wird das Abendessen nicht rechtzeitig fertig.“
Theresa wollte gerade durch die Tür gehen, da drehte sie sich doch noch einmal um und kam wieder auf Melanie zu. Sie beugte sich zu ihr herüber und sprach mit leiser Stimme, sodass nur Melanie sie hören konnte: „Falls du gern mal mit jemandem im Vertrauen sprechen würdest … oder einfach jemanden brauchst, der dir zuhört – dann kannst du immer auf mich zukommen. Du weißt ja, dass ich jede zweite Woche hier in der Unterkunft aushelfe. Und wenn ich gerade nicht da bin …“
Theresa suchte in ihrer Schürzentasche herum und zog schließlich ihre Visitenkarte und einen Kugelschreiber hervor. Schnell notierte sie etwas auf der Kartenrückseite. „Hier, bitte.“
Stirnrunzelnd betrachtete Melanie die Kartenvorderseite. Darauf waren die Kontaktdaten von Theresas Cateringunternehmen abgedruckt. „Vielen Dank – ich glaube aber nicht, dass ich demnächst etwas feiern und dafür einen Partyservice engagieren will.“
„So habe ich das auch nicht gemeint. Auf die Rückseite habe ich dir meine Privatnummer geschrieben. Unter der kannst du mich jederzeit anrufen.“
Melanie hielt nicht viel davon, einfach irgendwelchen Fremden ihr Herz auszuschütten. „Wir kennen uns doch kaum“, bemerkte sie und drehte die Karte um.
„Darum habe ich dir ja meine Nummer gegeben“, erklärte Theresa. „Damit sich das ändern kann.“ Dann schwieg sie einige Sekunden lang, als schien sie darüber nachzudenken, ob sie noch etwas hinzufügen sollte. „Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man sehr geliebt hat“, ergänzte sie schließlich.
Verblüfft betrachtete Melanie die ältere Frau. Bisher hatten sie nur wenige Worte miteinander gewechselt, und dabei war ihr Theresa Manetti immer sehr sympathisch gewesen. Allerdings hatten sie nie ein persönliches Gespräch geführt, und Melanie hatte ihr ganz bestimmt nichts von Jeremys Tod gesagt.
Als hätte Theresa ihre Gedanken gelesen, fügte sie hinzu: „Polly hat mir erzählt, was mit deinem Verlobten passiert ist. Es tut mir so schrecklich leid.“
Melanie versteifte sich. „Ja, mir auch“, gab sie knapp zurück.
Theresa ließ nicht locker. „Ich finde es gut, dass du hier arbeitest“, sagte sie. „Das ist das Beste, was du tun kannst: dich sinnvoll zu beschäftigen. Damit hältst den Schmerz auf Abstand … bis du ihm irgendwann gewachsen bist.“
„Diesem Schmerz werde ich wohl nie gewachsen sein“, versetzte Melanie mit fester Stimme.
„Ich glaube, da unterschätzt du dich“, erwiderte Theresa und ging durch die Tür.
2. KAPITEL
Wenn sich Dr. Mitchell Stewart alles noch mal durch den Kopf gehen ließ, war er sich nicht sicher, ob er die Sache wirklich durchziehen sollte.
Alle, die ihn auch nur oberflächlich kannten, wussten, wie gewissenhaft und überlegt er immer handelte. Seine Entscheidungen waren nie überstürzt, sondern immer klug durchdacht – insofern kam es eigentlich gar nicht infrage, dass er sich etwas im Nachhinein anders überlegte.
Und trotzdem: In diesem besonderen Fall fragte Mitch sich, ob er sich in dieser Angelegenheit nicht hatte hinreißen lassen.