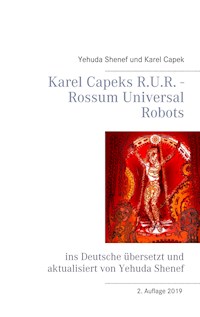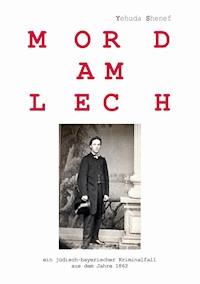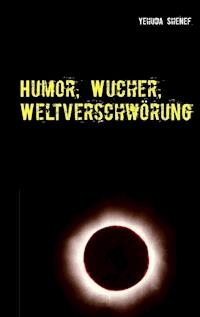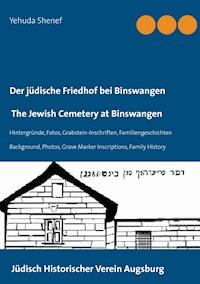Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die drei Geschichten des Erzählbands befassen sich mit der Isolation des modernen Menschen im Laufrad des Alltagslebens. Die Protagonisten erleben, dass der Einzelne für das Allgemeinwohl nicht relevant ist, dass schon die Türe der Nachbarwohnung zur Herausforderung werden kann oder versuchen sich daran, die Nächstbeste zu heiraten, um das Schicksal herauszufordern. Mit drei Illustrationen der Künstlerin Chana Tausendfels
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Statistisch nicht relevant
Ignaz der Löwe
Die seltsame Schicksalsverstopfung des Herrn Brecht
Anmerkungen
Abbildungen
Statistisch nicht relevant
Das Anschreiben
„Email für Emil“. Ein naheliegendes, für Emil selbst freilich seit Jahren schon längst nicht mehr komisches, weil viel zu oft gehörtes Wortspiel. Die meisten Mails die er erhielt waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Newsletter, die er vor Jahren mal abonniert hatte und seitdem bekam, ohne dass er sie noch las. Manche hatte er bereits mehrfach abbestellt, vielleicht nicht auf die richtige Weise. Sie kamen eben trotzdem noch. Ab und an kamen auch Reklamemails, für Eigenheime etwa oder Spendenaufrufe für elternlose Kinder auf fremden Kontinenten. Emil hatte sich schon öfter gewundert, wie die Betreiber solcher Organisationen überhaupt an seine Emailadresse gekommen sein mochten. Unter den fünfzehn Nachrichten im Postfach befand sich auch nur eine, die an ihn persönlich adressiert war. Es schrieb ihm eine Statistische Erfassungs- und Regulierungsbehörde, von der er noch nie gehört oder gelesen hatte.
Das Schreiben teilte mit, dass er von der Behörde durch einen Algorithmus zufällig als „statistischer Durchschnittsbürger ausgewählt“ worden sei und sich am übernächsten montagmorgens um 8 Uhr 15 in der Behörde in Zimmer 759 einfinden solle und zwar, wie es hieß: „zum Zweck der Datenkontrolle, des Abgleichs und der Normierung“. Emil lachte leicht auf und nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse, die neben seinem Computer am Schreibtisch stand. Offenbar, sind sie sich nicht so sicher, ob ihr Zufallsgenerator noch funktioniert, dachte er sich.
Im letzten Absatz wurde Emil nun aber mit Fettdruck darauf hingewiesen, dass er gegenüber der Behörde zur „informativen Mitarbeit verpflichtet“ sei. Ein unentschuldigtes Nichterscheinen, ohne gewichtigen Grund, könne mit einem Zwangsgeld von bis zu 5000 Euro, ersatzweise Beugungshaft geahndet werden. Das klang nun nicht wirklich witzig, vielmehr beunruhigend, gar bedrohlich. Emil war sich aber nicht sicher, ob er noch amüsiert, oder bereits wütend war. Sollte das ein etwa Scherz sein, ein besonders schlechter gar? Er dachte kurz daran, wer seiner Bekannten und Freunde dahinterstecken könnte, da gab es gewiss einige Kandidaten, doch stand weder der 1. April noch Halloween bevor. Gab es eine solche Behörde denn überhaupt? Emil las weiter und erfuhr, dass er den Terminvorschlag selbstverständlich „aus wichtigem Grund (ggf. Attest beifügen) widersprechen“ könne und „gegen Verrechnung einer Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühr von 60 Euro binnen einer Woche“ einen Ersatztermin anfordern könne.
Das erschien Emil rational, wegen der Höhe der Gebühr zugleich aber auch sehr dreist. Was sollte er davon halten? Mit der Suchmaschine an seinem Computer überprüfte Emil sogleich, ob es jene ominöse Statistische Erfassungs- und Regulierungsbehörde tatsächlich gab. Emil stammte aus einer Beamtenfamilie, sowohl seine Eltern, drei Onkel und Tanten, einige Cousins und entferntere Verwandtschaftsgrade waren in verschiedenen städtischen und staatlichen Behörden und Instituten beschäftigt gewesen oder waren es immer noch, und so kannte er doch einiges wenigstens vom Hörensagen, was dem Normalbürger weniger vertraut war. Doch von dieser Behörde hatte er noch nie gehört, lediglich das im Fernsehen ab und an zitierte „statistische Bundesamt“ war ihm geläufig. Dass es aber auch lokale Behörden gab, die sich mit statistischen Erhebungen befassten, nun, das mochte wohl sein. Folgerichtig bestätigte dann auch die Suchmaschine die Existenz der Behörde und die angegebene Adresse. Arg viel mehr konnte er ihrer Webseite freilich nicht entnehmen. Ihre Räume hatte sie im siebten Stock, was zur mit der Ziffer 7 beginnenden Zimmernummer passte. Ansonsten fanden sich nur diverse Verordnungen und Richtlinien auf pdf-Dateien zum Download, schließlich auch ein Kontaktformular. Vergeblich suchte Emil jedoch eine Telefonnummer zur direkten Durchwahl, was den naheliegenden Gedanken eines Anrufs leider erübrigte. Emil ließ sich davon aber nicht entmutigen und rief stattdessen bei der Stadtverwaltung an in der Hoffnung, dass diese ihn mit der Behörde verbinden mochte. Nachdem er einige Minuten in der Warteschleife hing und dabei dreimal Barry Manilows „Mandy“ über sich ergehen lassen musste, teilte ihm eine Frau mit osteuropäischen, vielleicht rumänischen, Akzent mit, dass es keine Durchwahl gebe und Vorsprachen nur persönlich und mit Termin möglich wären: „Vorsprachen nur persönlich und auf Termin. Sie haben verstanden?“
Emil schaute noch ein wenig herum, was es sonst über die Behörde im Internet zu lesen gab. In einem digitalen Zeitungsartikel vom letzten Frühjahr war als Amtsleiter der Behörde ein gewisser Prof. Dr. F. Pommerance genannt worden, der eine Statistik zur Bevölkerungsentwicklung kommentierte und dabei vor „beliebigen Interpretationen“ warnte. Emil fand den Namen amüsant, zumal in der wahrscheinlich französischen Schreibweise. Die Vorstellung des Französischen erinnerte ihn daran, dass seine geschiedene Frau Babette mütterlicherseits von Hugenotten abstammte. Die Hugenotten faszinierten ihn wegen der hohen Bildung, die man in vielen Familien vorfand, während ihn andererseits ihr karger Formalismus und die sittenstrenge Sachlichkeit ein gewisses Unbehagen bereitete. Emil war sich lange Zeit nicht sicher, ob er in Babettes Verhalten nicht doch ab und an entsprechende Züge wahrgenommen hatte. Er konnte sich auch getäuscht haben, wie in ihr ganz allgemein. Jedenfalls hatte er bald handfestere Gründe gefunden, um sich von ihr zu trennen.
Emil beschloss es mit der Hinterfragung der Mail fürs erste auf sich beruhen zu lassen. Er markierte die anderen Mitteilungen, die er im Postfach vorgefunden hatte und klickte sie in die virtuelle Mülltonne, während er die der Behörde auf sein Mobiltelefon übertrug. Er hatte zu viel Zeit mit Grübeln verbracht und war nun etwas spät dran. Schließlich musste er noch zur Arbeit fahren.
In der Mittagspause saß Emil mit seinem Kumpel Thomas zusammen, den er bereits aus Grundschultagen kannte, der seit zwei Jahren aber sein Vorgesetzter in der Abteilung war. Da sie trotzdem gute Freunde blieben, hatte er keine Bedenken, ihm die E-Mail der ominösen Behörde zu zeigen. Auch Thomas fand sie „gelinde gesagt eigenartig“ und wunderte sich darüber, dass eine echte Behörde Bürger per Email und nicht wie zu erwarten mittels gewöhnlicher Post anschreiben sollte. Wie Emil lachte auch Thomas zunächst und scherzte augenzwinkernd: „Ich dachte eigentlich immer, ich wäre durchschnittlicher als du“, so als sei ihm eine zustehende Auszeichnung entgangen. Als sein Freund ihm allerdings davon berichtete, dass es die Behörde wohl tatsächlich gab, war auch er ratlos. Thomas blieb nur die Frage, ob Emil den Termin denn wahrnehmen wolle, zumal er immerhin auch in Emils Arbeitszeit fiele. „Es bleibt mir kaum eine andere Wahl“ antwortete dieser: „Sechzig Euro sind schon ein gutes Abendessen zu zweit“. Thomas erhob sich vom Tisch und nahm sein Tablett: „Ganz zu schweigen von fünf Riesen … oder Beu ...ähm Gungs-Haft. Man-o-man, Sachen gibt es!“
Die Ermittlung
Emil klopfte pünktlich um 8 Uhr 15 an die Türe von Zimmer 759 der Statistische Erfassungs- und Regulierungsbehörde. Ein großer, bleicher magerer Mann, mit Glatze, dunkel umrandeter Brille und seltsam altmodischer Kleidung öffnete ihm. Er war mit einem rosa Hemd und einer dunkelbeigen Hose gekleidet, eine Kombination die Emil seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, obwohl sie in früheren Zeiten durchaus häufiger zu sehen war. Über dem Hemd trug der Mann, der sich kurz als Schulz vorstellte, einen Hosenträger mit senkrecht aufgereihten Blümchen. Schulz fragte Emil ob er einen Termin hatte. Emil bejahte und gab ihm den Ausdruck der Email. „Ah ja ...“ sagte der Mann und bat Emil Platz zu nehmen: „Hm, ja ... das ist das Standardverfahren.“ „Ja“, fragte Emil zurück: „was für ein Standard denn?“ Schulz erklärte in kurzen, schnellen Sätzen, die er so routiniert heruntersagte, als habe er sie schon hunderte-, ja vielleicht tausende Male vor sich hergesagt, was durchaus sein konnte. Das „Verfahren“ diene dem Abgleich mit dem vorhandenen statistischen Datenmaterial, das an vielen Stellen interpoliert werden müsse. Die dafür ausgesuchten Stichproben, also Personen wie er, Emil, beruhten auf einem ausgefeilten Algorithmus. Die Stichproben nun dienten sozusagen der Kalibrierung der erhobenen statistischen Daten. Die ausgewählten Personen seien nun sozusagen im Auftrag des Staates, besser gesagt, für das Allgemeinwohl, dazu berufen, dazu beizutragen, das Datenmaterial zu verbessern. Genau deshalb sollte Emil sich nun als erstes zur statistischen Ausgleichsuntersuchung in der Spezialambulanz der Universitätsklinik einfinden. Am besten gleich anschließend, was unproblematisch sei, weil der ambulante Dienst unweit in einem Nebengebäude untergebracht sei. Auf Nachfrage teilte Schulz mit, dass die Untersuchungseinheit sich zwar außerhalb der Universitätsklinik befinde, aber ihr als staatlich finanzierte Unterabteilung trotzdem zugerechnet sei. Während Schulz die Zusammenhänge erklärte, tippte er zeitgleich routiniert in seine Tastatur und als er aufhörte zu erklären, übergab er Emil sogleich einen Ausdruck, der einen Überweisungstermin zur Spezialambulanz zwei Häuser weiter in zehn Minuten beinhaltete.
Obwohl er pünktlich in der Spezialambulanz erschienen war, sagte ihm eine freundliche Osteuropäerin an der Rezeption, dass er am Automaten gleich neben der Theke eine Nummer ziehen solle. Die Anzeige an der Wand würde seine Wartenummer anzeigen und die des Zimmers, in welches er sodann eintreten und vorsprechen sollte. Auf dem Zettel, den der Automat für Emil mit einem Surren ausspuckte stand 211. Da die Anzeige auf 210 stand war Emil erleichtert, sprach dies doch dafür, dass er bereits als nächster an der Reihe sein dürfte. Er realisierte nun, dass der Eintrittsbereich eigentlich eine Art Wartezimmer war und dass die meisten Sitzplätze besetzt waren. Da es bestimmt vierzig Leute waren, die dort saßen, war er doch sehr froh darüber, dass er einen Termin hatte und pünktlich erschienen war. Ausgeruht sitzend war ihm nun als erstes der übergroße Pflanzenkübel in der Mitte des Raumes aufgefallen, der gewiss einen halben Meter hoch war und einen Meter im Durchmesser aufwies. Darin eingetopft war ein kräftiger, mannshoher Strauch mit rötlichen Blüten, der ihn an den Christusdorn aus dem Garten seiner Eltern erinnerte. Der Strauch im Warteraum war freilich fast drei Mal so groß. Wie konnte der Strauch im Haus besser wachsen, als im Garten und warum stand er hier im Zentrum des Warteraums, wo auch eine Reihe von Kindern herumsprangen. Es blieb keine Zeit über solche Kleinigkeiten nachzudenken, da der Automat ein Signal gab und tatsächlich seine Nummer aufgerufen wurde. Die Anzeige signalisierte, dass er wohl in Zimmer 8 erwartet wurde. Das war gleich neben dem Automaten. Und so fasste er auch gleich den Türgriff und warf noch einen Blick auf die Menge von Leuten, die um den Christusdorn herumsaßen und warteten und anders als er offenbar keinen Termin hatten.
Das Zimmer in das er nun eingetreten war verdiente eine solche Bezeichnung freilich nicht. Mit der Tür in der Hand stand er nämlich schon vor einer weiteren Theke, hinter der eine kleine alte Frau mit einer vielleicht vor Jahrzehnten bereits aus der Mode gekommenen dicken, stark gewölbten Hornbrille saß. Vor sich hatte sie drei moderne, kaum fingerdicke Flachbildschirme und hinter sich zwei Tischchen mit einem Drucker und einer Kaffeemaschine. Emil war erstaunt über das Arrangement, denn ihre Zimmerhälfte und jene die er soeben betreten hatte, mochten kaum mehr als drei Meter lang sein, während der Raum allenfalls halb so breit war.
„Sie wünschen!“ „Nein, nein“, antwortete Emil „Ich habe einen Termin. Hier sehen Sie, mein … das Schreiben von der Statistikbehörde.“ „So?“ „Ja, ich soll ja untersucht werden“. Die offenbar wenig beeindruckte Frau hinter der Theke fragte, ob er irgendwelche medizinischen Befunde mitgebracht hätte und Emil verneinte dies. „Es war mir nicht bekannt, dass, ich das tun sollte.“ Die Frau stand auf und lehnte sich über die Theke: „Es würde unsere Arbeit schon sehr erleichtern, wenn ab und an mal einer mitdenken würde.“
Emil war verunsichert, wollte sich aber auf keinen Streit mit der wahrscheinlich wenigstens beruflich überforderten Frau einlassen. Er würde sie ja wohl doch nie wiedersehen. „Ihre Nummer? … Geben sie mir bitte Ihre Nummer“. Nun wurde im klar, dass sie den Zettel des Automaten haben wollte. Sie nahm ihn an sich, warf ihn in einen Korb und setzte sich wieder. „Sie können wieder rausgehen und draus warten. Sie werden dann persönlich aufgerufen.“ Emil merkte eine leichte Verärgerung in sich aufsteigen, auch weil ihm dämmerte, dass die Wartenden draußen wohl dieselbe Prozedur bereits hinter sich hatten, was seinen gefühlten Vorsprung wahrscheinlich auf null schrumpfen ließ.
„Das war es schon?“ „Ja, was wollen sie noch?“ „Aber, … aber ich habe doch einen Termin um 8 Uhr 45 und jetzt ist es gar nicht zufällig 8 Uhr 43, ich bin nämlich gerne pünktlich.“ Die Dame blickte zu ihm hoch. „Das freut mich für Sie, aber den Termin haben sie nicht mit mir. Warten Sie bitte draußen.“ Emil sah zurück zur Frau hinter dem Tresen und zeigte mit der Hand auf das Schreiben. „Das brauchen Sie nicht mehr, Sie sind ja jetzt angemeldet.“
„Und wie lange dauert das nun alles in allem?“
„Das kommt drauf an, was untersucht wird. Mit zwei oder drei Stunden sollten Sie hinkommen, vorausgesetzt Sie halten den Betrieb hier nicht länger auf.“ Emil nickte kurz und verließ das winzigste Büro, dem er bislang in seinem Leben begegnet war.
Emil nahm auf der nunmehr einzigen freigebliebenen Sitzbank Platz, die direkt neben einem Getränkeautomaten stand. Ihm war nun klargeworden, dass er sicher nicht sofort drankommen würde, und wohl auch alle anderen Wartenden wie er einen Termin hatten. Ein solcher Termin hatte dann wohl auch weniger etwas mit Service oder Kundendienst zu tun, sondern eher den Charakter einer Vorladung. Man konnte nicht erwarten, persönlich vorgeladen zu werden, sondern hatte stattdessen wahrscheinlich vielmehr Glück, von den Sekretärinnen nicht abgewiesen zu werden. Ihm fiel ein, dass er Kliniken allgemein nicht mochte. Das konnte er von seinem Vater haben, der sich weigerte Krankenhäuser zu betreten. Die heutigen Klinikzentren hatten auch für den Sohn überwiegend unbehagliche Aspekte, obgleich man sich um eine unbestimmte, unaufdringliche Ausstattung bemühte, mit Bildern, Pflanzen, Fernsehern und dergleichen. Trotzdem erschienen sie ihm so, als hätte man das Reisezentrum eines Bahnhofs mit der Fertigungshalle eines Zulieferbetriebs kombiniert und mit dem gezielt abweisenden Charme einer Arbeitslosenanstalt ausgestattet. Tatsächlich war der Warteraum in der Art eines quadratischen Lichthofs ausgestattet mit einem verstrebten pyramidenartigen Glasdach über den Wartenden. Diese saßen auf weiß lackierten Sitzgruppen aus Metall und Plastik. Um den großen Christusdorn herum waren jeweils zwei Sitzgruppen Rücken an Rücken so angeordnet, dass vier von ihnen tatsächlich ein Kreuz bildeten mit dem Pflanzentopf als Angelpunkt. An den Sitzbänken befanden sich noch kleine Tischchen mit Frauen- und Fußballzeitschriften.
Um das Kreuz herum waren weitere Dreiersitzgruppen mit Blick auf die Mitte angeordnet, was der Gesamtkonstruktion, wie Emil befand, beinahe einen gewissen religiösen Charakter verlieh. An den Wänden rundherum hingen Tafeln, etwa mit den Porträtfotografien des Ärzteteams. Auch einen Fernsehbildschirm gab es, der tonlos Werbefilme für Südseereisen zeigte. An der nächsten Wand hing ein Triptychon aus großen, in verschiedenen, meist in kräftigen Blautönen bemalten Quadraten, wovon das linke eine Art Kreuz in einem helleren absteigenden Dreieck zeigte, das rechte hingegen eine Art Totenschädel. An den Wänden waren nun auch Türen, hinter denen sich wohl die Untersuchungszimmer befanden.
Emil war so sehr mit der Begutachtung des Warteraums befasst, dass er gar nicht mehr auf die Anzeigetafeln achtete. Die große runde Uhr, die einer alten Stationsuhr glich, zeigte jedoch bereits zwanzig Minuten nach neun. Er saß also bereits länger als eine Stunde in der Wartehalle und auf der Anzeigetafel war die Nummer 212 angezeigt. In all der Zeit war also nur eine einzige Person nach ihm in den Warteraum gekommen.
Emil stand auf und kaufte sich am Automaten einen jener Energy-Drinks, die Kraft, Dynamik und ähnliches versprachen, immer ein wenig wie Gummibärchen oder Kaugummi schmeckten, aber doch Zucker, Kohlensäure und Aufputschmittel enthielten, und ihn wenigstens vom Einschlafen abhalten konnten. Wie er erst jetzt bemerkte, führte an den Wänden ein etwa handbreiter blauer Streifen entlang. Der Raum war auf diese Weise in ein gleichmäßiges Achteck eingeteilt. Gerade nun ging endlich eine der Türen auf und ein altes Paar verließ den weißen Raum. Hinter dem Paar konnte er einen Mann in einem der grünlich getönten Kitteln erkennen, die Ärzte in Operationsräumen tragen. Der Mediziner sagte mit lauter Stimme den alten, vielleicht schwerhörigen Leuten: „Gehen Sie jetzt auf der blauen Linie zweimal nach links und dann in das Zimmer dort drüben.“ Dann lächelte er knapp und schloss seine Türe wieder. Emil ärgerte sich etwas über die seltsame Aufforderung des Arztes, der der Frau genauso gut hätte sagen können, dass sie ins gegenüberliegende Zimmer gehen sollte. Doch dann bemerkte er, dass die alte Frau tatsächlich versuchte mit der Hilfe ihres Mannes ganz genau auf der den Raum achteckig umfassenden Linie zu bleiben. Wozu bitte sollte das gut sein? Warum waren die beiden Alten auf so lächerliche Art und Weise darauf bedacht, die Aufforderung des Mediziners überzuerfüllen. Er hatte doch von ihnen gar nicht verlangt, strikt auf der blauen Linie zu bleiben. Welchen Sinn sollte das auch haben und warum strengten sie sich damit so an, obwohl ihnen die Fortbewegung sichtbar nicht gerade leichtfiel.
Emil wurde erst kurz vor Mittag aufgerufen. Ohne weitere Erklärung wurde er nun einem Untersuchungsprogramm unterworfen, das mit einer Blutabnahme begann, auf die eine Speichelprobe folgte. Dann sollte er wieder im Warteraum Platz nehmen, und wurde hernach in ein anderes Zimmer gerufen, wo man einen Ganzkörper-CT, ein MRT und ein PET vornahm, letzteres, um die Gehirnfunktion zu prüfen. Emil musste sich komplett nackt ausziehen, auf dem Papiertuch einer Liege sitzen, Knie und Beine hängen lassen, um Reflexe zu testen. Dann sollte er aufstehen und dem Untersucher, einem kleinen, fast winzigen, arabisch oder persisch aussehenden Mann mit grauen Haaren und Schnurbart, den Rücken zudrehen. Der Mann beantwortete keine der Fragen Emils zufriedenstellend, sondern verwies immer darauf, dass Emil später mit dem Professor sprechen könne. Er selbst aber sei nur für das Programm zuständig und je schneller man vorankäme, umso schneller sei alles auch erledigt. Das klang in einer gewissen Art vernünftig und leuchtete Emil auch ein, trotzdem stieg in ihm ein wachsender Argwohn. Was hatte all dies zu bedeuten und welchen Nutzen? Warum ließ er sich darauf ein? Hatte er Angst vor einem Bußgeld? Und mehr noch, war es im Kern nicht geradezu absurd, dass er auf eine wie auch immer definierte Durchschnittlichkeit hin untersucht wurde von einem kleinen ausländischen Männchen, das ganz gewiss in keiner denkbaren Weise dem entsprechen konnte? Oder nicht musste? Der Sinn des Ganzen war Emil nicht klar. Aber er hatte Angst vor einem Bußgeld oder vor noch weiteren Konsequenzen. Immerhin fand alles hier offenbar im Rahmen staatlicher Institutionen statt und sicher auch auf modernen wissenschaftlichen Niveau. Alles würde sich noch aufklären. Gewiss. Als nächstes folgte ein Sehtest, mit einem riesigen Gerät vor seinen Augen, an welchem das kleine orientalische Männchen zahlreiche Rädern drehte und diverse Knöpfe drückte. Als es Emil kalt wurde, fragte er, ob er sich nun wieder anziehen könne. Der Untersucher war sich nicht schlüssig, verwies aber darauf, dass man noch ein Spermiogramm zur Ermittlung der Spermienzahl benötige.
Auf der Rückfahrt von der Klinik saß Emil im Bus neben einer Frau im Trachtenkos