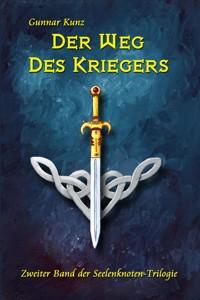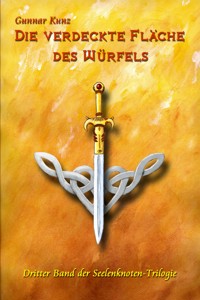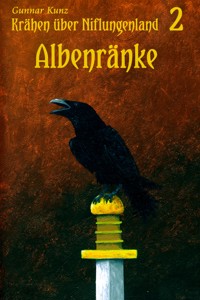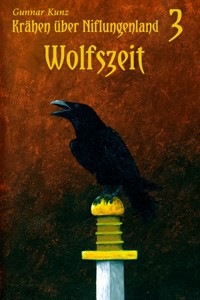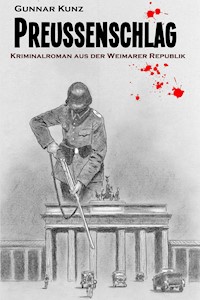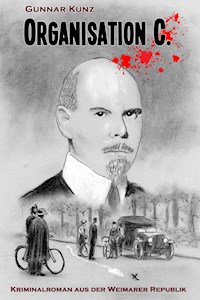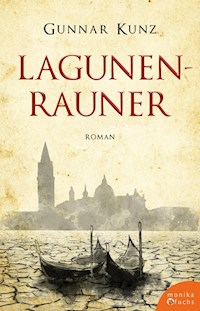Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Gregor Lilienthal
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Berlin, 1927. Während die Lohmann-Affäre die Weimarer Republik erschüttert und die Existenz einer geheimen Reichswehr enthüllt, wird Kommissar Gregor Lilienthal im Zuge einer Mordermittlung mit dem Schrecken des Ersten Weltkriegs und der Revolution von 1918/19 konfrontiert. Dabei trifft er auf zwielichtige Offiziere und skrupellose Militärärzte, auf Ringvereine und Freikorps, auf Joseph Goebbels und Horst Wessel - und auf ein Geheimnis, das all seine Erkenntnisse über den Haufen wirft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunnar Kunz
Schwarze Reichswehr
KRIMINALROMAN
Impressum
Immer informiert
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Alfred Grohs;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Grohs_zur_Revolution_1918_1919_in_Berlin_Große_Frankfurter_Straße_Ecke_Lebuser_Straße_Barrikade_Kampf_während_der_Novemberrevolution_in_Berlin_02_Bildseite_Schaulustige.jpg
ISBN 978-3-8392-5678-7
Prolog
Gewöhnlich bringt einem der Weihnachtsmann Puppen, Zinnsoldaten und Gebäck, vielleicht auch mal eine Rute, aber gewiss keine Leiche. Die Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Arkonaplatz jedenfalls rechneten nicht damit, an diesem Nachmittag eine größere Sensation geboten zu bekommen als den Hauptmann von Köpenick aus Zucker, der in einer der Buden ausgestellt war. Manche bestaunten auch die technischen Wunderwerke, die man als Spielzeug kaufen konnte: Flugzeuge, Zeppeline, eine Dampfmaschine.
Zwei Kinder, Geschwister vermutlich, entdeckten den Neuankömmling als Erstes. »Der Weihnachtsmann!«, riefen sie. »Der Weihnachtsmann ist da!«
Der Ruf wurde von anderen Kindern aufgenommen, und im Nu war die Gestalt im roten Kapuzenmantel von ihnen umringt. Ohne Scheu berührten sie sein Kostüm, wollten wissen, ob er wirklich am Nordpol wohne und ob er etwas für sie dabeihabe. Erwachsene stießen sich an, deuteten auf die vermummte Gestalt und grinsten.
Der Mann reagierte nicht auf die Fragen der Kinder, sondern beschleunigte seine Schritte und drängte sich durch die Menschen, die zwischen den Buden flanierten und Geschenke für das Fest einkauften oder sich zumindest am Anblick der Dinge erfreuten, die sie sich nicht leisten konnten. Sein künstlicher weißer Bart verbarg sein Gesicht, nur Nase und Augen waren zu sehen. Seine Pupillen huschten hektisch hin und her, als befänden sie sich in Panik.
Die beiden Geschwister ließen sich nicht abschütteln. Das kleine Mädchen zupfte immer wieder am Gewand des Mannes und wollte wissen, ob er sie dieses Jahr auch wirklich nicht vergessen würde wie die letzten beiden Jahre. Ihr älterer Bruder wurde zusehends ungehaltener, weil die Gestalt im roten Mantel ihn nicht beachtete. »Du bist gar nicht der echte Weihnachtsmann«, rief er, »du bist ein Betrüger.«
Das Geschrei der Kinder brachte Golo Bartels dazu, sich umzudrehen. Er war nicht mehr nüchtern und darüber hinaus schlechter Laune, nachdem ihm heute Morgen aufgegangen war, dass er das Fest auch dieses Jahr wieder würde allein verbringen müssen. »Sieh da, der Weihnachtsmann«, nuschelte er. »Bestimmt hast du eine Rute unter deinem Mantel versteckt, was?« Er wieherte über seinen eigenen Witz und schwankte, als er einen Schritt auf ihn zumachte. »He«, lallte er, »hast du ein Geschenk für mich?«
»Allerdings«, klang es unter dem Bart hervor.
Bartels’ Augen weiteten sich vor Überraschung, als er erkannte, wer sich unter dem Kostüm verbarg, und ein Adrenalinstoß versetzte seinen Körper in Alarmbereitschaft. Doch da hatte sein Gegenüber bereits einen Armeerevolver aus der Manteltasche gezogen, presste ihm diesen an die Stirn und drückte ab. Bartels brach zusammen. Um sicherzugehen, beugte sich der Mörder über sein Opfer und schoss ihm zwei weitere Male in den Kopf.
Menschen schrien und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Das kleine Mädchen, das keine zwei Meter vom Ort der Tat entfernt stand, machte sich in die Hosen. Ihr Bruder, dessen Gesicht mit Bartels’ Blut bespritzt war, taumelte rückwärts und kreischte vor Entsetzen. Einer der Passanten schien mit dem Gedanken zu spielen, sich auf den Mörder zu stürzen, doch als die Waffe in dessen Hand einen Kreis beschrieb und sich auf die Umstehenden richtete, überlegte er es sich anders.
Ungehindert verließ der Weihnachtsmann den Arkonaplatz, überquerte den Fahrdamm und verschwand in einer Seitenstraße, ohne dass ihn jemand aufzuhalten wagte.
I
Samstag, 3. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember 1927
Nein, eine »große Zeit« war die Stresemannzeit nicht. Sie war kein voller Erfolg, nicht einmal, solange sie dauerte. Zuviel Unheil grollte unter der Oberfläche, zuviel dämonisch böse Kräfte blieben im Hintergrund fühlbar. […] Aber wie auch immer, für uns jüngere Deutsche ist sie, mit all ihren Schwächen, die beste gewesen, die wir erlebt haben.
Sebastian Haffner
1
Schwer vorstellbar, dass der größte Teil der Bevölkerung immer noch in Armut lebte, wenn man die Auslagen in den Kaufhäusern sah. Da wetteiferten Kühlschränke, Porzellan und Eau de Cologne um die Aufmerksamkeit der Passanten neben Lebkuchen, Hexenhäusern aus Pfefferkuchen, Christstollen und Fresskörben voller Schnapsflaschen, Würsten und Trauben. Außerdem gab es die erste elektrische Geschirrspülmaschine der Firma Miele für stolze vierhundert Reichsmark, Armbanduhren ab zwölf Mark fünfzig und Staubsauger für hundertvierzig Mark.
Hendrik schlenderte mit Diana durch die Konsumtempel und genoss ihre Gesellschaft. Es war lange her, dass er sie so unbeschwert erlebt hatte. Sie lachte und schwatzte wie früher, diskutierte mit ihm über die Wende nach rechts durch den Bürgerblock, der seit Anfang des Jahres unter Einbeziehung der Deutschnationalen regierte, über die Ablehnung des Antrags auf Abschaffung der Todesstrafe und die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti in den USA. Ausnahmsweise trug sie mit ihrem Jumperkleid und dem kleinen Topfhut in verschiedenen Blauschattierungen sogar Kleidung, die farblich und stilistisch aufeinander abgestimmt war, wenn man von den Goldkäferschuhen aus vergoldetem Leder absah. Vorhin hatte sie Marzipan und Spekulatius erstanden und futterte nun ununterbrochen. Sie ernährte allerdings auch zwei.
Es ging ihr gut. Die Arbeit als Assistentin von Max Bodenstein gefiel ihr, sie bereitete ihre Dissertation vor, und dass sie wieder schwanger war, erfüllte sie mit Vorfreude. Weil sie auf keinen Fall eine weitere Fehlgeburt riskieren wollte, achtete sie darauf, sich zu schonen, auch wenn sie nie einen Weltrekord im Stillsitzen aufstellen würde.
Seinen Bruder hatte Hendrik ebenfalls lange nicht mehr so gelöst gesehen wie während der letzten Wochen. Die Aussicht auf ein Kind machte Gregor beinahe umgänglich. Neulich hatte er sogar im Restaurant seine Krawatte gelockert und sich so etwas wie ein Lächeln abgerungen.
Die Dekorationen der Kaufhäuser waren wie immer aufsehenerregend. An den Außenwänden befanden sich Leuchtreklamen, die einen Weihnachtsmann in seinem mit Geschenken beladenen Auto oder die drei Weisen aus dem Morgenland samt Sternschnuppe zeigten. Die Schaufenster waren mit Tannenzweigen, Krippen und winzigen Christbäumen mit noch winzigeren Kerzen dekoriert und lockten mit Schallplatten, elektrischen Bügeleisen und Drillbohrern zum Kauf. In einem davon hatten Konditoren das Brandenburger Tor aus Zucker, Stärkemehl und Gummiarabikum nachgebaut.
In der Haupthalle des Warenhauses Wertheim in der Leipziger Straße stand ein großer Weihnachtsbaum mit elektrischen Kerzen, vor dem ein Kinderchor Weihnachtslieder zum Besten gab. Kitschig, ja, trotzdem wurde Hendrik warm ums Herz, als er die strahlenden Kinderaugen sah, das Leuchten und Funkeln ringsumher und das Lächeln, mit dem ihn die Mutter eines der Kinder bedachte, als sich ihre Blicke begegneten. Wie sagte Augustinus so schön? Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich erfreut.
Diana zog ihn ungeduldig weiter. Seit Wochen zerbrach sie sich den Kopf über ein originelles Geschenk für Gregor und schleifte Hendrik nun auf der Suche danach durch sämtliche Abteilungen, einschließlich der für Kinderkleidung.
»Wäre das nicht etwas für meinen Bruder?«, meinte er und deutete grinsend auf eine Sammlung Herrenstöcke mit elektrischem Licht.
Diana knuffte ihn. »Sei ein bisschen ernst.« Sie begutachtete verschiedene Geschenkartikel und schüttelte jedes Mal den Kopf. »Hast du schon etwas in den Zeitungen gelesen, sind die Weihnachtsbäume aus Thüringen eingetroffen? Haben sie irgendwas angekündigt?«
»Nein, noch nicht. Wir suchen uns wieder eine schöne Tanne auf dem Tempelhofer Feld aus, ja?«
»Klar.«
Hendrik lächelte. Traditionellerweise feierten sie das Weihnachtsfest zusammen: er, Gregor, Diana und ihr Bruder. Er selbst würde das Kochen übernehmen, Weihnachtsgans natürlich, Gregor das Schmücken des Baumes, Diana würde sich mit mehr oder minder großem Geschick am Backen von Keksen und Plätzchen versuchen und ihr Bruder Michael die Musikauswahl für das Grammofon besorgen.
Hendrik freute sich auf die Festtage und das Beisammensein mit den Menschen, die ihm etwas bedeuteten. Es war im Augenblick die einzige Freude in seinem Leben. Wegen seiner kritischen Äußerungen über Hindenburg boykottierten immer wieder Studenten seinen Unterricht, einige forderten gar, ihm den Lehrauftrag zu entziehen. Selbst einige Kollegen unterstützten die Aufwiegler. Der Rektor der Universität machte ihm ebenfalls das Leben schwer. Die Philosophie wurde ihm zusehends verleidet. Dazu trugen natürlich auch Veranstaltungen wie die Nietzsche-Tagung im Oktober bei, auf der Oswald Spengler allen Ernstes die Ansicht vertreten hatte, Nietzsches »Übermensch« sei in Mussolini bereits verwirklicht.
»Bestimmt gibt es dieses Jahr wieder eine öffentliche Weihnachtsfeier mit Musikdarbietung im Lustgarten«, sagte Diana. »Kommst du mit?«
»Mal sehen.« Hendrik suchte nach einer Gelegenheit, sich abzusetzen, weil er ein Geschenk für Diana besorgen wollte. »Ich schaue mal kurz zu den Uhren, ja?«, sagte er. »Ich treffe dich bei den Springbrunnen im Onyxsaal, in einer halben Stunde. In Ordnung?«
»Ist gut.«
Das ging ja leichter als gedacht! Zufrieden entfernte er sich von Diana, begab sich statt zu den Uhren in die Bücherabteilung – und wäre beinahe in Josephine hineingelaufen. »Oh, hallo!«, entfuhr es ihm.
»Guten Tag, Hendrik.«
»Auch Weihnachtsgeschenke kaufen?«
Sie nickte.
Gut sah sie aus. Sehr gut sogar. Mit geröteten Wangen und Augen, in denen sich die Aufregung des Weihnachtstrubels widerspiegelte. Sie blickte sich um, vermutlich, um herauszufinden, ob Diana in der Nähe war. Hendrik erwartete halb, dass sie so etwas sagen würde wie »Allein hier?«, aber sie tat es nicht.
»Wie geht es dir?«, erkundigte sie sich.
»Prima«, log er. Seufzte. »Schlecht«, gab er zu.
»Ärger mit den Studenten?«
Wie gut sie ihn doch kannte! »Es wird immer schlimmer. Das Unterrichten macht mir keinen Spaß mehr.«
»Tut mir leid zu hören.« Sie drehte ihren Ring am Finger.
Die Geste verriet ihm, dass sie nicht weniger verlegen war als er. Ob sie sich immer noch mit diesem Offizier traf?
»Dabei kannst du so mitreißend sein, wenn du von deinen Philosophen erzählst.«
»Danke für die Blumen. Und bei dir? Was machen die Kinder in deiner Gemeinde? Stehst du immer noch eurem Pfarrer bei, wenn’s Probleme gibt?«
Sie nickte. »Erinnerst du dich an die Drillinge? Ihre Mutter hat endlich eine Entziehungskur angefangen.«
»Das ist gut.«
»Außerdem arbeite ich im Waisenhaus.«
»Ja?«
Sie hatte eine bestimme Art zu lächeln, die ihn stets für sie eingenommen hatte. Es begann an den Mundwinkeln und breitete sich von da über ihr Gesicht aus.
»Ich wollte mich nützlich machen«, sagte sie.
Während des Gesprächs hatten sie mehrmals Kunden ausweichen müssen, denen sie im Weg standen. Jetzt zwängte sich eine dicke Frau zwischen ihnen hindurch und blickte sie dabei böse an.
»Tja, ich sollte dann mal wieder«, meinte Josephine.
Hendrik hätte sie gern umarmt, aber er unterließ es. »Schön, dich getroffen zu haben.«
»Ich habe mich auch gefreut, dich zu sehen.« Sie machte eine unwillkürliche Bewegung, als wollte sie ihm die Hand reichen, nickte ihm stattdessen zu und ging Richtung Freitreppe davon.
Hendrik sah ihr nach. Kurz bevor sie aus seinem Blickfeld entschwand, drehte sie sich noch einmal zu ihm um und lächelte.
Ich hätte ihr sagen sollen, wie gut sie aussieht. Hendrik atmete schwer, wandte sich dann wieder den Regalen zu und streifte durch die Abteilungen auf der Suche nach einem Geschenk für Diana, aber mit dem Herzen war er nicht bei der Sache. Als er eine halbe Stunde später dem Onyxsaal zustrebte, hatte er nichts gekauft.
Diana erwartete ihn schon. »Erfolgreich?«
Er schüttelte den Kopf. »Irgendwie bin ich heute unentschlossen.«
Sie traten auf die Straße. Autos drängten sich dicht an dicht, mit Paketen beladene Menschen hasteten vorbei. Ein Weihnachtsmann fuhr auf einem Motorrad eine Spielwarenreklame spazieren. Die Heilsarmee bat um Spenden. Da es bereits schummrig wurde, waren die Straßen hell erleuchtet, in den Schaufenstern glitzerte es, überall buhlten Leuchtreklamen um die Aufmerksamkeit der Passanten. Berlin, flächenmäßig die größte Stadt der Welt und von der Bevölkerungsdichte her nach New York und London die drittgrößte, zeigte sich in vorweihnachtlichem Glanz. Fehlte nur noch der Schnee.
»Was meinst du«, überlegte Diana, »wollen wir noch schnell dem Weihnachtsmarkt auf dem Arkonaplatz einen Besuch abstatten?«
»Warum nicht?« Vielleicht half das bunte Gewimmel, seine Gedanken zu zerstreuen.
Sie nahmen eine der Straßenbahnen, die seit vergangenem Jahr beheizt wurden und eine Temperatur von mindestens zehn Grad gewährleisteten. Die Heizkörper wurden mit dem Fahrstrom betrieben, und Diana, die leicht fror, sah immer zu, dass sie direkt neben einem solchen Heizkörper zu sitzen kam.
Überhaupt war der technische Fortschritt nicht aufzuhalten. Ein in New York lebender russischer Emigrant hatte einen Fotomat konstruiert, der nach Einwurf einer Fünfundzwanzig-Cent-Münze in wenigen Minuten acht Fotos in verschiedenen Posen lieferte. Vorgestern war im Haupttelegrafenamt in der Oranienstraße, dem Knotenpunkt des gesamten elektrischen Verkehrs Europas, der Bildtelegrafendienst Berlin–Wien eröffnet worden, der demnächst auch in den Dienst der preußischen Polizei gestellt werden sollte. Fortan bestand die Möglichkeit, Steckbriefe in wenigen Minuten über ganz Deutschland zu verbreiten. Und Gregor hatte im vergangenen Monat die Flucht eines Mörders verhindert, indem er ein Zugtelefon benutzte, das Gespräche durch eine Wagenantenne und eine neben den Gleisen verlaufende Drahtleitung ermöglichte.
Als sich Hendrik und Diana dem Arkonaplatz näherten, war der Duft von Tannen und Gebäck schon von Weitem zu riechen. Fliegende Händler, die den Hütern der Ordnung seit jeher ein Dorn im Auge waren, säumten die Straße: Kriegsinvalide, Schausteller und Arbeitslose, die selbst gefertigte Puppenstuben und Hampelmänner, Knarren und Scherzartikel feilboten. Die heimischen Händler sahen die Konkurrenz nicht gern und versuchten jedes Jahr aufs Neue, sie per Gesetz aus der Stadt zu vertreiben. Überall, wo noch ein Fleckchen frei war, hatten sich Kinder postiert und verkauften hüpfende Frösche zu zehn Pfennig, laufende Mäuse, Wunderkerzen und Postkarten, immer auf der Hut vor der Polizei.
Zu Hendriks und Dianas Überraschung war ein Teil des Platzes abgesperrt, von einer dichten Traube Menschen umringt und von Polizisten bewacht. Sie näherten sich der Absperrung und erkannten einen der Wachtmeister.
»Was ist denn los?«, wollte Diana wissen.
»Ach, guten Abend, Frau Lilienthal«, erwiderte der Wachtmeister. »Ein Mord. Ihr Mann ist schon hier.«
Diana reckte den Kopf. Tatsächlich. Gregor hockte neben einer Leiche und ließ den Tatort auf sich wirken, wie so oft. Edgar Ahrens, sein Assistent, war ebenfalls vor Ort und unterhielt sich mit einem Mann der Spurensicherung. Er winkte ihnen zu, als er sie erblickte.
»Dürfen wir …?«, fragte Diana mit treuherzigem Augenaufschlag.
Der Wachtmeister sah nach links und rechts und wies sie dann mit einer schnellen Kopfbewegung an durchzugehen.
»Danke«, flüsterte sie.
Gregor war anscheinend mit seiner Untersuchung fertig, denn er erhob sich gerade, als Hendrik und Diana auf ihn zugingen, und drehte sich um.
Diana setzte zu einer Entschuldigung an. »Wir wollten bloß zum Markt, und da –«
»Die Vergangenheit holt einen immer ein«, sagte Gregor. Seine Augen blickten durch sie hindurch. »Immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet.«
»Was ist los?«
Jetzt erst schien er sie zu erkennen, und sein Blick wurde wieder klar. Er sah sich nach Edgar um. »Wir fahren zu seinem Büro«, sagte er.
Edgar stutzte. »Er hat ein Büro? Woher weißt du das?«
Aber Gregor stapfte bereits davon.
»Wir kommen mit«, entfuhr es Diana. Ihr Wunsch entsprang nur zur Hälfte kriminalistischer Neugier, sie sah besorgt aus.
Hendrik war es auch. Es brauchte mehr als einen Mord, um seinen Bruder zu erschüttern. Und er war erschüttert, das war offensichtlich. Warum? Es lag nicht an den Umständen des Todes, so viel stand fest. Also warum dann? Was verband ihn mit dem Toten?
2
Während der Fahrt sagte Gregor kein Wort. Erst kurz vor dem Ziel brach er sein Schweigen. »Er heißt Golo Bartels«, presste er hervor. »Im Krieg war er mein Unteroffizier.« Mehr war nicht aus ihm herauszubekommen.
Diana hätte ihn gern aufgemuntert, aber sie wusste, wenn er sich in sich zurückzog, konnte ihn nichts erreichen. Besonders wenn es um den Krieg ging. Dabei war er im Laufe der Jahre offener geworden, was das betraf. Manchmal konnte er über das eine oder andere Erlebnis an der Front sprechen, gelegentlich sogar über Lilly, seine erste Frau. Auch seine Albträume waren verschwunden.
Früher war er manchmal nachts aufgeschreckt. Nicht mit einem Schrei – nie hatte er geschrien –, aber seine Hände, die das Kissen oder die Decke oder manchmal auch ihre Handgelenke packten, waren wie Stahlklammern gewesen, und es hatte sie alle Kraft gekostet, ihn zu beruhigen. Das war unheimlich gewesen. Beängstigend. Manchmal hatte sie geweint, wenn er wieder eingeschlafen war, weil sie es nicht ertrug, ihn in diesem Zustand zu erleben, weil sie sich so sehr wünschte, ihm einen Teil seiner Last abnehmen zu können, und zugleich wusste sie, dass das unmöglich war. Aber das war Jahre her. Sie hatte geglaubt, das Schlimmste sei überstanden. So, wie er sich gerade verhielt, war sie da nicht mehr sicher.
Der Wagen bog in eine nur schwach beleuchtete Seitenstraße ein und hielt.
Das Büro des Toten befand sich im Erdgeschoss eines heruntergekommenen Hauses. Edgar probierte sämtliche Schlüssel, die Golo Bartels bei sich gehabt hatte; einer passte. Die vier traten ein.
Es roch nach kaltem Zigarrenrauch. Die Teppiche waren voller Flecken, die jemand vergeblich versucht hatte zu entfernen. Die Möbel wiesen Schrammen auf, hier und da platzte der Lack ab. Das beschädigte Polster eines Sessels war notdürftig geflickt worden. Auf dem Schreibtisch lagen Papiere kreuz und quer, an einer Seite drohte ein Aktenberg jeden Augenblick umzustürzen. Auf dem Beistelltisch stand ein Teller mit Essensresten, die bereits schimmelten. Golo Bartels schien nicht zu den ordentlichsten Menschen zu gehören.
Gregor war zunächst im Türrahmen stehen geblieben, um die Atmosphäre des Raumes in sich aufzunehmen. Jetzt machte er sich mit Edgar daran, die Papiere zu sichten. Alles, was sie einer näheren Untersuchung für wert befanden, wanderte in einen Korb, den sie zu diesem Zweck mitgebracht hatten. Diana und Hendrik hielten sich zurück, um nicht zu stören.
»Die Geschäftsunterlagen nehmen wir komplett mit«, sagte Gregor zu seinem Assistenten. Der Aktenberg wanderte in den Korb. »Sieh zu, ob du etwas findest, was uns über seine Aktivitäten in den letzten Tagen Aufschluss gibt, einen Kalender oder dergleichen.«
»Ist gut.«
»Kannst du Wertsachen entdecken?«
»Eine Handvoll Geldscheine, mehr nicht.« Edgar öffnete eine Schublade und leerte den Inhalt auf dem Tisch aus. »Kontoauszüge«, sagte er.
Gregor kam herüber und blätterte sie durch. »Ein Haufen Transaktionen«, meinte er. »Tu die Sachen zu den anderen.«
Der Korb füllte sich zusehends.
Diana hätte am liebsten mitgeholfen. Untätigkeit war nichts für sie. Aber Gregor wüsste das nicht zu schätzen. Außerdem hatte sie sich doch vorgenommen, sich zu schonen. Obwohl es natürlich bis zur Geburt noch lange hin war. Es würde ein Frühlingskind werden, vielleicht sogar ein Sommerkind. Ein gutes Omen. Nein, lieber nicht zu früh freuen. Wenn sie sich zu früh freute, würde eine neuerliche Fehlgeburt umso mehr schmerzen. Diana verscheuchte die Gedanken. Sie durfte nicht zu viel über das Kind nachdenken, das in ihr heranwuchs. Am besten überhaupt nicht. Dann ging vielleicht alles gut.
In einem Schrank entdeckten Gregor und Edgar Unmengen an Listen. Von Wehrverbänden, Vereinen, Arbeitsgemeinschaften. Von Uniformen, Zelten, Tornistern, Werkzeugen, Waffen. Außerdem Flugblätter über Veranstaltungen des Stahlhelm. Noch mehr Material für den Korb.
Ein paar Briefe fanden sich ebenfalls. Gregor nahm einen in die Hand und überflog die Zeilen. Diana beobachtete, wie sich sein Mund zu einem Strich verhärtete, als er die Unterschrift las. Mit einer jähen Bewegung warf er den Brief zu den anderen in den Korb. Diana reckte sich, um einen Blick darauf zu erhaschen. Ottmar von Mörike. Der Name sagte ihr nichts.
Gregor stand am Schreibtisch, scheinbar vertieft in einen weiteren Brief. Wer ihn nicht kannte, für den wirkte er konzentriert wie immer. Aber Diana sah, dass sein Blick in die Ferne gerichtet war, und erst nach einer Weile zwang er sich dazu, in die Gegenwart zurückzukehren. Die Angelegenheit machte ihm mehr zu schaffen, als er zugab.
»Kommst du allein zurecht?«, wandte er sich an Edgar. »Ich möchte die Nachbarn befragen.«
»Klar.«
Gregor stakste zur Tür. Diana folgte ihm und bat Hendrik mit einem Blick hierzubleiben. Ob er sie verstand oder Edgar aus Interesse weiter zuschaute, er kam jedenfalls nicht mit. Draußen atmete Gregor tief durch, als käme er aus einem stickigen Zimmer. Diana legte ihm die Hand auf den Arm.
Er drehte sich zu ihr um. Berührte ihre Wange. »Ich bin froh, dass du da bist«, sagte er.
Mit diesen simplen Worten verriet er mehr, was in ihm vorging, als es ein Gefühlsausbruch vermocht hätte. Diana umarmte ihn.
»Eines Tages erzähle ich dir alles«, versprach er. »Auch den Rest.« Er atmete tief durch und rief den Kommissar in sich wach, der stets korrekt seine Arbeit tat. Dann klopfte er an die gegenüberliegende Tür.
Eine vielleicht fünfzig Jahre alte Frau öffnete. »Ja?«
Gregor zeigte ihr seine Dienstmarke. »Gregor Lilienthal, Kriminalpolizei. Ich würde Sie gern zu Ihrem Nachbarn befragen.«
»Wieso? Was ist mit ihm?«
»Er wurde ermordet.«
Sie wich einen Schritt zurück. »Wie schrecklich!«
»Was können Sie uns über Herrn Bartels sagen?«
Die Frau blickte zur Tür des Büros hinüber. »Nicht viel. Wir hatten kaum Kontakt. Hin und wieder sind wir uns im Hausflur begegnet. Einmal hat er mich um etwas Zucker gebeten.«
»Sicher haben Sie das eine oder andere beobachtet. Hatte er regelmäßige Arbeitszeiten?«
»Nein. Er kam und ging, wann er wollte. Manchmal hat er auch hier übernachtet. Er war …« Sie zögerte. »Er war oft betrunken.«
»Hatte er Besuch? Geschäftspartner?«
»Nein, nie.«
»Frauen?«
Sie wollte schon den Kopf schütteln, da fiel ihr etwas ein. »An sich nicht. Aber neulich war tatsächlich eine Frau bei ihm. Ich traf sie, als sie das Büro verließ.«
»Kannten Sie sie?«
»Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Sie weinte, als sie herauskam.«
»Weinte?«
»Ja. Sie versuchte es zu verbergen, als sie mich bemerkte, aber es war nicht zu übersehen. Draußen hat sie geschluchzt.«
»Wie sah sie aus?«
»Hübsch. Ein apartes Gesicht. Blond. Eine gute Figur hatte sie. Ich wunderte mich noch, was so jemand von Herrn Bartels will.«
»Wie alt?«
»Mitte zwanzig, würde ich schätzen.«
Diana hatte den Toten nicht von Nahem gesehen, aber nach allem, was sie im Laufe der letzten ein, zwei Stunden mitbekommen hatte, war er kein Herzensbrecher. Was also wollte eine hübsche junge Frau von ihm? Und weshalb war sie in Tränen von hier fortgegangen?
Gregor bedankte sich bei der Nachbarin und stieg die Treppen hinauf, um auch die anderen Bewohner des Hauses zu befragen. Dabei erfuhr er jedoch nichts Neues. Allgemein wurde bestätigt, dass Golo Bartels unregelmäßig arbeitete und häufig betrunken war. Die weinende Frau hatte niemand sonst gesehen.
Als sie die Treppen wieder nach unten gingen, blieb Gregor plötzlich stehen. »Ich muss mich einen Augenblick setzen«, sagte er, nahm auf einer der Treppenstufen Platz, ließ seinen Oberkörper nach vorn sinken und schloss die Augen.
»Was ist los?«, rief Diana. »Was fehlt dir? Soll ich Hilfe holen?«
Er griff nach ihrer Hand und hielt sie fest, ohne die Augen zu öffnen. »Es geht gleich wieder«, flüsterte er.
»Du machst mir Angst, Gregor. Lass mich dir helfen.«
Er drückte ihre Hand zur Beruhigung und atmete ein paarmal tief durch. Dann richtete er sich wieder auf. Sein Gesicht war bleich.
Diana setzte sich zu ihm und legte ihm den Arm um die Schultern. »Ist es wegen diesem Bartels? Was hat er dir angetan?«
»Bartels? Nichts. Na ja, fast. Er war kein angenehmer Vorgesetzter, das kann ich dir versichern. Aber darum geht es nicht.«
»Worum dann?«
»Das alles hier … Es bringt Erinnerungen zurück, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Der Krieg, die Dinge, die ich getan habe, der Mord … Ich hätte nicht gedacht, dass es mich immer noch so mitnimmt.«
»Mord?«
»Ja, es gab … Ach, egal.«
Diana umarmte ihn, so fest sie konnte. »Es ist nicht egal. Sprich mit mir! Erzähl mir, was dich bedrückt.«
»Das hier kommt einfach zu unerwartet. Dass ich auf so blutige Weise mit meiner Vergangenheit konfrontiert werde … Plötzlich steht alles wieder vor meinen Augen: die Explosionen, die Schreie, Lilly …«
Diana wusste, dass Gregor sich schuldig fühlte, weil er nicht bei seiner Frau gewesen war, als sie starb. Weil er keinen Heimaturlaub bekommen hatte. Viel mehr wusste sie nicht. »Erzähl mir davon.«
Er legte seine Hand auf ihre. »Ein andermal, Diana. Versprochen.«
Schritte kamen die Treppe hinauf. Es war Hendrik. »Wir haben alles ins Auto geschafft«, sagte er. »Edgar wartet unten.« Sein Blick wanderte zwischen den beiden hin und her. »Was ist los?«
Gregor schien mit sich zu ringen. »Ich möchte euch um einen Gefallen bitten«, sagte er. »Ich werde Männer verhören müssen, die … Männer, die zu verhören mir nicht leichtfallen wird. Ehemalige Kameraden. Ich weiß nicht, ob ich das allein durchstehe. Ich traue meinen eigenen Kräften nicht. Möglicherweise verliere ich die Beherrschung. Ich … wäre euch dankbar, wenn ihr mich dabei begleiten würdet.«
Diana schluckte. Nicht in einer Million Jahren hätte sie mit so etwas gerechnet. Gregor, der jede Einmischung in seine Arbeit immer nur widerwillig hingenommen hatte – und jetzt das! Es musste ihm wirklich schlecht gehen.
Hendrik setzte sich ebenfalls auf eine der Stufen. »Klar, Gregor«, sagte er. »Machen wir.« Er sah besorgt aus.
Gregor fuhr sich durchs Haar. »Es hat damals einen Mord gegeben, ein paar Monate vor Kriegsende. An einem meiner Kameraden. Einem Freund. Ich habe ihn nicht aufklären können. Die Männer, die ich damals verdächtigte … Es sind dieselben, die ich auch jetzt wieder verhören muss. Ich habe Akten über sie angelegt und sie all die Jahre im Auge behalten, weil ich hoffte, sie irgendwann überführen zu können.«
Das überraschte Diana nicht. Es sah Gregor ähnlich. An jedem Problem, wie groß oder klein es auch sein mochte, biss er sich fest und ließ nicht eher wieder los, bis es zu seiner Zufriedenheit gelöst war. Aufgeben kam für ihn nicht infrage.
Diana suchte Hendriks Augen. Wir müssen auf Gregor achtgeben, signalisierte sie.
3
»Der schwierigste Gang zuerst«, hatte Gregor gesagt. Daran musste Hendrik denken, während sie durch die Flure des Reichswehrministeriums geführt wurden. Er hatte keinen Schimmer, was sie erwartete. Gregor hüllte sich mal wieder in Schweigen. Er hatte sich geweigert, Diana mitzunehmen – »Nicht dorthin!« –, und sein Ton war so bestimmt gewesen, dass weder sie noch Hendrik zu protestieren wagten. Vielleicht bereute er bereits, sie beide um Hilfe gebeten zu haben. Jedenfalls war er noch zugeknöpfter als sonst, und wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, dass er seine Zähne aufeinanderpresste. Montaigne hat ganz recht, dachte Hendrik: Wir schleppen unsere Ketten mit uns.
Ottmar von Mörike erweckte den Eindruck eines Mannes, der selbst seine Zahnbürste drillen würde. Kein Haar auf seinem Kopf traute sich, falsch zu liegen, und auch der Raum war ein Muster an Ordnung. Der Offizier saß hinter einem wuchtigen Schreibtisch, schenkte ihnen kaum Beachtung, nachdem ein Adjutant sie vorgestellt und das Zimmer wieder verlassen hatte, sondern füllte weiter Listen aus, ohne ihnen einen Platz anzubieten. Hendrik war unsicher, ob er sich setzen sollte. Da sein Bruder stehen blieb, tat er es ihm gleich, zog sich aber in den Hintergrund zurück. Er wünschte, er hätte seinen Skizzenblock dabei. Zu gern hätte er von Mörike als Mandrill gezeichnet.
Gregor betrachtete das Gesicht des Mannes, Zentimeter für Zentimeter, als vergleiche er es mit einem inneren Bild.
»Nun?«, fragte von Mörike, als er schließlich aufsah.
Gregor bohrte seine Augen in die des Offiziers. Falls er eine Reaktion erwartete, wurde er enttäuscht. »Ich bin hier wegen des Mordes an Golo Bartels«, sagte er, ein Muster an Selbstbeherrschung.
»Ärgerliche Sache, das.«
»Bartels arbeitete für Sie, soviel ich weiß.«
»Richtig.«
»In welcher Funktion?«
»Er war so etwas wie mein Adjutant.«
»Aber sein Büro befand sich nicht hier im Ministerium.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»War praktischer so. Seine Aufgaben führten ihn kreuz und quer durch die Stadt.«
»Das klingt mehr nach einem Laufburschen.«
Der Offizier reagierte nicht.
»Was genau hat Herr Bartels gemacht?«, hakte Gregor nach.
»Verwaltungssachen.«
»Und dazu musste er kreuz und quer durch die Stadt laufen.«
»So ist es.«
»Würden Sie diese Verwaltungssachen bitte näher erklären?«
»Militärische Angelegenheiten. Geht Sie nichts an. Sie sind bloß Zivilist.«
Oje, dachte Hendrik, das läuft nicht gut!
Gregor lächelte, aber seine Augen blieben kalt. »Sie verkennen die Situation, Herr von Mörike.«
»Major, wenn ich bitten darf.«
»Dies ist eine kriminalistische Untersuchung. Wenn Sie sich weigern, meine Fragen zu beantworten, muss ich Sie leider ins Polizeipräsidium zitieren.«
»Militärische Angelegenheiten sind vertraulich. Was haben Sie überhaupt bisher unternommen, um den Mörder zu fassen?«
»Ich bin derjenige, der die Fragen stellt.«
Der Offizier schnaubte verächtlich.
»Wann haben Sie Herrn Bartels zuletzt gesehen?«
»Freitag. War hier zum Rapport und um neue Befehle entgegenzunehmen.«
»Welcher Art?«
»Geht Sie nichts an.«
»Nein?«
Hendrik hörte an Gregors Stimme, was seine Miene verbarg. So hatte er seinen Bruder noch nie erlebt. In der Regel war er korrekt und undurchsichtig. Es kam vor, dass unter seinem disziplinierten Äußeren Zorn hervorblitzte, aber das hier war … anders. Tödlich. Bleib ruhig, Gregor! Bleib ruhig!
»Nein.«
»Im Büro Ihres Adjutanten haben wir Einkaufslisten für militärische Ausrüstung in großem Umfang gefunden, außerdem Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass er Kontakte zu paramilitärischen Organisationen hatte. Möchten Sie dazu etwas sagen?«
»Bedauere.«
»Das sieht mir alles sehr nach Bewaffnung illegaler Truppen aus.«
»Vorsichtig mit dem, was Sie behaupten. Sie sind bloß ein kleiner Polizeibeamter, schlucken Sie keine Brocken, die zu groß für Sie sind.«
Jetzt konnte Gregor doch nicht länger an sich halten. »Sie sitzen immer noch auf dem hohem Ross, was?«, sagte er kalt. »Passen Sie auf, dass Sie nicht herunterfallen.«
»Kennen wir uns?«
»In Flandern war ich einer Ihrer Gefreiten.«
»Tatsächlich? Habe zu viele Soldaten kommen und gehen sehen, als dass ich mich an jeden einzelnen erinnern könnte.«
»Ja, für Sie waren wir nur Kanonenfutter.« Alles an Gregor zitterte. »Sie mögen mich vergessen haben, aber ich erinnere mich. Ich erinnere mich.«
Einen Augenblick lang befürchtete Hendrik, sein Bruder würde den Major packen und über den Schreibtisch ziehen.
»Wenn Sie gedient haben«, schnarrte von Mörike, »dann sollten Sie wissen, wie man einem Vorgesetzten gegenübertritt. Anscheinend habe ich damals versäumt, Ihnen Respekt beizubringen.«
Gregor hatte sich wieder im Griff. »Respekt bekommt nur der, der ihn verdient«, sagte er. »Und Ihnen ist anscheinend entgangen, dass der Krieg vorbei ist.«
»Dummkopf! Der Krieg ist nie vorbei.«
»Was haben Sie mit der Phoebus Filmgesellschaft zu tun?«
»Bitte?«
»In Bartels’ Büro fanden wir Unterlagen, die darauf schließen lassen, dass er in den Phoebus-Skandal verstrickt ist.«
»Lächerlich. Der Skandal betrifft die Marine, nicht uns. War’s das jetzt? Habe zu tun.«
Gregor legte ihm eine von Bartels’ Listen auf den Schreibtisch. »Ist das Ihre Unterschrift?«
»Sie vergeuden Ihre Zeit.«
»Nein, Sie vergeuden sie. Sie behindern eine Mordermittlung. Vielleicht sollte ich mit einem Durchsuchungsbefehl wiederkommen.«
»Tun Sie, was Sie wollen.« Ottmar von Mörike wedelte mit der Hand, eine Geste, die andeuten sollte, dass er die Befragung als beendet betrachtete.
»Wissen Sie, wer die Frau war, die neulich Herrn Bartels in dessen Wohnung aufgesucht hat?«
»Frau?« Jetzt sah der Major zum ersten Mal irritiert aus. »Absurd. Bartels pflegte keine Frauenbekanntschaften.«
»Es wurde jedenfalls eine Frau bei ihm gesehen.«
»Vielleicht zum Putzen.«
Gregor überging die Bemerkung. »Wo waren Sie Samstag am späten Nachmittag?«
»Wollen Sie mir unterstellen, ich hätte etwas mit dem Mord zu tun?«
»Beantworten Sie meine Frage.«
»Hier, im Ministerium. Es gibt ein Dutzend Zeugen dafür.«
»Ich benötige die Namen.«
Der Major sah ihn von oben herab an. »Lasse ich Ihnen zukommen. Sind wir jetzt fertig?«
Gregor nickte. Ohne ein Wort des Abschieds ging er zur Tür, schaffte es jedoch nicht, den Raum zu verlassen, ohne sich noch einmal umzudrehen. »Ich hoffe, Sie haben es getan«, presste er hervor.
4
Feuchtkalte Luft drang durch Hendriks Kleidung, kroch seinen Rücken hinauf und ließ ihn frösteln. Nebel wand sich zwischen den Bäumen hindurch, legte sich auf Moos und Flechten und bewirkte, dass die Umstehenden zu Schemen verblassten. Gut, dass Diana zu Hause geblieben war. Eine Frühaufsteherin war sie ohnehin nicht, und das Wetter hätte ihrer Gesundheit kaum gutgetan. Um diese Zeit sollte man im Bett liegen und nicht durch Brandenburger Wälder kriechen. Ohnehin hätte Gregor sie nicht mitgenommen: viel zu gefährlich.
Die Männer, die herumstanden und ihre Waffen überprüften, schienen sich auf die Wehrübung zu freuen. Feldgraue Uniformen überwogen, aber es waren auch Braunhemden zu sehen. Stahlhelm und SA organisierten die Übung gemeinsam. Der größte Wehrverband im Deutschen Reich und Hitlers Sturmabteilung empfanden sich zwar als Konkurrenten, doch einte sie der Hass auf die Republik. Einige Männer trugen ein silbermattiertes Wikingerschiff auf schwarzer Tuchunterlage auf dem linken Oberarm; wie es aussah, war also auch der verbotene Bund Wiking beteiligt. Nicht wenige Männer trugen das Eiserne Kreuz, was Hendrik unweigerlich an Diogenes von Sinope denken ließ, der Siegerkränze als Ruhmgeschwüre bezeichnet hatte.
Es befanden sich auffällig viele Oberschüler und Studenten unter den Wartenden. Der Stahlhelm, ursprünglich ein Verband ehemaliger Frontsoldaten, nahm mittlerweile auch junge Männer ohne Fronterfahrung auf, um sie militärisch auszubilden. Dass überall im Land Gepäckmärsche und Unterweisungen im Scharfschießen stattfanden, war ein offenes Geheimnis, auch wenn solche Übungen gegen den Versailler Vertrag verstießen.
Gregor hielt nach jemandem Ausschau, hatte ihn jedoch bisher nicht entdecken können. Es handelte sich um einen gewissen Guntram Beier, einen seiner ehemaligen Kriegskameraden, jetzt Mitglied beim Stahlhelm und vermutlich immer noch illegal beim Bund Wiking, so viel hatte Hendrik mitbekommen.
Die Bewaffneten beäugten sie feindselig, hielten sich angesichts von Gregors Polizeimarke aber mit Drohungen zurück, wenngleich die eine oder andere abfällige Bemerkung fiel. Vielleicht trug auch Gregors schlechte Laune dazu bei, die Männer einzuschüchtern. Die Reichswehr hatte dafür gesorgt, dass er keinen Durchsuchungsbefehl für Ottmar von Mörikes Diensträume bekam. Auch eine Vorladung des Majors ins Polizeipräsidium war verhindert worden, obwohl Gregor Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte. Der Polizeipräsident mochte sich offenbar nicht mit der Reichswehr anlegen. Jetzt stapfte Gregor mit schlecht verhohlener Wut zwischen den Möchtegernsoldaten herum und suchte Guntram Beier.
Dass die SA-Männer es wagten, in voller Montur an der Übung teilzunehmen, war an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Schließlich war die NSDAP samt ihrer Unterorganisationen im Gau Berlin-Brandenburg wegen fortgesetzter Gewalttaten verboten worden. Was Hitler allerdings nicht daran hinderte, in geschlossenen Versammlungen Hetzreden zu halten. Hendrik fand den Mann einfach nur lächerlich und war geneigt, die Bewegung als Zeitgeistphänomen abzutun. Henning Voss, einer seiner Bekannten, Schauspieler am Deutschen Theater, hatte die verbalen Attacken der Nationalsozialisten neulich als »Aufstand der Komparsen« bezeichnet. Aber Gregor nahm Hitler und seine Anhänger ernst, das gab Hendrik zu denken, schließlich verfügte sein Bruder durch die Kollegen von der Politischen Polizei, die sämtliche Versammlungen von NSDAP und KPD beobachteten, über Informationen aus erster Hand.
Die Wartenden wurden ungeduldig. Eine Gruppe war offenbar bereits losgezogen, denn man hörte Schüsse aus der Ferne, vom Nebel merkwürdig verfremdet. Auf dem Sammelplatz brach derweil ein Streit aus, der mit Fäusten ausgetragen wurde. Unter den Uniformierten gab es etliche Raufbolde, die sicher schwer unter Kontrolle zu bringen waren.
Hendrik fiel ein junger Mann auf, nicht viel älter als zwanzig, der einen Stahlhelm-Anhänger für die Hitlerbewegung zu begeistern suchte.
»Gerade wenn dich die soziale Verelendung nicht kaltlässt, müsstest du zu uns kommen«, sagte er. »Du hättest auf dem Parteitag in Nürnberg dabei sein sollen. Aufmärsche, Fackelzüge, Fahnenweihen – das vergisst keiner so leicht. Hitler vertritt eine große Idee, den Glauben an eine gerechte Welt, an einen nationalen Sozialismus. Er wird die fetten Wohlstandsbürger hinwegfegen, das verspreche ich dir. Ihr schwatzt alle nur, aber wir tun was, wir arbeiten aktiv auf den Untergang der Novemberverbrecher hin. Die NSDAP steht an vorderster Front im Kampf gegen den Judenstaat.« Er bemerkte Hendriks Blicke. »Was gucken Sie so?«
»Ich kenne Sie irgendwoher«, erwiderte Hendrik. »Habe ich Sie nicht an der Universität gesehen?«
»Und wenn?«
»Nichts. Ich war bloß neugierig.«
»Neugier kann tödlich sein.« Der junge Mann machte einen Schritt auf Hendrik zu und hielt ihm seine Walter vor die Nase, mit der er schon die ganze Zeit herumfuchtelte. Vermutlich in der Hoffnung, davon abzulenken, dass er alles andere als ein durchtrainierter Muskelprotz war. Irgendwas war mit seinem Arm, den er unnatürlich hielt, als versuche er, ihn zu schonen.
»Ich hatte nicht vor, mit Ihnen zu streiten.«
»Horst«, rief einer der Männer, die die Übung zu leiten schienen. »Horst Wessel.«
Der junge Mann drehte sich um. »Komme schon.« Er steckte die Waffe ein und eilte davon.
Horst Wessel hieß er also. Der Name sagte Hendrik nichts.
»Halte dich von diesen Leuten fern.« Gregor tauchte hinter ihm auf. »Einige von denen sind unberechenbar. Am besten, du kommst mit mir.«
Vermutlich hatte er recht. Hendrik folgte seinem Bruder durch die Menge. Die Lichtung füllte sich. Lastwagen brachten weitere Übungswillige. Die Hakenkreuzfahnen nahmen zu.
Einmal kamen sie noch an diesem Wessel vorbei, der mit einem Kameraden auf einem Baumstumpf saß. »Wir bräuchten ein Lied, das unsere Entschlossenheit preist«, hörte Hendrik ihn sagen. »Ein Marschlied. Die Fahne führt uns an, nichts hält uns auf, oder so ähnlich.« Wessel summte vor sich hin und probierte verschiedene Melodien aus.
Endlich hatte Gregor den Mann gefunden, den er suchte, und steuerte auf ihn zu. Hendrik schätzte ihn auf Anfang dreißig. Guntram Beier trug ebenfalls das Wikingabzeichen an seiner Uniform. Er sah kaum wie ein Frontsoldat aus, war nicht übermäßig groß und eher drahtig als muskulös, aber das machte sein entschlossener Blick mehr als wett. Der Mann schien unter permanentem Druck zu stehen, als würde er jeden Müllberg und jede Sandkiste erstürmen wollen, um dort seine Fahne zu hissen. Er erkannte Gregor sofort. Und schien nicht begeistert über sein Auftauchen. »Was willst du denn hier?«, fragte er.
»Mit dir sprechen.«
»Ich habe nichts zu sagen. Ich rede nicht mit Leuten, die den Büttel für die Novemberverbrecher machen.«
»Wirst du aber müssen, weil ich dich andernfalls ins Polizeipräsidium schaffen lasse.«
Die Männer in der Nähe beobachteten das Geschehen mit unverhohlenem Misstrauen, was Gregors ehemaligem Kriegskameraden unangenehm war. Er trat ein paar Schritte beiseite. »Also, was ist?«
»Golo Bartels wurde ermordet.«
»Tatsächlich?«
»Erschossen.«
Guntram Beier zuckte die Achseln.
»Es scheint dich nicht sonderlich zu kümmern.«
»Warum auch. Wegen dem wird sich keiner vor Gram verzehren. Der war immer nur auf seinen Vorteil aus. Er hat der deutschen Armee nicht gerade Ehre gemacht, das müsstest du doch am besten wissen.«
»Über Ehre wollen wir lieber nicht reden. Soviel ich weiß, bist du jetzt vorbestraft, weil du mit Gesinnungsgenossen ein Arbeiterlokal überfallen und mehrere Arbeiter schwer verletzt hast.«
»Ein Staat, der sich ans Ausland verkauft, kann mir meine Ehre nicht nehmen«, erwiderte Beier hitzig. »Im Gegenteil: Es gibt nichts Ehrenvolleres, als einen solchen Staat zu bekämpfen.«
Immer diese Fanatiker! Am liebsten hätte Hendrik John Locke zitiert: Die Stärke unserer Überzeugung ist kein Beweis für ihre Richtigkeit. Aber es war wohl besser, den Mund zu halten.
»Wenn du so denkst, wie hast du da die Revolution überstanden?«
»Gar nicht. Ich bin tot. Was an mir lebt, das bin nicht ich. Solange diese korrupte Republik besteht, existiert nur meine Hülle. Erst wenn Deutschland frei ist, wird auch meine Seele wieder frei sein.«
Gregor seufzte. Er hatte derartige Parolen vermutlich bis zum Überdruss gehört. »Was weißt du über den Mord an Bartels?«
»Wie kommst du darauf, dass ich etwas wüsste? Was habe ich mit ihm zu tun?«
»Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich weiß, dass die Reichswehr euch durch ihn finanziert, euch Waffen und Ausrüstung besorgt. Ich habe genug Material in seinem Büro gefunden, um das zu beweisen.«
Beier schwieg trotzig.
»Wann hast du Bartels zuletzt gesehen?«
»Das ist Jahre her.« Weil Gregor auf weitere Erklärungen wartete, fügte er hinzu: »Die Kontakte laufen nicht über mich.«
»Wo warst du Samstag am späten Nachmittag?«
»Im Wald.«
»Mit deinen Freunden?«
»Allein. Ich habe Schießübungen gemacht.«
»Mit anderen Worten: Du hast kein Alibi.«
»Warum sollte ich den Kerl umbringen? Ich hatte keinen Streit mit ihm. Außerdem habe ich ihn eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, das ist die Wahrheit. Was soll das überhaupt? Warum bist du so erpicht darauf, seinen Mörder zu finden? Gerade du hast keinen Grund, ihm eine Träne nachzuweinen.«
»Ob mir jemand sympathisch ist oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, wie ich meine Arbeit mache.« Gregor dachte nach. »Hast du noch Verbindung zu jemandem aus unserer Kompanie?«
»Warum sollte ich? Glaubst du etwa, ich würde mich mit einem Kameradenschwein wie Franz abgeben? Die Soldaten, die Ehre im Leib haben, sind alle hier.«
Mittlerweile waren weitere Wagen mit Männern in Uniform eingetroffen. Einer von ihnen trat jetzt zu ihnen und bemühte sich dabei, sein Hinken zu kaschieren. »Gibt’s Probleme?«, wollte er wissen.
Beier nahm Haltung an. »Guten Morgen, Herr Doktor!«, rief er.
Hendrik erkannte ihn sofort. Joseph Goebbels, der »Robespierre des Nationalsozialismus«, seit einem Jahr Hitlers Gauleiter für Berlin und Brandenburg. Die hiesige SS und SA waren ihm unterstellt und Ursache für regelmäßigen Straßenterror.
»Herr Goebbels«, sagte Gregor gedehnt. »Ich hätte mir denken können, dass ich Sie hier treffe.«
»Doktor, bitte«, erwiderte Goebbels sanft. Er lächelte, aber das Lächeln beschränkte sich auf seinen Mund.
»Sie wissen, dass diese Militärübung illegal ist?«
»Das sind Sportvereine, die Leibesertüchtigungen abhalten. Ein Kegelklub ist auch darunter.«
Gelächter bei den Umstehenden. Das gefiel ihnen, dass er einen Repräsentanten der Staatsmacht verspottete.
»In Uniform? Mit Waffen?«
»Ich kann die Leute nicht daran hindern anzuziehen, was sie gern tragen.«
»Trotz Verbot nicht tot«, grölte einer der Zuhörer. Goebbels selbst hatte diese Parole ersonnen.
Gregor ließ sich nicht irritieren. »Wird es wieder Verletzte geben wie immer, wenn Sie dabei sind?«
»Können Sie uns vorwerfen, dass wir uns wehren, wenn wir provoziert werden?«
»Es wäre das erste Mal, dass eine Provokation nicht von Ihnen ausginge. Sie versuchen aufzufallen, um jeden Preis.«
Das Lächeln auf Goebbels’ Gesicht wurde breiter. »Berlin braucht seine Sensation wie der Fisch das Wasser.«
»›Sensation‹ nennen Sie das? Die Schlägereien, die Aufmärsche in den Arbeitervierteln, wo Ihnen doch klar sein muss, dass die sich das nicht gefallen lassen?«
»Wer die Straße erobert, der erobert die Massen.«
»Und dabei nehmen Sie hin, dass auch Ihre eigenen Männer verletzt oder sogar getötet werden.«
»Idealisten, die bereit sind, ihr Leben für die gerechte Sache zu wagen.«
»Sie wollen unbedingt Blut sehen, was?«
Hendrik wusste, wovon sein Bruder sprach. In Cottbus waren sechs Schupos von Goebbels’ Männern krankenhausreif geschlagen worden. Im Februar hatte er in Berlins Arbeiterbezirk Wedding eine Großkundgebung aufgezogen, bei der die verfeindeten Parteien mit Schlagringen und Eisenstangen aufeinander losgingen. Im März wurde ein Zug gestürmt, in dem sich Männer des Roten Frontkämpferbundes aufhielten. Ergebnis: sechs Schwer- und zehn Leichtverletzte, außerdem ein demolierter Eisenbahnwagen mit zwölf Einschüssen. Anschließend waren jüdische Passanten niedergeknüppelt worden.
»Es gab eine gute Presse.«