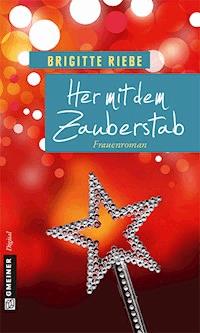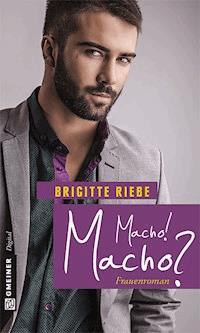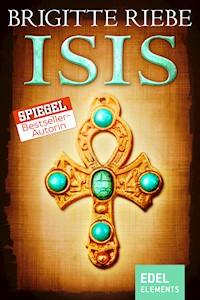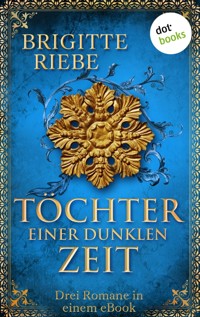Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Außergewöhnliche Frauen in gefährlichen Zeiten: der Historische-Roman-Sammelband »Schwestern der Sehnsucht« jetzt als eBook bei dotbooks. Die finsteren Zeiten des Mittelalters stellten Frauen vor schwere Herausforderungen – wer jedoch auf seine Stärke und Sehnsüchte vertraut, besteht den Test der Zeit … Voller Zuversicht will sich die schöne Sophia im 13. Jahrhundert dem Kreuzzug anschließen, um für ihren Glauben zu kämpfen – doch das Schicksal will es anders und zwingt sie zu eine folgeschweren Schritt … Im 14. Jahrhundert wird Köln von der Pest im Würgegriff gehalten. Während die Welt um sie herum im Chaos zu versinken droht, steht die Färbertochter Anna vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Darf sie ihrem Herzen folgen – auch wenn dies bedeutet, dafür alles zu opfern? Zur gleichen Zeit gerät die junge Alheit in der Kurpfalz in ganz andere Gefahr: Während des prächtigen Festes zu Ehren des Heiligen Jakobus wird eine Leiche gefunden – und niemanden scheint dies zu kümmern! Alheit beschließt, dass dieser Tod nicht ungesühnt bleiben darf – doch sie ahnt nicht, dass sie dadurch immer tiefer in ein Netz aus skrupellosen Machenschaften gerät … Drei große historische Romane um drei ganz unterschiedliche, faszinierende Frauen, die den Stürmen der Zeit trotzen – und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: der Sammelband »Schwestern der Sehnsucht« vereint die historischen Romane »Pforten der Nacht« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe, »Das Herz der Falknerin« von Rena Monte und »Der Jahrmarkt zu Jakobi« von Susanne Bonn. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die finsteren Zeiten des Mittelalters stellten Frauen vor schwere Herausforderungen – wer jedoch auf seine Stärke und Sehnsüchte vertraut, besteht den Test der Zeit … Voller Zuversicht will sich die schöne Sophia im 13. Jahrhundert dem Kreuzzug anschließen, um für ihren Glauben zu kämpfen – doch das Schicksal will es anders und zwingt sie zu einem folgeschweren Schritt … Im 14. Jahrhundert wird Köln von der Pest im Würgegriff gehalten. Während die Welt um sie herum im Chaos zu versinken droht, steht die Färbertochter Anna vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Darf sie ihrem Herzen folgen – auch wenn dies bedeutet, dafür alles zu opfern? Zur gleichen Zeit gerät die junge Alheit in der Kurpfalz in ganz andere Gefahr: Während des prächtigen Festes zu Ehren des Heiligen Jakobus wird eine Leiche gefunden – und niemanden scheint dies zu kümmern! Alheit beschließt, dass dieser Tod nicht ungesühnt bleiben darf – doch sie ahnt nicht, dass sie dadurch immer tiefer in ein Netz aus skrupellosen Machenschaften gerät …
Drei große historische Romane um drei ganz unterschiedliche, faszinierende Frauen, die den Stürmen der Zeit trotzen – und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen.
Über die Autorinnen:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem über 30 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestseller-Listen vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
Bei dotbooks veröffentlicht Brigitte Riebe ihre historischen Romane:
»Der Kuss des Anubis«
»Die Töchter von Granada«
»Schwarze Frau vom Nil«
»Liebe ist ein Kleid aus Feuer«
»Die Hexe und der Herzog«
»Die Braut von Assissi«
Auch bei dotbooks erscheint ihr Roman »Der Wahnsinn, den man Liebe nennt«.
*
Rena Monte studierte Geschichte und Rechtswissenschaft und veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen zahlreiche historische Romane.
Bei dotbooks erscheinen Rena Montes Romane »Die schöne Verräterin«, »Die Kurierreiterin« und »Die Zauberin von Toledo«. Außerdem schrieb sie für die Tempelritter-Saga die folgenden Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 1: Der Fluch der Templer«
»Die Tempelritter-Saga – Band 3: Der Emir von Al-Qudz«
Rena Monte lebte als freie Autorin in der Nähe von München und zeitweise in der Toskana. Sie verstarb 2014.
*
Susanne Bonn, geboren 1967, lebt im Odenwald. Sie übersetzt Spiele und Bücher zum Thema Freizeitgestaltung und schreibt Historisches und Fantastisches. »Der Jahrmarkt zu Jakobi« ist ihr erster Roman.
***
Sammelband-Originalausgabe Februar 2021
Copyright © der Originalausgabe von Brigitte Riebes »Pforten der Nacht« 1998 Piper Verlag GmbH, München; Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von Rena Montes »Das Herz der Falknerin« 2006 Moments in der area verlag gmbh, Erftstadt; Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von Susanne Bonns »Der Jahrmarkt zu Jakobi« 2008 Gmeiner-Verlag GmbH; Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Nancy A. Thiele, Kompaniets Taras, antonpix, tomertu
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (kb)
ISBN 978-3-96655-561-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Schwestern der Sehnsucht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe, Rena Monte, Susanne Bonn
SCHWESTERN DER SEHNSUCHT
Drei Romane in einem eBook: »Pforten der Nacht«, »Das Herz der Falknerin« und »Der Jahrmarkt zu Jakobi«
dotbooks.
Brigitte RiebePFORTEN DER NACHT
Köln im 14. Jahrhundert: Der Schwarze Tod kriecht durch die Straßen der Stadt und zeigt kein Erbarmen. Blutige Unruhen breiten sich wie Lauffeuer aus und stellen auch die Freundschaft zwischen der Färbertochter Anna und ihren beiden engsten Freunden auf eine harte Probe: der Kaufmannssohn Johannes, dem schon lange Annas Herz gehört, und Esra, der als jüdischer Unheilsbringer verschrien wird. Esra weiß, er muss fort aus Köln und sein Glück in der weiten Welt suchen. Doch was bedeutet Freiheit, wenn er das eine nicht haben kann, wonach er sich so sehr sehnt? Um Anna endlich für sich zu gewinnen, kehrt er zurück – aber das könnte seinen Tod bedeuten …
Meinen Eltern in Liebe und Dankbarkeit
»Schaut ihn an, den Engel der Pest, schön wie Luzifer und strahlend wie das Böse selber. Er steht über euren Dächern. Seine Rechte hält den roten Spieß erhoben, und mit der Linken deutet er auf eines eurer Häuser. Vielleicht reckt er gerade den Finger gegen eure Tür. Der Spieß erdröhnt auf dem Holze, und in diesem Augenblick tritt die Pest bei euch ein ... und auf der blutigen Tenne des Schmerzes werdet ihr gedroschen und zur Spreu geworfen.«
Albert Camus, »Die Pest«
Prolog
Ihr Gesicht. Nur immer ihr Gesicht. Es verfolgte ihn im Wachsein und erst recht in den wilden, fieberhaften Träumen, die ihn schon seit einiger Zeit überfielen und morgens zerschlagen und schuldbewußt erwachen ließen. Unablässig war es bei ihm, wohin er ging, was immer er tat, mit wem er auch sprach. Manchmal fühlte er sich ganz schwerelos dabei, leicht wie eine Feder im Wind, dann wieder kam es ihm vor, als stürze er ohne Vorwarnung in einen tiefen Abgrund, genarrt durch das Verhallen ihrer Stimme. Schien nicht alles, was er erlebte, plötzlich unwirklich? Jede Farbe leuchtender, die Konturen schärfer? Roch nicht alles intensiver, wenn er ihr begegnete oder sich nach ihr sehnte? War nicht selbst der leiseste Laut durch sein eigenes Echo verstärkt?
Die feste, zart bräunliche Haut. Die Nase mit dem schmalen Rücken, zu kühn für ein Mädchen, fast schon herrisch. Die Lippen, schmal und spöttisch, leicht gekräuselt und unwiderstehlich, wenn sie lachte und dabei starke, weiße Zähne sehen ließ, eine harte Linie, wenn sie zornig oder ärgerlich wurde. Am schönsten für ihn aber waren Annas Augen, weit auseinanderstehend, schiefergrau und so unergründlich wie das Meer an stürmischen Tagen, an dem er sich nicht hatte satt sehen können, als er mit seinem Onkel Jakub vor zwei Jahren aus seiner Vaterstadt Köln aufgebrochen war, um Verwandte in Flandern zu besuchen.
Jetzt waren sie geschlossen. Sie schlief, den Rücken an eine Säule in der Kapelle gelehnt, wo im letzten Sommer die große Feuersbrunst gewütet hatte, sorglos und gelöst wie ein kleines Kind; ihre Brust hob und senkte sich gleichmäßig. Schweißtröpfchen schimmerten auf ihrer hohen Stirn, und auch das braune Haar, das sich längst aus den stets ungeduldig geflochtenen Zöpfen gelöst hatte, war an den Schläfen feucht. Es lag vermutlich nicht allein an der frühsommerlichen Hitze, die sich in diesen ersten Maitagen anno Domini 1338 wie eine dumpfe Glocke über die große Stadt am Rhein gestülpt hatte und in dem rußstarrenden Kirchenschiff beinahe ins Unerträgliche gesteigert wurde. Wahrscheinlich war Anna hierher gelaufen, so schnell sie nur konnte, wie sie es meistens tat, als sei gemächliches Bewegen ihrem Wesen ganz und gar fremd. Sie ist ein Wirbelwind, dachte er zärtlich, eine frische Brise, die unbekümmert durch die Gassen fegt und selbst tiefhängende Wolken zum Aufreißen zwingt.
Er machte einen Schritt auf sie zu. Und blieb unentschlossen doch wieder in einigem Abstand vor ihr stehen. Esra David Joshua, Sohn des verstorbenen Pfandleihers Simon, Neffe des von der ganzen Gemeinde verehrten Rabbiners Jakub ben Baruch de Friedland, zögerte, sie einfach anzustupsen und aufzuwecken. Er wußte, daß Anna die Bettstatt mit den ungezogenen kleinen Stiefschwestern teilen mußte, die sie piesackten und ihr den Platz streitig machten. Daß ihr Tagwerk lang und anstrengend war und sie nach der Arbeit am Blaubach immer häufiger bis spätabends ihrer Stiefmutter in der Wirtsstube bei der Bedienung der Gäste helfen mußte. Sie war nach dem viel zu frühen Tod ihrer Mutter und ihres neugeborenen Zwillingsbruders ein Waisenkind gewesen wie er, aber sie hatte nicht das Glück gehabt, unter der Obhut einer liebevollen Tante und eines klugen Onkels aufzuwachsen, der ihm die meisten seiner zahlreichen Fragen beantworten konnte. Ihre kräftigen Hände, die nichts Kindliches mehr hatten, verrieten, wie hart die Tochter des Färbers Hermann Windeck herangenommen wurde. Spuren von blauem Waid zogen sich bis über die Ellenbogen; und unter den abgebrochenen Fingernägeln hatte sich rötliches Krapp abgesetzt.
Sie seufzte leise und räkelte sich im Schlaf. Dabei verschob sich ihr verschlissenes Kleid, das über der Brust allmählich zu eng wurde, rutschte nach oben und gab eine schlanke, unerwartet schutzlose Wade frei. Unwillkürlich schoß ihm das Blut in die Lenden, und ein seltsames, wehes Gefühl ließ ihm die Kehle ganz eng werden. Sie an sich zu reißen, in ihren Haaren zu wühlen, sie zu küssen, ihre Hüften zu berühren ...
Beschämt wandte er sich ab. Seine grünlichen Augen, die ins Blaue gehen konnten, wenn er wütend wurde, schlossen sich. Verlegen kratzte er in seinem lockigen, dunklen Haar, das kein Kamm jemals vollständig bändigen konnte. Dann wischte er sich die Hände an den Hosenbeinen ab. Gehörte er jetzt etwa auch schon zu der Horde geiler Gaffer, die ihr, wie sie ihm kürzlich errötend anvertraut hatte, in der Taverne hinterherstarrten und dabei anzügliche Zoten rissen? Die versuchten, sie im Vorbeigehen zu begrapschen und auf den Schoß zu ziehen? Abwehrend schüttelte er den Kopf.
Anna Windeck war seine Freundin seit frühen Kindestagen, und sie wurde erst im kommenden Monat zwölf. Fast auf den Tag ein Jahr jünger als er mit seinen beinahe Dreizehn. Die Feier seiner Bar Mizwa, die ihn zum Vollmitglied der jüdischen Gemeinde machen würde, war längst angesetzt. Tante Rechas umfangreiche Vorbereitungen strebten allmählich ihrem Höhepunkt zu; Jakub sprach nur noch davon, wie er ihm künftig bei allen Feierlichkeiten in der erst jüngst frisch gedeckten Synagoge zur Hand gehen könne. Alles schien so fest bestimmt, so unausweichlich. Zum erstenmal in seinem Leben empfand Esra beinahe so etwas wie Furcht davor, das zu erreichen, wonach er sich lange gesehnt hatte: erwachsen zu werden.
»Ich bin spät, ich weiß, aber ich dachte schon, diese schreckliche Lateinschule hört nie mehr auf!«
Johannes war gekommen, der dritte im Bunde. Nun waren sie komplett. Der Klang seiner Stimme hatte Anna geweckt, und sie setzte sich gerade auf. Ihre Augen begannen zu strahlen, und die schmerzhafte Enge ins Esras Kehle wuchs weiter zu. Verzweifelt rang er nach Luft. So sieht sie mich nie an, dachte er. Niemals! Immer nur ihn. Den anderen. Und er scheint sich nicht einmal besonders viel daraus zu machen.
»Du hast ja lauter Tinte im Gesicht«, sagte Anna lächelnd. »Versuchst du sie zu trinken, anstatt mit ihr zu schreiben?«
Johannes rieb seine Wange nachlässig mit Spucke und wischte anschließend die schwärzlichen Spuren an seinen Beinlingen ab, nicht aus billigem Barchent geschneidert, wie Esras und Annas Kleidung, sondern aus hellem Strickstoff gewirkt. Die enge, kurze Bux, die er darüber trug, war aus feinstem Leinen.
»Gar keine schlechte Idee! Wenn du wüßtest, wie langweilig es ist, Stunde über Stunde stillzusitzen! Bruder Matthias und erst recht der alte Pater Raffael bestehen nun mal darauf, die Lektionen so lange durchzugehen, bis sie auch der Dümmste in der Klasse verstanden hat – und das kann dauern, sag' ich euch! Dazu dieses gräßliche Rechnen auf den Zeilen, das mich schon bis in den Schlaf verfolgt. Zum Teufel mit diesem Buchstabensalat! Ich wünschte, ich müßte niemals mehr im Leben dorthin!«
Er zog eine Grimasse; sein schmaler Kopf mit dem dunkelblonden, schulterlangen Haar flog übermütig nach hinten. Mit seinen sensiblen Zügen, den Augen, hellbraun wie frisch gebrautes Bier, und der zarten Haut hatten ihn früher viele irrtümlich für ein Mädchen gehalten, aber nachdem er im letzten Jahr so in die Höhe geschossen war, konnte man sich unschwer vorstellen, was für ein Mann er bald schon sein würde. Leider war seine Stimme noch hell und knabenhaft und ließ die tiefen Töne vermissen, mit denen Esra schon ab und an prahlen konnte. Er warf dem Freund einen raschen Blick zu. Manchmal fürchtete er, er würde niemals dessen Stärke und körperliche Geschicklichkeit erreichen.
»Und ich wünschte, wir könnten tauschen, Johannes!« sagte Anna belegt. »Liebend gern würde ich statt deiner in der Schule sitzen, um Latein zu studieren und das Rechnen von Grund auf zu lernen. Aber das bleibt wohl nur ein Traum. Hilla hat mir seit neuestem sogar verboten, daß ich weiterhin von Tante Regina unterrichtet werde.«
»Auch sonntags?« warf Esra ein. Er wußte, wieviel Anna an den Stunden bei der frommen Begine lag. Sie war fast so wißbegierig wie seine kleine Schwester Lea, die nicht genug von allem Geschriebenen bekommen konnte.
Sie nickte. »Gerade sonntags. Nach dem Kirchgang haben die Leute Durst und kehren um so lieber bei uns ein. Außerdem ist sie fest davon überzeugt, daß Lesen den Charakter verdirbt – vor allem den weiblichen!« Jetzt waren die dunklen Brauen tief über die Augen gezogen. Sie traf Hillas Mimik und Gestik bis ins Kleinste. »›Das Weib steigt höher in der Tugend, aber es fällt auch tiefer in der Sünde – amen!‹ Und das ausgerechnet von der Maulwürfin, die selber halb blind ist und zu blöd, um auch nur einen Buchstaben vom anderen zu unterscheiden!«
»Ich denke, wir sollten endlich anfangen«, wechselte Johannes abrupt das Thema. »Oder habt ihr es euch inzwischen etwa anders überlegt?«
»Ich bin dabei«, sagte Anna schnell und war froh, daß ihre Stimme nicht zitterte. Sie fühlte sich ganz und gar nicht wohl an diesem schwülen, viel zu heißen Morgen. Etwas rumorte in ihrem Bauch. Wahrscheinlich hätte sie vorhin nicht so viel Wasser auf einmal trinken sollen. Seitdem sie die Wasserstelle des Klosters von St. Georg nicht mehr benutzen durften und auf die städtischen Galgenbrunnen angewiesen waren, klagte immer wieder eines der Kinder aus der Familie über Übelkeit und Durchfall. Aber was hätte sie anderes machen sollen? Hillas Grütze war klumpig und angebrannt wie meistens gewesen, die klapprige Milchkuh, die sie einige Zeit im Schuppen gehalten hatten, war längst verkauft, und sie war bereits wieder durstig.
»Und du?« wandte Johannes sich an Esra, barsch vor Ungeduld. Ton und Haltung hatte er von seinem Vater abgeschaut, dem reichen Kaufmann Jan van der Hülst, der mit Tuchen, Gewürzen und Waffen im Westen und Süden überaus erfolgreich Handel trieb.
Der Junge war blaß geworden. Er durfte es nicht tun. Nicht um alles in der Welt. Kein Jude durfte das. Es war unrein. Verboten. Geradezu undenkbar.
»Ich weiß nicht«, sagte er leise.
»Angst?« Johannes' Knabenstimme war scharf wie ein Schwerthieb. »Und ich dachte, du bist ein Kerl, der das Wort Feigheit gar nicht kennt!«
»Ist er doch auch«, warf Anna ein. »Und größer und stärker als du allemal. Beim Raufen bist immer du der Unterlegene, und das weißt du ganz genau.«
»Worauf warten wir dann noch?« Auch Johannes war aufgeregt. Seine Zungenspitze schnellte immer wieder hervor und befeuchtete die trockenen Lippen. An seinem Dusing, einem zierlichen, tief getragenen Gürtel, hing eine Ledertasche. Er öffnete sie und holte einen Dolch heraus. Der Knauf war mit Gold ziseliert, der geschwungene Stahl schimmerte. »Feinste Sarazenerware«, lobte er. »Direkt aus Venedig importiert und ein kleines Vermögen wert. Hat unser Erzbischof Walram bestellt, der alte Waffennarr, um seine Sammlung zu vervollständigen. Mein Vater würde mich vermutlich vierteilen lassen, wenn er wüßte, daß ich ihn für unsere Zeremonie ausgeliehen habe. Ich muß sehen, daß ich ihn schnellstens in die Kiste zurück schmuggle, aus der ich ihn entliehen habe. Wir sollten also keine Zeit verlieren.«
Prüfend betastete er die Klinge. Sie war scharf genug, um sich geschmeidig in jedes Hindernis zu bohren.
Esras Panik wuchs. Er mußte den Verstand verloren haben, um sich auf so etwas einzulassen! Hilfesuchend schaute er zu Anna, aber sie mied hartnäckig seinen Blick. Johannes' linkes Lid zuckte leicht, wie immer, wenn er seine innere Anspannung kaum noch beherrschen konnte. Plötzlich verzerrten sich seine Züge.
»Kleine Probe gefällig?«
Bevor die anderen noch antworten konnten, lag vor ihnen eine Schweinepfote auf einem besudelten Taschentuch. Er hob den Arm. Als die Klinge mühelos durch Haut und Fleisch glitt, floß eine Spur dünnen, hellroten Blutes. Dabei bekam seine Hose versehentlich ein paar zusätzliche dunkle Flecken ab, aber Johannes achtete nicht darauf.
Esra verspürte dumpfe Übelkeit. Sein Kopf begann zu dröhnen. Er dachte daran, wie er zum erstenmal beim Schächten zugesehen hatte, als der Shohet das Kälbchen mit dem Knie festgehalten hatte, während er vorschriftsmäßig mit dem langen Messer in einer schnellen Bewegung dem Tier die Kehle durchschnitt. Sprudelndes Blut. Und das rasche Ende. So gut wie schmerzlos, wie sein Onkel ihm versichert hatte. Ein Anblick, den er trotzdem schon als Kind kaum ertragen hatte.
»Stammt aus der heutigen Schlachtung in unserem Hof. Die Sau hat sich ordentlich gewehrt. Was ihr freilich nichts genützt hat.« Johannes ließ das Fleisch achtlos zu Boden fallen. »Na, endlich überzeugt, daß ich mich für das richtige Werkzeug entschieden habe?«
Eine Sau – hatte er das getan, um ihn zu provozieren?
Esras Unwohlsein steigerte sich ins Unerträgliche. Aber die Miene des anderen Jungen wirkte ganz unschuldig. Nein, er schien viel zu sehr mit seinen eigenen Ideen beschäftigt. Und trotzdem war die Kluft zwischen ihnen abermals tiefer geworden. Jetzt wirbelten sie alle auf einmal in wildem Durcheinander durch seinen Kopf, die scheußlichen, entwürdigenden Geschichten, die innerhalb der jüdischen Gemeinde hinter vorgehaltener Hand weitergegeben wurden. Von der frisch geschlachteten Sau zum Beispiel, auf deren Zitzen man die Kinder Israels zum Schwur zwang. Judensau nannte man sie. Sogar im Chorgestühl des Doms war eines dieser Schandbilder in Holz geschnitzt.
Nein, er durfte es nicht! Nicht, wenn er nicht alle anderen seines Glaubens verraten wollte. Er mußte es den beiden Freunden sagen. Jetzt und hier. Er versuchte zu sprechen, aber ihm entrang sich nur ein gurgelnder Ton.
Johannes hob trotzdem aufmerksam den Kopf. Der schmale, blonde Junge und der kräftige, schwarzhaarige mit der stolzen Haltung sahen sich an. Auge in Auge, ohne zu weichen. Schweigend. Wachsam.
»Ist nicht Blut die Essenz des Lebens?« Johannes beendete als erster den stummen Zweikampf. Sein Ausdruck wirkte leicht entrückt.
So ähnlich hat auch der Prediger ausgesehen, dachte Anna unwillkürlich, der im Frühjahr die Menschenmassen vor dem Dom in Aufruhr und Ekstase versetzt hat. Tagelang hatte es Unruhen in der Stadt gegeben; zwei Tote und viele Verletzte waren zu beklagen.
»Fließt es nicht in allen von uns?« fuhr Johannes fort. Er dachte dabei an Bruno de Berck, den klugen Franziskanermönch, den er seit langem heimlich verehrte, und bemühte sich, dessen Tonfall nachzuahmen.
Anna nickte klamm. Hoffentlich war es bald vorüber. Ihr Unterleib war hart und verkrampft. Drinnen stach etwas wie mit tausend Messern.
»Hat nicht Jesus seines für uns vergossen?« Die Stimme des Jungen bekam etwas Ekstatisches. »Das reine Blut des Lamms, es hat uns Menschen errettet und von unseren Sünden reingewaschen.«
Esra zuckte zusammen, aber Johannes bemerkte es nicht mehr. Anna war wie in Trance. Ihr Gesicht schien von innen zu leuchten, und er konnte kaum noch atmen. Es ist zu spät, dachte Esra resigniert, viel zu spät! Was weiß sie schon von mir, von unseren Gesetzen, der Art, wie wir seit jeher leben? Wenn ich jetzt nicht mitmache, hält sie mich für einen Feigling, und ich kann ihr nie wieder unter die Augen treten. Dann hat der andere gewonnen. Wieder einmal. Und damit vielleicht endgültig. Ich hätte früher mit der Wahrheit herausrücken müssen. Jetzt sitze ich hoffnungslos in der Falle.
»Erhebt also eure Hände!«
»Warte!« rief Anna, »einen Moment noch!«
Ohne den Blick von Esra zu lassen, spuckte sie einen kräftigen Schwall auf die Klinge. Johannes blieb nichts anderes übrig, als sein Hemd aus dem geschlitzten Wams zu ziehen und sie damit sauber zu reiben.
»Erhebt eure Hände!« wiederholte er, deutlich ungeduldiger. »Macht schon!«
Anna gehorchte. Und jetzt schloß sich auch Esra zögernd an.
»Spürt eure Herzen und sprecht mir nach diesen heiligen Eid: Wir drei, Anna, Johannes und Esra, sind hier in dieser Kapelle zusammengekommen, um unser Blut zu tauschen und damit für alle Zeiten zu verbinden. Wir schwören bei unserem Leben, uns gegenseitig zu schützen, uns untereinander zu helfen, keinen von uns dreien jemals zu verraten ...«
Während Anna betreten zu murmeln begann, ritzte Johannes als erstes sein eigenes Handgelenk. Er war tief gekommen. Die Wunde begann sofort zu bluten.
»Jetzt ihr!« Ein Befehl, keine Aufforderung.
Esra schloß die Augen. Und ließ es geschehen. Zu seiner Überraschung tat es nicht einmal weh.
Sie drückten die Wunden aneinander.
»Das Blut formt den Menschen, seinen Körper, seinen Geist und sein Herz. Wir haben es vermischt und gehören jetzt zusammen. Alle für einen. Einer für alle. Für immer und ewig.«
Langsam senkten sie die Hände. Der Bann war gebrochen, der Zauber des Augenblicks verweht, aber noch wagte keiner, etwas zu sagen.
Annas Schwindel verstärkte sich. Wütender Schmerz durchschnitt ihren Körper. Sie biß sich auf die Lippen. Was, wenn sie ernstlich krank wurde? Sie schaute nach unten und erschrak.
»Du blutest ja«, sagte Johannes im gleichen Augenblick. »Da! Dort unten. Überall.« Sein Mund verzog sich leicht. Plötzlich hatte er verblüffende Ähnlichkeit mit seiner Mutter, der herrischen, stets kränkelnden Bela van der Hülst, die aus Flandern eingeheiratet hatte und so stolz auf ihre noble Herkunft war.
Ihre bloßen Füße – ganz blutig. War sie vorhin auf der Gasse in eine Scherbe getreten, ohne es zu bemerken? Aber wieso spürte sie dann nichts?
Vorsichtig hob sie das Kleid, und schon während sie es tat, wußte sie auf einmal, was es war. Das Blut, das den ganzen Schenkel heruntergelaufen war, kam direkt aus ihrem Schoß. Der Fluch der Frauen, so hatte Hilla es genannt und dabei seltsam gegrinst. Die Knechtschaft des Blutes, der außer der Gottesmutter kein sterbliches Weib entrinnen konnte. Ihre Stiefmutter litt lautstark jeden Monat darunter, jammernd, wenn es sie traf, und erst recht wehklagend, wenn es ausblieb und sie sich schwanger fühlte, Frieda, die Magd tat es, wenn sie stöhnend schweres Holz schleppte, Kati, die Nachbarin, die soeben ihr achtes Kind trug. Sophie, Annas Mutter, war daran zugrunde gegangen. Nicht einmal Regina war zu Hillas wütender Genugtuung davon ausgenommen, die Feine, Gebildete, die mit anderen Frauen im Beginenhaus in der Glockengasse lebte und sich in ihren Augen ganz ungerechtfertigt für etwas Besseres hielt.
Sie blutete nach Frauenart, und jeder mußte es sehen. Jeder! Wie sollte sie so durch die Gassen kommen?
Ihre Kehle brannte. Was wollte sie eigentlich hier? Die beiden Freunde dort drüben waren Männer, jedenfalls beinahe – und begriffen nichts von dem, was in ihr vorging. Noch nie im Leben hatte sie sich so schutzlos gefühlt.
Dumpfes Schweigen. Schließlich griff Esra nach dem wollenen Umschlagtuch, das er gerade für seine Tante Recha bei der alten Weberin in der Rheinvorstadt abgeholt hatte, und hielt es ihr hin.
»Gib es mir einfach später zurück«, sagte er leise. »Wann immer du magst.«
Anna schlang es sich stumm um die Hüften. Dann rannte sie aus der Kapelle hinaus in das helle Sonnenlicht.
Esra und Johannes folgten ihr betreten. Der eine starrte hartnäckig zu Boden, der andere schien in weiter Ferne etwas zu fixieren. Aber auch ohne ein Wort zu verlieren, wußte jeder von ihnen, daß eben etwas geschehen war, was sich niemals mehr ungeschehen machen lassen würde. Die Zeit der Kindheit war nach diesem Mittag in der verlassenen Kapelle für alle drei unwiederbringlich vorbei.
ERSTES BUCHDer Fluß
Kapitel 1
Schwerer, feuchter Schnee fiel auf die Gassen der Stadt Köln und färbte den unebenen Boden mit den tiefen Spurrillen dunkel. Und der große Fluß stieg. Unaufhaltsam.
Anna Windeck beschleunigte ihren Schritt. Sie war unterwegs zum Kotzmarkt, der billigen Fleischbank an der Westseite des Heumarktes, um dort Speck und Innereien einzukaufen. Schwierig, auf der schlammigen Unterlage einigermaßen sicher voranzukommen, eine Mischung aus Sand, grobem Kies und Schmutz, selbst mit den festen, aber natürlich viel zu großen Stiefeln, die Guntram ihr nach langem Eigengebrauch neulich vererbt hatte. Sie versuchte so gut es ging, den dünnen, unregelmäßigen Rinnsalen auszuweichen, in denen Fäkalien wie trübe Bäche an den Hausmauern entlangflossen, und konzentrierte sich darauf, sich von den Rändern der Gasse fernzuhalten. Die Kraxe auf ihrem Rücken scheuerte. Ständig wechselte sie den Korb von Arm zu Arm und versuchte, das rutschende Tuch um Brust und Kopf festzuhalten, das sich immer mehr mit Nässe vollsog. Die wenigen, die ihr entgegenkamen oder sie überholten, schienen in Eile.
Bislang schwiegen die schrillen Glocken noch, die bei Überschwemmungen geläutet wurden. Aber einige Keller waren bereits überflutet, und die ersten derer, die in der niedriggelegenen Rheinvorstadt wohnten, hatten längst damit angefangen, Möbel und Hausrat in die oberen Stockwerke zu schleppen. Wasser konnte ein hölzernes Gebäude ebenso mühelos vernichten wie Feuer, das wußte jeder, der hier lebte. In feuchten, warmen Wintern wie diesem kam es immer wieder zu Überschwemmungen, die großen Schaden anrichteten und schon mehr als einmal zahlreiche Menschenleben gekostet hatten.
Gerade noch rechtzeitig wich sie einer dicken Bache aus, die im Morast nach Essensresten wühlte. Diese Rennsäue, wie sie im Volk genannt wurden, hatten sich in den letzten Jahren zu einem schier unlösbaren Problem entwickelt. Offiziell war ihre Haltung verboten und allein dem hiesigen Minoritenorden erlaubt, aber keiner schien sich darum zu scheren. Überall schnüffelten diese freilaufenden Tiere herum: in den stinkenden Haufen vor den Häusern, den Abtrittgruben in den schmalen Höfen, die trotz aller Vorschriften des Magistrats oft zu nah am Nachbarhaus errichtet und damit eine ständige Quelle widerlicher Gase waren, in den Handwerksbetrieben, die reichlich Abfall produzierten. Ein paar von ihnen hatten schon kleine Kinder umgerannt, andere Gebrechliche zum Straucheln gebracht. Und trotzdem wurde ihnen niemand so richtig Herr.
Versehentlich war sie in eine tiefe Pfütze getreten und spürte, wie Wasser durch die genagelten Sohlen drang. Ihre Füße in den rauhen Wollstrümpfen wurden klamm. Anna unterdrückte einen Fluch, bekreuzigte sich schnell und ging vorsichtiger weiter. Es begann zu dämmern, obwohl es noch immer Nachmittag war. Der Schnee ging in Regen über. Sie haßte diesen traurigen Monat vor Weihnachten, wenn das Licht starb und den langen, dunklen Nächten weichen mußte. Dann war man viel zu früh ins Haus verbannt, an den Spinnrocken, den klapprigen Webstuhl, oder mußte die Färbearbeiten statt draußen in dem zugigen, unzureichend beleuchteten Schuppen nahe dem Blaubach erledigen, den ihr Vater vor ein paar Jahren günstig von einem verschuldeten Zunftmitglied gekauft hatte.
Falls Hilla sie nicht im »Schwan« brauchte. Seitdem sie damit begonnen hatte, ihren Gästen nicht nur Wein, Bier und selbstgebrannten Schnaps vorzusetzen, sondern auch noch Innereien und deftige Eintöpfe, war das Wirtshaus jeden Abend brechend voll. Dabei war sie eigentlich eine lausige Köchin, die ihre mangelnden Fähigkeiten mit einem Übermaß an Gewürzen kaschierte. Was wiederum Hermann erzürnte, der argwöhnisch auf jeden Pfennig sah, der nicht für seine nebulösen Pläne verwendet wurde, über denen er nächtelang brütete. Und jetzt, wieder einmal die ersten paar Monate schwanger, schien Hilla Windeck noch mehr als sonst erpicht darauf, ihrer Stieftochter die ganze Arbeit in der Küche anzuhängen. Gegen Kritik war sie allergisch. Widerspruch konnte sie nicht ertragen. Im Gegenteil, beim kleinsten Aufmucken petzte sie sofort.
»Wenn wir diese große Trine schon durchfüttern müssen, soll sie gefälligst auch für ihr Brot arbeiten«, schimpfte sie so lange, bis ihr Mann die Geduld verlor. »Andere Mädchen sind mit fünfzehn längst unter der Haube. Aber für dein verehrtes Fräulein Tochter ist ja keiner gut genug. Wahrscheinlich wartet sie solange auf ihren Prinzen aus dem Morgenland, bis sie zu alt ist, um noch einen rechtschaffenen Handwerker abzubekommen. Und wir, wir haben sie bis zum Ende aller Tage auf dem Hals!«
Hermann Windeck, Annas Vater und seit nunmehr neun Jahren in zweiter Ehe mit Hilla verheiratet, war ein großer, starkknochiger Mann, der nicht viel redete und lautes Gezänk mehr als alles andere verabscheute. Meistens entzog er sich wortlos, was Hilla erst recht in Rage brachte.
»Scheint bei euch in der Familie zu liegen!« keifte sie weiter. »Denn nirgendwo sonst in Köln laufen so viele nutzlose Weibsbilder herum, die dabei die Nase derart hoch tragen.«
»Dann sorge du dafür, daß es in dieser Familie endlich einen Sohn gibt!« herrschte er ausnahmsweise zurück. »Vielleicht wird dann ja alles anders.«
Jeder in der Zunft wußte, warum Hermann, der Färber, damals nach dem Tod seiner Frau die blutjunge Hilla gefreit hatte. Weil sie gesund und kräftig wirkte, mit dem breiten Becken, den üppigen Brüsten und den stämmigen Schenkeln geradezu ideal zum Gebären, und er sich mehr als alles andere einen Sohn und Erben wünschte. Aber jedes Kind, das sie zur Welt brachte, war weiblich. Es gab Barbra, die Achtjährige, und Agnes, die gerade den fünften Geburtstag gefeiert hatte. Alle folgenden Schwangerschaften, regelmäßig jedes Jahr, hatten vorzeitig geendet. Mittlerweile hoffte sogar Anna inständig, daß es diesmal ein Junge sein würde – vorausgesetzt, alles ging bis zum Ende gut, und die Hebamme mußte nicht wieder zu früh gerufen werden, um seltsame, unfertige Wesen in blutige Tücher zu wickeln und im Schutz der Nacht heimlich wegzuschaffen.
Anna war beinahe am Ziel und seufzte laut, als sie die Menschenschlange sah, die vor dem niedrigen Gebäude anstand. Neben einem Rudel hungriger, halb wilder Katzen hatten sich ringsherum auch ein paar menschliche Gestalten in Lumpen plaziert, in der Hoffnung, hier etwas abzubekommen, wo Leute einkauften, die selber sparen mußten. Trotz guter Auftragslage vieler Handwerksbetriebe, trotz der sagenhaften Gewinne der reichen Kaufmannsgeschlechter gab es in Köln so viele Arme wie nie zuvor. Alte waren darunter, Kranke, aber auch immer mehr junge Menschen, die vor ein paar Jahren noch am Hafen ab und zu Gelegenheitsarbeiten erhalten hatten. Und immer mehr Frauen und Kinder.
Eines von ihnen, ein kleines Mädchen mit rotzverschmierter Nase und blonden, verfilzten Zöpfen, kam näher und drückte sich an Annas Rock. Sie trug einen Umhang über dem dünnen Kleidchen, keine Strümpfe und steckte mit ihren mageren Beinen in einem Paar viel zu großer Holzpantinen. Ihre Augen waren beinahe schwarz, das Gesicht dreieckig und fleckig gerötet. »Hast du nicht etwas zu essen für mich?« sagte sie leise. »Ich hab' solchen Hunger!«
»Ich auch«, erwiderte Anna unfreundlich und schämte sich im gleichen Augenblick. Wieso hatte sie nicht mehr von der Brotzeit genommen, die Hilla auf Hermanns Anordnung während der Wintermonate um die Mittagszeit den Gesellen und Lehrlingen servieren mußte? Aber sie haßte Stockfisch, und die Rüben waren wieder einmal faserig und zerkocht gewesen. Die Kleine konnte es sich bestimmt nicht leisten, wählerisch zu sein. Und krank war sie noch dazu. Ein Auge eiterte, und die Stimme war ganz heiser. Ob sie auch in Kirchenruinen oder ausgebrannten Häusern übernachtete, wie so viele andere? »Warte! Du bekommst etwas vom Speck ab, wenn ich eingekauft habe.«
»Speck?« Auf einmal klang sie munterer. »Richtigen Speck?« Sie stülpte die Lippen vor und versuchte ein Lächeln.
»Ja. Aber draußen. Und erst, wenn ich hier mit allem fertig bin.«
Gut, daß Hilla nicht in ihrer Nähe war! Nachdem sie an der Reihe gewesen war, ihre Vierlinge hingezählt und Kraxe und Korb bis oben beladen hatte, fing die Kleine sie sofort ab. Die anderen Bettler waren inzwischen verschwunden, wahrscheinlich auf der Suche nach lohnenderen Orten. Inzwischen war es ganz dunkel geworden; der Regen fiel stärker, und kräftige Windböen fegten um die Häuser. Ein rußender Kienspan, der vor dem Schuppen wild im Wind flackerte, war die einzige Beleuchtung.
Anna nahm eine dicke Schwarte heraus. »Aber ich habe kein Messer hier ...«, begann sie unschlüssig. »Und kein einziges Stückchen Brot.«
Das Mädchen riß ihr das Stück aus der Hand und fiel darüber her wie ein hungriges Tier. »Geht auch ohne Messer«, sagte sie zwischendrin mit vollem Mund, ohne die Beute auch nur einen Augenblick freizugeben. Ihre Zähne waren gelblich und spitz. »Und erst recht ohne Brot.«
»He, langsam, langsam, sonst wird dir noch schlecht. Hast wohl lange nichts mehr gegessen, was?«
Sie nickte und kaute weiter. Dann hielt sie inne, berührte Annas Hand. »Vergelt's Gott«, sagte sie altklug. »Die heilige Ursula, meine Namenspatronin, möge dich schützen. Und unsere gütige Mutter Gottes dich segnen, heute und immerdar. Amen.«
Plötzlich schien sie ein innerer Krampf zu schütteln. Sie beugte sich nach vorn und erbrach alles, was sie gerade gierig verschlungen hatte. Stöhnend richtete sie sich wieder auf.
»Aber du glühst ja!« Anna berührte die schmutzige Stirn. »Du hast hohes Fieber und mußt sofort ins Bett! Wer kümmert sich denn um dich?«
»Ursula hat kein Bett«, sagte die Kleine jämmerlich. »Und niemanden, der sich um sie kümmert. Mutter tot. Vater tot. Letzte Woche ist nun auch der alte Walther gestorben, der mich bei sich hat schlafen lassen.« Sie mochte elf oder zwölf sein, klein für ihr Alter und erbärmlich dürr. Manche dieser Bettlerkinder bekamen schon als Säuglinge Bier eingeflößt, damit sie langsamer wuchsen und somit eher das Mitleid der Wohlhabenden erregten. Einige von ihnen waren in regelrechten Zünften organisiert und streiften stets in Horden durch die Stadt. Es gab mehr als einen ehrbaren Bürger, der sie fürchtete. »Ich friere. Meine Füße sind schon ganz taub, und mein Bauch fühlt sich an, als wären lauter Steine drin. Nimmst du mich mit?«
Nach Hause? Das ging auf keinen Fall. Mit ihrem Vater wäre vielleicht noch zu reden gewesen, aber was Hilla zu diesem unerwarteten Besuch sagen würde, malte sie sich erst lieber gar nicht aus.
Ursula hatte zu zittern begonnen; ihre Zähne schlugen aufeinander. »Bin krank«, flüsterte sie. »Mein Hals tut mir so weh. Laß mich nicht allein im Regen – bitte!«
Anna überlegte fieberhaft. Bis zum Karmeliterkloster war es entschieden zu weit. Die Kleine hatte ja nicht einmal ordentliche Schuhe. In früheren Wintern hatte Bela van der Hülst in dem alten Wollschuppen am Weschbach ein provisorisches Armenlager eingerichtet gehabt, wo sie einmal pro Tag mit ihren Mägden erschien, um Suppe auszuschenken und Brot zu verteilen, allerdings nur so lange, bis sich die ansässigen Handwerker wegen Unrat, Radau und häufiger Diebstähle dagegen verwehrt hatten. Jetzt blieb sie lieber zu Hause, pflegte ihr Gliederreißen und die Vielzahl anderer Malaisen, die sie plagten, und ließ in mehreren Kirchen Totenmessen für Verstorbene lesen, um gute Werke zu tun.
Was blieb noch? Das alte, inzwischen längst baufällige Findelhaus an der Stadtmauer nahe dem Severinstor, das seit einigen Jahren von den Nonnen des nahe gelegenen Klosters betreut wurde? Anna, die bei ihren Spaziergängen mit Esra und Johannes niemals ohne leichten Schauer an den feuchten Mauern und dem fest verschlossenen Tor vorbeigehen konnte, erschien es eher als Zuchthaus denn als Asyl, ein Platz jedenfalls, dem niemand so einfach wieder entkam. Sanfte, kenntnisreiche Fürsorge für ein krankes Kind vermutete sie dort jedenfalls nicht.
Plötzlich wußte sie, wohin. Ihre Miene erhellte sich. Es gab keinen Ort in Köln, zu dem es sie mehr hinzog.
»Komm mit«, sagte sie zu Ursula. »Ich bringe dich an einen schönen Platz, der hell, freundlich und warm ist. Dort bekommst du zu essen, und ein Bett zum Gesundwerden findet sich sicherlich auch.«
»Meinst du etwa den Himmel?« fragte die Kleine. »Aber ich bin doch noch gar nicht tot.«
Anna mußte lachen. »In dieses Paradies kann man auch lebendig kommen«, sagte sie. »Vorausgesetzt, man hat ein bißchen Glück und kennt die Pförtnerin.«
*
Bruno de Berck hörte die Mönche zur Vesper das »Agnus Dei« singen und schlug das schmale schweinslederne Buch auf, an dessen Inhalt sein Schützling Rufus Cronen in letzter Zeit gearbeitet hatte. Seine Finger strichen beinahe zärtlich über die kunstvollen Minuskeln, die trotz ihrer Anmut und guten Lesbarkeit sein ungestümes Temperament verrieten. Die Initialen hatte er mit drolligen Tiergesichtern geschmückt, mit Hase, Ziege, Luchs und Reh, und mit flatternden Vögeln der unterschiedlichsten Arten umgeben, jene federleichten Kreaturen, die Franziskus ganz besonders lieb gewesen waren. Außer ihnen beiden wußte niemand etwas von diesem Experiment, das gefährlich werden konnte, gelangte es in falsche Hände. Es handelte sich um eine deutsche Übersetzung des Sonnengesangs, und sie stammte von keinem anderem als ihm.
»Höchster, mächtigster, guter Herr,dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehreund jeglicher Segen.dir allein, Höchster, gebühren sie,und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.«
Bruno hatte die erste Strophe halblaut gelesen. Nun lehnte er sich in seinem harten Stuhl zurück und begann sich zu entspannen. Es gab kein schöneres Gebet auf dieser seltsamen Welt voller Pein, Not und Ungemach. Und sicherlich keines, das die Seele besser tröstete und läuterte, besonders, wenn es nicht in distanziertem Latein rezitiert wurde, sondern in der Muttersprache, in der man dachte und träumte. Er fröstelte, aber hungrig war er schon lange nicht mehr. Seitdem er sich in diesem dunklen, regnerischen Spätherbst entschlossen hatte, von Allerheiligen bis zum Geburtstag des Herrn zu fasten, hatten sich zahlreiche äußerliche und innere Veränderungen vollzogen. Sein Körper war nicht länger schwer und träge, sondern er war dabei, seine frühere Straffheit und Beweglichkeit zurückzugewinnen. Ähnliches galt für seinen Geist. Eine heitere Genügsamkeit wohnte in ihm, die es ihm leichtmachte, wie schon lange nicht mehr, sich besonders intensiv auf die täglichen Pflichten zu konzentrieren.
Je einfacher, desto besser. Deshalb war ihm die körperliche Arbeit in der Zimmerei im Augenblick am allerliebsten. Er empfand es nicht als einen Akt der Buße, sondern als Gnade, sich so lange beim Hämmern und Sägen anzustrengen, bis der Schweiß in Strömen floß und alle Muskeln brannten. Erst jetzt fühlte er sich wieder bereit, die seligmachende Botschaft des heiligen Franziskus in alle Lande zu tragen: als fremder Pilger, dessen Kloster die Welt war, als demütiger Knecht des Heilands, der der Dame Armut aus reinem Herzen diente.
»Gelobet seist du, mein Herr,mit allen deinen Geschöpfen,besonders dem Herrn Bruder Sonne,der uns den Tag schenkt und durch den du uns leuchtest.Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:von dir, Höchster, ein Sinnbild.«
Wie wenig man brauchte, um das Lob von Gottes Schöpfung zu singen! Zwei kastanienbraune Kutten, eine mit Kapuze, eine ohne, Beinkleider, einen rauhen Strick um den Leib, offene Sandalen. In diesem Herbst hatte er bislang sogar auf die kratzigen Socken verzichtet. Kein Haus, kein Grundstück, keine Goldmünze. Nicht einmal Macht. Er fühlte sich um vieles leichter, seitdem er nicht Generalminister des Ordens war, sondern wieder einfacher Mönch, Bruder unter Brüdern, zum selbstlosen Liebesdienst berufen.
Die flachgedeckte, querschifflose Saalkirche, von zwei Dutzend Kerzen erhellt, besaß eine wunderbare Akustik und ließ die Männerstimmen klar und ergreifend klingen. Auch hier das Prinzip der Armut: reine Funktion, nichts, was als Pomp oder Prunk ausgelegt werden konnte. Und überall die Präsenz Gottes, der der Menschheit seinen eigenen Sohn gesandt hatte.
Er spürte, wie Tränen in seine Augen stiegen, und kehrte zu seinem Text zurück, während der Chor der Brüder inbrünstig das »Gloria« anstimmte.
»Gelobet seist du, mein Herr,für Schwester Mond und die Sterne,am Himmel hast du sie geformt,klar, kostbar und schön.«
Jedes einzelne Wort war wahr. Seine hellen Augen unter den buschigen Brauen glänzten. Er hatte eine markante, fleischlose Nase, die ihm etwas Kühnes verlieh. Ein Denker, ja, das war er, jemand, hinter dessen breiter Stirn sich schon seit jeher die unterschiedlichsten Ideen verschanzt hatten. Das war keine tote Materie! Die Welt, die Gott erschaffen hatte, pulsierte, lebte, veränderte sich. Ohne Unterlaß und immer schneller, je älter man wurde, zumindest kam es ihm so vor, aber doch stets so, wie es der ewige Plan vorgesehen hatte, auch wenn das menschliche Hirn zu eng und klein war, um es zu begreifen. Alles war vorhanden, alles in Fülle und Schönheit bereitgestellt – gäbe es die Menschen nicht und mit ihnen Habsucht, Neid und Gier, auch das Diesseits wäre kein Jammertal, sondern ein friedliches Paradies!
»... Gelobet seist du, mein Herr,für unsere Schwester Mutter Erde,die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt,mit bunten Blumen und Kräutern.«
Ja, Gott hatte diese Welt wahrhaft perfekt erdacht, in einem für menschliches Vorstellungsvermögen ganz und gar unbegreiflichen Akt allumfassender Liebe. An den Elementen – Luft, Feuer, Erde und Wasser – lag es sicherlich nicht, daß die Menschen dennoch nicht zur Ruhe kamen! Es war in ihnen selbst begründet, in der inneren Zerrissenheit, die sie ohne Unterlaß quälte, in der Gier nach Materiellem, die nichts als Unheil stiftete. Wer war denn noch bereit, heutzutage so zu leben, wie Jesus und seine Jünger es vorgelebt hatten – arm, bußfertig, in ständigem Dialog mit Gott und nur deshalb würdig, nach dem Tod Erbe und König des Himmelreichs zu werden?
Selbst viele derer, die sich durch ständigen Nahrungsentzug, wenig Schlaf, Barfußgehen und Züchtigung kasteiten, hatten den rechten Pfad verlassen. Immer häufiger traf er auf solche meist jungen emphatischen Geschöpfe, die danach brannten, in der Ekstase die Süße Gottes zu erfahren, und er fürchtete sich vor ihnen in der Tiefe seiner Seele. Wie konnten sie so in die Irre laufen? Denn es ging doch nicht darum, den Leib zu vernichten, sondern ihn zu vergessen und durch die Bindung aller Kräfte in der Liebe zu Gott gefangenzunehmen. Nur auf diese Weise war er dem Geist unterzuordnen. Wie die gelungene Zähmung eines wilden Tieres. Erst wenn das vollbracht war, ließ sich auch das komplizierte Zusammenspiel der Gefühle kontrollieren und damit beherrschen.
Kein einfacher Weg, ganz im Gegenteil.
Er war ihn viele Male schon gegangen und noch längst nicht am Ziel angelangt. Frieden war nichts, was einem zufiel. Inneren Frieden mußte man sich hart erarbeiten. Aber er war ein Suchender, immer schon gewesen. Und er würde es bis zum letzten Atemzug bleiben. Deshalb hatte er auch das Wagnis der Übersetzung auf sich genommen. Um seiner Vision zu dienen – Menschen, die zu Gott so redeten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war!
»Gelobet seist du, mein Herr,für jene, die verzeihen um deiner Liebe willenund Krankheit ertragen und Not.Selig, die ausharren in Frieden,denn du, Höchster, wirst sie einst krönen.«
Konnte er wirklich verzeihen? War er bereit, zu vergessen, was hinter ihm lag, und aus reinem Herzen denen zu vergeben, die ihm so übel mitgespielt hatten? Männern wie Tilman von Koslar, Wilhelmus Weymse, Henrik de Speculo, Werner Pixide, Konrad von Aachen und allen anderen voran Johannes Kustos, seinem früheren Adlatus, der ihn bitterer als jeder andere enttäuscht hatte?
Bruno de Berck lauschte in sich hinein. Alles in ihm war ruhig und klar und still. Er konnte, dachte er jubelnd, er war nicht länger an die Vergangenheit gebunden. Es gab eine Zukunft, weit über ein einzelnes Menschendasein hinaus, egal, wie lange er noch leben würde. In seiner Nähe wuchs ein neuer Johannes heran, frommer als der andere und klüger, begeisterungsfähig dazu, dessen Herz rein war und dessen Seele durstig. Keiner trug den Namen des Lieblingsjüngers Jesu mit mehr Recht! Er mußte nur in seine Augen schauen, um zu erkennen, welches Feuer in ihm loderte! Lief alles wunschgemäß, würde er bald schon sein Schüler werden, bestimmt dazu, die frohe Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes in die weite Welt zu tragen. »Gehe hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, zerfällt!« Die Botschaft, die der verehrte Ordensgründer damals von Gott erhalten hatte, war heute gültiger denn je.
Jetzt begann auch Bruno in seinem kleinen Zimmer zu singen, mit seinem tiefen, tragenden Bariton, und er tat es nicht auf Deutsch, sondern in der Originalsprache des Heiligen, jenes unverwechselbare Gemisch aus Latein und toskanischem Dialekt, das er während seines langjährigen Aufenthalts in Assisi kennen und lieben gelernt hatte.
»Laudato si, mi Signore,per sora nostro morto corporale,da la quale nullu homovivente po' skappare.Guai a quellike morranno ne le peccata mortali,beati quelli ke trovaràne le tue sanctissime voluntati,ka la morte secunda nol farà male.«
Welch großes, welch überwältigendes Finale!
Bruno de Berck beugte das Knie vor dem einfachen Holzkreuz in der Sakristei und senkte sein Haupt mit dem silbernen Haarkranz, für den nicht länger die vorgeschriebene Tonsur, sondern einzig und allein der unaufhaltsame Lauf der Zeit zuständig war. Er war froh, nicht mehr jung und ehrgeizig zu sein, nicht mehr alles zu erstreben, sondern sich getrost dem Willen Gottes zu unterwerfen. Wer war wirklich frei?
Nur der, der Gottes Sklave war.
Alles war gut, genau so, wie es war. Geborgen fühlte er sich, aufgehoben im Herrn, beinahe glücklich. Wie von selbst kamen die Worte über seine Lippen, die er jeden Morgen nach dem Aufwachen sprach und jeden Abend, bevor er in der kargen Zelle einschlief.
»Lobet und preiset meinen Herrnund dankt und dient ihmmit großer Demut.Amen. Amen. Amen!!!«
»Sie schläft. Endlich! Sieh nur, wie ruhig und gleichmäßig sie atmet.« Zärtlich strich Recha ihrer Nichte über das Haar, das sich vom langen Liegen verfilzt anfühlte, obwohl sie es Tag für Tag hingebungsvoll gebürstet hatte. »Keine Krämpfe mehr. Seit Stunden schon! Ich kann es kaum glauben! Laß uns in die Küche gehen, Jakub. Wenn ich nicht bald etwas in den Magen kriege, kippe ich noch um.«
»Essen? Unmöglich! Du willst sie doch jetzt nicht etwa allein lassen?« Jakub ben Baruchs Gesicht war eingefallen vor Müdigkeit und Sorge, die Schatten unter seinen Augen beinahe violett, aber Recha ließ ihm keine Ruhe. Mit seinen eckigen Schultern sah er ständig aus, als ob er den Kopf einzog.
»Hilft es ihr, wenn du auch noch krank wirst? Oder ich? Dann können wir uns gleich alle zusammen hier ins Bett legen und darauf warten, daß Esra uns verhungern läßt!« Sie redete schnell weiter, bevor ihr Mann etwas einwenden konnte. »Ja, ja, ich weiß, weil ich ihn so verwöhnt habe! Natürlich bin ich allein daran schuld. Wie immer in dieser Familie, wo scheinbar unausweichlich alles an mir hängen bleibt!« Sie klang nicht, als sei sie unzufrieden damit. Ein bißchen schimpfen mußte sie trotzdem noch. »Aber wer wollte denn seit jeher mit aller Macht einen Gelehrten aus ihm machen?«
Sie schniefte erleichtert und plapperte weiter, während sie Jakub mit sanfter Gewalt aus dem Zimmer schob. Wenigstens leistete er keinen Widerstand, auch nicht, als sie ihm in der Küche Teller und Brot hinschob und von der dicken Kohlsuppe austeilte, die in einem Topf auf dem Herd stand. Wie ihm das dünne, graue Haar zerzaust um den Kopf stand! Ohne sie würde er sich niemals kämmen und Tag für Tag in den gleichen zerknitterten Kleidern herumlaufen. Der Anblick rührte und ängstigte sie zugleich, und sie wandte sich rasch ab. Erst nach einer Weile kehrte sie an den Tisch zurück und begann selbst zu löffeln, zügig und konzentriert, wie bei allem, was sie zu sich nahm. Recha spürte, wie die Wärme langsam in ihren Körper zurückkehrte. Schnell und geschickt legte sie Holz nach, vergewisserte sich, daß frisches Wasser in der Karaffe war. Am liebsten hätte sie ihren erschöpften Mann wie ein Kind gefüttert, aber natürlich hätte Jakub dies niemals zugelassen. Das Haus – ein Tempel. Der Tisch – ein Altar. Diese Forderungen des Talmuds waren keine leeren Phrasen für sie, sondern gelebtes Leben. In Rechas Küche ging das Feuer niemals aus. Selbst am Sabbat verstand sie die Kunst, es zu hüten und doch nicht gegen die heiligen, alten Bräuche zu verstoßen.
Zu seiner eigenen Verblüffung war Jakub wirklich hungrig. Er vertilgte sogar noch einen zweiten Teller Suppe, wischte die Reste mit Brot sorgfältig aus und gönnte sich zum Nachtisch ein großes Stück von dem süßen Gebäck, das keine andere wie sie zuzubereiten wußte. Recha schaffte in der gleichen Zeit zwei davon. Man sah es ihr an, wie leidenschaftlich gern sie kochte und aß. Schon in früher Jugend war sie ein rundes, weiches Naschkätzchen gewesen, mit einer Haut wie Milch, korallenroten Locken und lustigen blauen Augen. Mittlerweile war ihr Körper schwer, und sie klagte oft über ihre dünnen, knotigen Beine, die die ganze Last tragen mußten. Sie war eine treue, tapfere Seele, das beste Weib, das er sich vorstellen konnte. Egal, ob sie beim Gehen schnaufte, egal, ob sie Falten bekam und allmählich immer mehr Silberfäden ihr Haar durchzogen, er liebte sie wie am ersten Tag. Auch wenn es nicht immer leicht für ihn auszuhalten war, daß sie alles besser wußte.
»Hörst du nichts? War da nicht nebenan ein Krächzen? Vielleicht bekommt das Kind keine Luft!« Er stand schon wieder halb, aber Recha war trotz ihrer Fülle schneller an der Tür.
»Jetzt fängst du schon an zu phantasieren, Jakub ben Baruch«, sagte sie mit gespielter Strenge, als sie wieder zurückkam und sich auf den Stuhl fallen ließ. »Da siehst du, wie weit es mit dir gekommen ist! Ähnlich wie Menschen, die ohne Wasser zu lange in der Wüste unterwegs sind. Lea schläft. Und sie wird wieder gesund werden. Salomon war heute ganz zufrieden mit ihr.«
Sie verriet ihm nicht, was der Arzt im einzelnen gesagt hatte, als sie ihn hinaus in den Hof begleitet hatte, wo ihr Gärtchen jetzt unter einer dünnen Schneedecke lag. Dazu war noch immer genügend Zeit. Ein schneller Blick zurück, zu dem Haus mit dem spitzen Giebel, dem Schieferdach und den schmalen, bleigefaßten Fensterscheiben, die unvernünftig teuer gewesen waren. Das Judentor, das jeden Abend sorgsam abgeschlossen wurde und das Kölner Judenviertel – begrenzt von dem Straßenviereck Stesse im Norden, Marspforte im Süden, Alter Markt im Osten und Unterer Goldschmied im Westen – und in ihm die Kinder Israels vor Angriffen schützen sollte, lag in beruhigender Nähe. Ihr Herz zog sich vor Liebe und Angst schmerzlich zusammen. Als feste, uneinnehmbare Burg, so hatte Recha ihr Heim seit jeher gesehen, in die nichts Böses eindringen durfte, so schrecklich die Welt draußen auch sein mochte. Nach dem Tod von Simon und Miriam, den Eltern Esras und Leas, hatte sie gehofft, daß das Leid ihrer Lieben nun für lange Zeit ein Ende haben würde.
Und doch war mit Leas Krankheit das Unvorstellbare wieder ganz nah gerückt. Jakub liebte die Kleine wie sein eigenes Kind, und ihre Pein hatte ihn selber ganz elend werden lassen. Höchste Zeit, daß auch er wieder zu Kräften kam! Die Gemeinde brauchte ihn, in diesen schwierigen Zeiten, und die Familie erst recht. Was hätte es für einen Sinn, ihn mit düsteren Prognosen zu beunruhigen?
Trotzdem ging ihr nicht aus dem Kopf, was ihr der junge Mann mit dem kurzgeschnittenen Bart und den sanften Augen anvertraut hatte. Seitdem sein Onkel nach Straßburg gezogen war, sorgte er für die Kranken der jüdischen Gemeinde. Und er schlug sich wacker, schien unermüdlich in seinem Einsatz für alle, die seine Hilfe brauchten. Inzwischen hatte er sogar die ärgsten Skeptiker zum Schweigen gebracht. Gut, er mochte noch wenig reif an Jahren sein, aber änderte sich das nicht jeden Tag ein Stück zu seinen Gunsten? Was der Altere ihm an Erfahrung voraus gehabt hatte, machte er durch seine Fürsorge und Gewissenhaftigkeit wieder wett. Das galt auch für die Behandlung seines eigenen Vaters, der an der Lungenkrankheit litt und seit dem Einsetzen des kalten Wetters sehr schwach geworden war.
»Mäßiges Fieber, leichter Schnupfen, ein bißchen Kopfschmerzen, Zwicken im Bauch – genau wie bei deiner Nichte! Leider fängt es meistens so harmlos an. Nach wenigen Tagen scheint alles vorbei. Und dann befällt innerhalb von vierundzwanzig Stunden eine Lähmung die menschliche Muskulatur. Die Beine, Oberschenkel, die Arme, sogar den Hals, wenn es ganz schlimm kommt ...« Er rieb sich die Augen, als habe er schon lange nicht mehr genug geschlafen. »Das ist jetzt zum Glück bei Lea nun überstanden. Die Rückbildung hat bereits eingesetzt und damit die Entscheidung, was steif bleibt und was wieder beweglich wird. Sie kann sich über Wochen erstrecken, vielleicht sogar Monate. Ich denke, deine Nichte hat großes Glück gehabt. Vermutlich wird sie wieder gehen können, wenngleich es möglich ist, daß gewisse Gliedmaßen aufhören zu wachsen.«
»Was meinst du damit?« Entgeistert starrte sie ihn an. »Was soll das heißen?«
Er zögerte, aber blieb bei der Wahrheit. »Es könnte sein, daß ein Bein kürzer bleibt und ihre Muskeln kraftlos werden.«
»Sie wird hinken? Ein hübsches Mädchen wie sie, dem alle Möglichkeiten offenstehen?« waren ihre atemlosen Rückfragen gewesen. Nachtschwarze Augen, seidiges Haar und zarte Glieder. Augen wie Gewitterblumen. Eine Stimme, sanft und hell. Jetzt schon schöner, als Miriam, ihre Mutter, je gewesen war. Ihre kleine Nichte war so anmutig, daß die Leute auf der Straße stehenblieben, um ihr nachzuschauen. Nicht auszudenken, daß sie fortan ein Krüppel sein sollte!
Salomon ben Daniels Stimme wurde streng, als er weitersprach.
»Sie lebt, Recha, sie hat es überstanden! Was ist dagegen ein kurzes Bein?« Nach einem Blick auf ihre entsetzte Miene fand er schnell wieder zu seinem besonnenen Ton zurück. »Voraussetzung für die Heilung ist allerdings absolute Ruhe. Keine Aufregung, keine Bewegung. Lea muß im Bett bleiben, geschont werden und die spezielle Diät erhalten, die ich dir aufgeschrieben habe. Und zwar peinlich genau! Verstanden? Ich komme übermorgen wieder, um nach ihr zu sehen.«
Nicken. Aber in Rechas Kopf drehte sich alles wie in einem Kaleidoskop. Wer würde schon eine Lahme zur Frau nehmen? Vielleicht war Leas Schicksal damit schon kurz nach ihrem elften Geburtstag besiegelt. »Du hast neulich gewisse Übungen erwähnt«, begann sie zaghaft, »mit denen kranke Glieder wieder gestreckt werden. Vielleicht könnten wir bei Lea ...«
»Nicht bevor alles abgeklungen ist – restlos! Und auch dann nur unter meiner Aufsicht. Es ist eine Möglichkeit, nicht mehr. Die Heilkunst bewegt sich auf diesem Gebiet noch auf dünnem Eis. Geduld, meine Liebe! Wir sollten Gott von ganzem Herzen danken, daß wir beide heute hier stehen und überhaupt wagen, uns über Leas Zukunft Gedanken zu machen. Viele Kinder überleben diese Krankheit nicht. Deren Eltern würden vermutlich alles dafür geben, um an eurer Stelle zu sein.«
Er hatte recht! Wie sehr hatten Jakub und sie gebangt, das Kind zu verlieren. Das Fieber, dieses fürchterliche Übergeben, das nicht aufhören wollte, das Aufbäumen, als sei ein Dämon in den zarten Körper gefahren. Nach ein paar Stunden das Bettzeug vollständig durchgeschwitzt. Und abermals hatten sie die Tasse mit dem Fencheltee an die rissigen Lippen gesetzt und mit allen Mitteln versucht, ihr wenigstens ein paar Tropfen Flüssigkeit einzuflößen. Heute hatte Lea zum erstenmal wieder nach Nahrung verlangt und die heiße Hühnerbrühe bis zur Neige ausgetrunken. Es ging aufwärts. Nun gab es nur noch Hoffen und Beten. Und Gottes unergründlichen Ratschluß.
»Ich denke, ich schaue noch kurz zur Synagoge rüber«, sagte Jakub. »Es wird Zeit, daß ich wieder an meinen Platz zurückkehre. Nicht mehr lange bis Chanukka. Und noch eine Menge verschiedenster Dinge vorzubereiten. Ich bin mit allem weit hinterher.«
»Jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst! Es ist tiefe Nacht, und es schneit. Wieso wartest du nicht lieber bis morgen und schläfst dich erst einmal richtig aus?«
Trotz seiner Müdigkeit mußte er beinahe lächeln. Keine verstand es so zu übertreiben wie seine üppige, stets überbesorgte Taube! »Es ist doch noch nicht einmal richtig Abend«, sagte er und lauschte den Glocken der nahe gelegenen Pfarrkirche von St. Alban, die gerade sieben schlugen. Die erste Kirche hier in der Stadt, die mit einem Chronometer hoch oben am Glockenturm protzte. Aber er hatte von Glaubensbrüdern gehört, daß es auch in anderen Städten immer mehr wurden. Eigentlich schätzte er ihren Klang, der sich ohne großes Federlesen in seinen Tagesablauf mischte, nicht besonders. Inzwischen jedoch hatte er gelernt, sich an ihrem lauten Läuten zu orientieren. »Außerdem schneit es nicht mehr, sondern es regnet.«
»Ja, und zwar in Strömen, so daß man nicht einmal einen Hund auf die Straße jagen würde! Wahrscheinlich steht die ganze Rheinvorstadt binnen Stunden unter Wasser, und ich wette mit dir, wir können spätestens im Morgengrauen damit anfangen, den Keller auszuräumen. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie ich mir mit den schweren Kisten beim letzten Mal den Rücken verrissen habe und anschließend tagelang nur noch gebeugt wie ein altes Weiblein umherhumpeln konnte, nur weil du wie immer in der Synagoge unabkömmlich warst! Jakub, hör mal, ich möchte wirklich nicht, daß du heute abend ...«
Sie brach ab. Es war sinnlos. So mager und knochig ihr Mann auch war, er besaß einen starken Willen und ließ sich nicht von dem abbringen, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte.
»Dann komm wenigstens bald wieder«, murmelte sie, während sie mit dem Abwasch begann. »In einer Nacht wie dieser unterwegs zu sein, welch ein Wahnsinn ... aber wenn es denn unbedingt sein muß ... ich kann inzwischen ja schon einmal das Bett vorwärmen ...«
Das Geschirr klapperte, heftiger als unbedingt notwendig. Aber er kannte sie gut genug, um zu wissen, daß sie schon beinahe besänftigt war.
»Meinst du, ich löse mich auf diesem kurzen Weg in meine Einzelteile auf?« Er zog seinen weiten Mantel an, dann die Stiefel. Setzte den spitzen Judenhut auf, den der Magistrat vor einiger Zeit verordnet hatte. Mittlerweile hatte er sich an das häßliche Ungetüm gewöhnt. Ja, er trug ihn wie viele seiner Glaubensbrüder sogar mit gewissem Stolz.
»Halt!« rief sie ihm nach, bevor er aus dem Haus war. »Bring auf jeden Fall den Jungen mit und laß ihn bloß nicht wieder bis nach Mitternacht in der Studierstube herumsitzen und sich die Augen über der Funzel verderben! Nimm ihm wenigstens etwas Kuchen mit. Esra wächst noch. Er muß dringend etwas Fleisch auf die Knochen bekommen.«
»Es gibt Nahrung für den Körper und Nahrung für den Geist«, murmelte Jakub ben Baruch. Diesen Spruch hatte sein Vater auch schon gekannt. »Und die richtige Zeit für das eine und für das andere.«
»Und es gibt Ehemänner, die immer das letzte Wort haben müssen«, schallte es hinter ihm her. »Schon aus Prinzip!«
Natürlich hatte sie sein aufsässiges Murmeln doch gehört! Er drehte sich nicht mehr um. Aber er schmunzelte in sich hinein, zum erstenmal seit vielen Tagen.
*
»Die Sache ist beschlossen. Punktum. Was für Rutger getaugt hat, wird auch gut genug für seinen jüngeren Bruder sein. Außerdem muß ich mir beizeiten Gedanken um den Fortbestand unseres Unternehmens machen. Johannes hat lange genug die Schulbank gedrückt. Er geht also im kommenden Frühjahr nach Lucca, zu Anselmo Pandolfini. Dort bleibt er als Lehrling die üblichen vier Jahre, vielleicht auch länger, wenn alles nach Zufriedenheit läuft. Morgen unterzeichnen wir den Lehrvertrag. Paolo di Marco Datini war so freundlich, wieder einmal den Mittelsmann zu spielen, wenngleich wie stets nicht ganz uneigennützig. Dieser gewitzte Karwertsche läßt schon aus Prinzip die Finger von Dingen, die ihm keinen Vorteil bringen oder an denen er nichts verdient.«
Er verzog den Mund ironisch und hielt dann inne. Seine Hände berührten beinahe zärtlich die Schnitzerei an der Stuhllehne. Feinstes Pinienholz, in Andalusien geschlagen und kunstvoll bearbeitet, das einen weiten Weg zu Wasser und zu Land zurückgelegt hatte, bis es in dieser Kölner Stube aufgestellt worden war.
»Nun denn, in Pandolfinis Kontor jedenfalls wird unser Sohn lernen, was ein Kaufmann heutzutage wissen muß – und die fremde Sprache noch dazu. Womöglich hat er sogar das Glück, in eine seiner blühenden Niederlassungen nach Spanien geschickt zu werden und dort vor Ort den modernen Fernhandel von Grund auf zu erlernen ...«
»Vier Jahre oder sogar länger!« Ein Aufschrei. »Das kannst du mir nicht antun. Schick ihn nicht weg, bitte! Nicht meinen Jüngsten! Außerdem will ich nicht, daß er so wird wie du, so kalt, so berechnend!«
Bela van der Hülst stand bebend vor ihrem Mann. Ihre Nase war glatt und klein, ihre Augen wirkten wie mit Terrakotta umschattet. Wahrscheinlich hatte sie wieder einmal nicht geschlafen, wie so oft, seitdem sie ihn gebeten hatte, nicht mehr das Bett mit ihr zu teilen. Eine Maßnahme, um ihn für die fleischlichen Sünden zu strafen, von denen er trotz all ihrem Schimpfen und Flehen nicht abließ. In Wirklichkeit quälte sie vor allem sich selbst damit. Jan van der Hülst war froh, wenn er nicht in ihre Nähe kommen mußte.
»... dazu braucht man frischen Wind um die Nase.« Der Kaufmann sprach unbeeindruckt weiter, während der feine Holzgeruch in seine Nase stieg. Er liebte all die edlen, kostbaren Gegenstände, mit denen er sich umgab. Jedes einzelne dieser erlesenen Stücke, von Menschenhand erdacht und gefertigt, erschien ihm als kleine Versicherung auf die Ewigkeit, anders als der verletzliche menschliche Körper, der krank und schwach werden konnte und unweigerlich die Spuren der Zeit verriet. »Um ein guter Kaufmann zu werden, muß man in diesen turbulenten Zeiten vor allem drei Dinge haben – Verstand, Erfahrung und Geld. Virtù eben, wie es die Italiener so treffend nennen. Persönlichkeit, Kraft und Kraftanstrengung, Können und