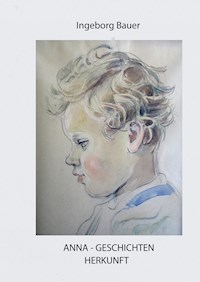Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Skulptur im 20. Jahrhundert - Leere als Tiefe Die Skulptur verlässt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren narrativen Kontext. Es kommt zu einer Reduktion der Form. Nicht mehr der sie umgebende Raum ist allein wichtig. Wenn Barbara Hepworth etwa zur gleichen Zeit wie Henry Moore ein Loch in einen Stein bohrt und damit den Innenraum einer Skulptur öffnet, ereignet sich ein Schritt in die Moderne. Die Skulptur in ihrer Dreidimensionaltät wandelt sich von etwas, das Raum einnimt, zu etwas, das Tiefe im Raum öffnet. Die Skulptur ist umgeben von Raum und schließt Raum ein. Leere und Tiefe sind nur scheinbar Gegensätze. Die von Jeanette Wintersen erwähnten Astrophysiker, darunter Albert Einstein, entdeckten die Schwarzen Löcher im Raum, die alles aufsaugen, in die Tiefe reißen, was in ihre Nähe kommt. Es sind Löcher und gleichzeitig stellen sie so etwas wie eine ultimative Tiefe dar. In den hier beschriebenen Skulpturen wird Substanz vermindert, um einen Innenraum zu schaffen, der mit der Tiefe des Unterbewussten in enigmatischer Beziehung steht. Solche Skulpturen müssen umschritten werden, leben aus der Bewegung um eine nicht dargestellte Mitte: Leere, die zur Tiefe figuriert. Das Fragmentarische ist auch wesentlich für die Ruine, die so Teilaspekten die Bedeutung eines Ganzen zukommen lässt. Die Abspaltung der englischen Kirche von Rom führt zur Zerstörung mittelalterlicher Gotteshäuser in Britannien. Bedauerlich wie dieser Vorgang war, so führt er doch zu ganz einzigartigen Wirkungen, die aus den Details dieser Bauten eigenständige Skulpturen werden lässt. Antike Figuren sind heute häufig auf Torsi reduziert und erhalten durch ihre Ablösung aus dem ursprünglichen mythischen Kontext neue Bedeutung und treten zudem näher an den heutigen Betrachter heran. Auch in musealen Räumen kommt es zu ähnlichen Begegnungen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt aber auf der bei Barbara Hepworth fast ausschließlich abstrakten Skulptur mit dennoch biografischen Konnotationen. Bei Henry Moore dagegen bleiben meist figurative Reste, wie allein die Titel andeuten, so die "Liegenden". Der Baske Eduardo Chillida gestaltet in seinen Plastiken Innenräume auf unterschiedliche Art. In Deutschland kennt jeder die Skulptur vor dem Bundeskanzleramt in Berlin, eine Verwandte der "Windkämme" von San Sebastián, die in den Atlantik hinausragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Robert Ginsberg
All and Nothing
If all were void,
there would be
nothing.
If all were solid,
nothing
could happen.
So that things
can happen,
and things
will be,
All is void
and solidity.
Robert Ginsberg
Inhaltsverzeichnis
Die Ruine als Skulptur
Der Torso als Skulptur
Das Fragment als Skulptur im musealen Raum Sir John Soane’ Museum
Skulptur entdeckt die Leere als Tiefe
“Hole turned out tobe spelt with a Was well as an H. Holes were not gaps, they were connections.”
Barbara Hepworth
Hände bei Auguste Rodin, Barbara Hepworth und Henry Moore
Naum Gabo
Constantin Brâncuşi
Amadeo Modigliani
Henry Moore: „Large Two Forms“, 1979 vor dem ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn
Hans Arp
Henry Moore
Lyrik zu Henry Moore
Eduardo Chillida
Lyrik zu Eduardo Chillida
Die Ruine als Skulptur
“The ruin is a whole with holes“
Zur Ästhetik von Ruinen –
Gedanken von Robert Ginsberg
Obwohl die Ruine ein Überbleibsel, ein zufälliger Rest eines nicht mehr intakten Gebäudes ist, bietet sie als ein neues Objekt ein ganz anders geartetes Erlebnis. Die Ruine ist nicht einfach ein beschädigtes Kunstwerk. Sie ist ein ganz anderes Kunstwerk, das vielleicht nicht mehr mit dem Original verbindet als das Material, das übrig geblieben ist. Auch ist die Ruine ästhetisch dem Original nicht notwendigerweise unterlegen. Ihr Wert kann dem Original sogar überlegen sein.
Die vorherrschende Ansicht besagt, dass die Ruine Teil eines Ganzen darstellt, das als solches nicht mehr existiert. Die Vorstellungskraft muss dann ergänzen, was dem Auge nicht mehr zugänglich ist. Die Verwüstungen durch die Zeitläufte müssen rückgängig gemacht werden, um auf diese Weise das ursprüngliche Kunstwerk wieder zugänglich zu machen, das dann nicht vollständig verloren ist. In der Praxis ist das nicht so einfach, nicht nur weil ein beträchtliches Maß an Vorstellungskraft erforderlich ist. Wir müssen auch über archäologisches und historisches Wissen verfügen, bevor unsere Rekonstruktionen zutreffend sein können. Doch auch dann entspricht diese Wiederherstellung keineswegs dem Original, holt das Ursprüngliche nicht zurück. Dazu sind drei Schritte nötig: erstens, das Original, das nicht mehr vorhanden ist, die Ruine, die nicht mehr das Original ist und die Rekonstruktion, die das Original im Blick hat, aber nicht das Original sein kann.
Die Romantik liebte Ruinen jeder Art und ließ sie geheimnisvoll, schicksalhaft oder heroisch erscheinen. In diesen Kontext gehört die Umgebung der Ruine, die Landschaft, die Tages- oder Nachtzeit, die Wetterlage – dazu gehört auch der Bewuchs, insbesondere von Efeu.
Auch die Interaktion mit der Umgebung ändert sich, wenn wir es mit der Ruine und nicht mehr mit dem früheren Original zu tun haben. Ein Baum könnte sich in der Ruine etablieren und die vertikale Ausrichtung noch einmal auf andere Weise unterstützen und variieren. Es ist nicht der Übergriff der Natur, der gemeint ist, sondern das Zusammenspiel mit der Figuration des ruinösen Gebildes.
Ruinen können Strukturen des Originals auf ihre Weise aufdecken. Es kommt darauf an, zu entdecken, was durch eine Ruine zum Vorschein kommt, das zuvor nicht da war. In so manchem Detail steckt schon ein ganzheitliches Konzept. Bevor Glaswände in der Architektur des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielten, war es nicht möglich, das Außen und Innen eines Gebäudes gleichzeitig in Augenschein zu nehmen. Die Ruine kann diese Gleichzeitigkeit herstellen. Ansätze des Daches und seine Stützen können betrachtet werden, auch wenn das Dach selber gar nicht mehr vorhanden ist. Wie in einem Puppenhaus können die Stockwerke gleichzeitig in Augenschein genommen werden, wenn die Außenmauer gefallen ist. Ganz neue Blickwinkel ergeben sich durch Durchbrüche, die so nie angelegt waren.
So können sich neue abstrakte Muster ergeben aus Türmen, Bögen, Fenstern, die in einer früheren Kathedrale so nicht sichtbar gewesen wären. Die einzelnen Strukturen, die eine Ruine offen legt, mögen in der Zwischenzeit ihren ursprünglichen Zweck verloren haben, aber etwas von diesem Zweck mag in der nun isolierten Form in einem neuen Kontext wieder aufflackern. In einer Ruine befinden wir uns nicht mehr in einem geschlossenen Gebäude. Wir können von außen durch die Wände treten und sind immer noch im Freien. Eine Ruine konfrontiert uns mit Widersprüchen, dem offenen Raum, dem direkten Übergang von Innen und Außen. Eine Ruine steckt voller Überraschungen. Die nun geradezu isolierten Teile der ursprünglichen Architektur werden auf diese Weise zur Skulptur, deren Raum die Kategorien von Innen und Außen unwesentlich erscheinen lässt.
Bolton Priory (Fotos von 1966)
Whitby Abbey (Foto von1966)
Ruinen haben sich unter schwierigen Bedingungen erhalten. Ihr struktureller Vorzug besteht in ihrem Überleben.
Meine Begegnung mit Ruinen in England
Kirkstall Abbey ist die Ruine einer Zisterzienserabtei am Stadtrand von Leeds. Nach der von Heinrich dem Achten vollzogenen Abspaltung der anglikanischen von der römisch-katholischen Kirche wurde die Abtei aufgelöst und allmählich dem Verfall preisgegeben. Das Mutterkloster war Fountains Abbey, die Primärabtei Clairvaux.
Die Gebäude wurden als Baustofflieferanten benutzt, aber auch Wind und Wetter ließen das Dach und den Turm einstürzen. Die verbliebenen Mauern stehen nun unverputzt wie ein gealterter Rohbau, sind zerbrochen, mit deutlichen Bruchstellen. Die Fenster öffnen sich gegen den Himmel. Ornamentale, skulpturale ruinöse Überreste erscheinen isoliert. Manche Wände sind ihres Strebewerks beraubt, haben ihre Stütze verloren. Ein gotischer Raum, der sich zum Himmel hin öffnet. Da wird der ursprüngliche Gedanke der Gotik noch einmal auf andere Art deutlich.
Als ich während meiner Studienzeit an der Universität Leeds zum ersten Mal einer solchen gotischen Ruine begegnete, war ich sehr beeindruckt von diesem Sich-Öffnen gegen den Himmel hin, das das Aufstrebende der Gotik auf so ideale Weise darzustellen schien. Mit der Bolton Priory am Ufer des Wharfe, ebenfalls in Yorkshire, in der Nähe der Stadt Skipton gelegen, stand ich bald darauf vor einer weiteren Ruine dieser Art. Bolton Priory war 1151 von Augustiner-Chorherren gegründet, im frühen 14. Jahrhundert von Schotten geplündert und beschädigt worden. Der Grundriss der Anlage ist durch Grundmauern teilweise markiert, ansonsten ist nur der Kirchenraum im engeren Sinn nach oben offen und mit Fensteröffnungen erhalten.
Noch weiter im Norden steht, eindrucksvoll über der Nordsee gelegen, Whitby Abbey. Die Abtei geht zurück auf das Jahr 657 und wurde wegen ihrer Synode von 664 berühmt. 1077 kam es dann zu einer Neugründung durch Benediktiner. Das war die Zeit von Wilhelm dem Eroberer. Diese Ruine übertrifft die beiden zuvor genannten bei weitem. Hier sind Kirchenfenster aus den unterschiedlichen Phasen der angelsächsischen Gotik zumindest in Ansätzen erhalten und fallen auf diese Weise vielleicht deutlicher ins Gewicht. Es handelt sich um den frühgotischen Early English Style aus dem 12.-13. Jahrhundert, den Decorated Style der mittleren Phase (13.-14. Jahrhundert) und den späten Perpendicular Style (14.—16. Jahrhundert). Das Turmpaar steht geradezu isoliert und ähnelt damit ein wenig den Rundtürmen irischer Klosteranlagen.
Die heutige Ruine war jahrhundertelang den Kräften der Natur ausgesetzt. Hoch oben über der Steilküste gelegen, konnte die Erosion von Wind und Wetter eindrucksvoll arbeiten. Wände stehen für sich da wie Kulissen, die ihrer Substanz beraubt sind, aber gerade dadurch in ihrer Selbständigkeit wahrgenommen werden. Einzelheiten des dekorativen gotischen Maßwerks, geometrische Muster in Stein gefasst, treten im Detail hervor, als plastische Ornamente zur Füllung der Fensteröffnungen oder als Blendmaßwerk am Mauerwerk, zur Gliederung an den Innenwänden und am Außenbau. Das Strebewerk ist durch einzelne Bögen und Pfeiler vielleicht noch stärker strukturierend wahrnehmbar. Überhaupt tritt der kompliziert-komplexe Skelettbau gotischer Bauten in großer Deutlichkeit hervor.
An manchen Ruinen ist ein Türsturz erhalten, eine Tür ins Nichts, in die Landschaft. Rundfenster mit Fischblasenmuster oder Vierpass erhalten isoliert besondere Aussagekraft. Gelegentlich ist eine ganze Fensterrose im ruinösen Ambiente erhalten, so in Dryburgh Abbey in Schottland. Eine solche Rose erzeugt ohne ihr buntes Glas und eingefasst von rohem rötlichem Mauerwerk eine völlig andere Wirkung. Dryburgh Abbey brüstet sich mit dem Grab des großen schottischen Barden, Sir Walter Scott (1771- 1832). Daneben befindet sich die Gedenkstätte von Feldmarschall Earl Haig of Bremersyde (1861-1928). Beide Gräber werden besucht, was wohl zum Erhalt der Ruine beiträgt. Ihre von wenig stützendem Strebewerk gehaltenen Wände betonen das steile Zum-Himmel-Strebende. Es ist vor allem die riesige, durch fünf schmale Lanzettfenster gegliederte Westwand, die der Anlage den entscheidenden Akzent verleiht.
Dryburgh Abbey
Robert Ginsberg schreibt über die Begegnung mit dieser Ruine, diesem großen Fenster in Dryburgh Abbey: “Im Wind fröstelnd schauen wir von außen durch das Fenster nach außen. Innen und außen spielen keine Rolle mehr. Das Fenster hält den Wind nicht mehr ab, noch die Wärme drinnen. Nichts ist im Fenster außer einem lichten Himmel, von Wolken befleckt.“ 1
Und nun beobachtet er, wie der Wind durch die Öffnung bläst, wie die Wolken vorbeiziehen und ein Schauspiel erzeugen. Die Ruine wird lebendig: „The beautiful is alive and well.” [Das Schöne ist lebendig und es geht ihm gut.] 2 Indem man sich in der Ruine bewegt, eröffnen sich neue Sichtweisen, ergeben sich neue Einblicke, Ausblicke.
Ähnlich gelegen ist die vielleicht berühmteste Ruine in Scotts Border-Country, dem „Heart of Midlothian“: Melrose Abbey. Melrose am Tweed, beschrieben von Walter Scott, gezeichnet von William Turner ist Inbegriff der Ruinenromantik der Borderlandschaft: „That feeling of pleasing melancholy which belongs to the region“ [Jenes Gefühl wohltuender Melancholie, das zu dieser Gegend gehört] könnte Leitmotiv dieser schottischen Landschaft sein. Fontane hält Melrose Abbey „nicht nur für die schottischste … sondern [auch für] die schönste und fesselndste“.
Melrose Abbey am Tweed
Das hat architektonische, mehr noch historische Gründe. Das Herz von Robert the Bruce soll hier begraben sein, und damit das „Heart of Midlothian“.
Bei unserem Besuch vor Jahren glühte Melrose in der späten Nachmittagssonne inmitten rot blühender Hänge voller Rhododendren - prächtiger, königlicher Purpur. Will man Fontane glauben, so geht der wohlklingende Name Melrose auf Mullroß zurück, was so viel wie Kahlenberg oder unfruchtbares Vorgebirge bedeutet. (Mull hat sich noch im Namen der Insel Mull erhalten.) Heute liegt Melrose unter einem marmorierten Himmel und erlaubt uns so, ohne Ablenkung durch die Umgebung, die Sicht auf viele kleine Details, die diesen ganz besonderen Ort ausmachen. Obwohl es sich um eine Ruine handelt, gibt es Portale, Nischen, Simse, Friese und Fenster zu entdecken, losgelöst von einer früheren Funktion. Und weil das Licht von oben ungehindert die noch erhaltenen Bauteile beleuchtet, kann der Besucher in dem feinkörnigen rotgrauen Sandstein einen ungeheuren Reichtum an Formen erkennen. So bezeichnet Fontane die fein ziselierten Kapitelle aus dem 14. beziehungsweise 15. Jahrhundert als ein Herbaricum scoticum, das Lilien, Disteln, Eichlaub, Kleeblatt, Raute eindeutig identifizierbar macht, dazu die krausen Blätter des schottischen Grünkohls (Scotch Kail).
Hier wiederholt sich das über Dryburgh Abbey Gesagte. Hier findet sich das wohl schönste Maßwerk. Unzählige Durchblicke eröffnen Ausblicke auf das Noch-Erhaltene im Detail. Es sind noch Teile einer Decke vorhanden, ohne die Farbe eines Verputzes. Es ist gerade der rote raue Stein, der Wärme ausstrahlt und den noch erhaltenen Figuren ihr eigenes Leben ermöglicht. Sie sind der Bürde ihrer tragenden Funktion auf Strebepfeilern entledigt und existieren unabhängig davon. Sie sind dem Betrachter nahe gerückt.
Ein weiterer Aspekt tritt hervor, wenn man das Skulpturenprogramm insbesondere gotischer Kathedralen betrachtet, die heute noch im Zustand ihrer Entstehung sind. Hier tritt eine Reihung von wilden Fratzen, grotesken Figuren und Dämonen zu Tage, die in ihrer Summe zweifellos für die damalige Zeit etwas Bedrohliches darstellen mussten. Rilke schreibt dazu in seinem Essay über das Werk von Rodin: „[Diese Figuren] hatte die Not geschaffen. Aus der Angst vor den unsichtbaren Gerichten eines schweren Glaubens hatte man sich zu diesem Sichtbaren gerettet, vor dem Ungewissen flüchtete man zu dieser Verwirklichung. […] So entstand die seltsame Skulptur der Kathedralen […] dieser schlichten Dingwerdung […] ihrer Ängste.“ 3
Die Kathedrale als Ruine befreit nun von der Angst, indem sie diese dämonischen Figuren durch ihre Vereinzelung aus einem System entlässt, durch das ihr erst diese Mächtigkeit zuteilwird. Das Mittelalter war eine Zeit, „deren Qual es war, dass fast alle ihre Konflikte im Unsichtbaren lagen. Ihre Sprache war der Körper“, die Figuration einer Bedrohung, einer Gewalt, die als Höllenstrafe erfahren wurde. Die Figuration wird in der Ruine Abstraktion, zur Verbildlichung eines, wie Rilke sagt „Unsichtbaren“, das wir nicht mehr in dieser Dämonie erleben. 4
Dunkeld Cathedral / Schottland
Dunkeld Cathedral am Fluss Tay ist ein besonders pittoresker Ort. Während der Chor heute noch als Gemeindekirche eine Funktion erfüllt, sind Turm und Kirchenschiff aus dem 15. Jahrhundert eine Ruine, die noch mit schönen figurativen Kapitellen und Archivolten aufwarten kann. Von einer schottischen Parklandschaft mit Flusslauf umgeben, gleicht Dunkeld einem Juwel.
Gegen den hellen Himmel erhalten die Ruinen die klare Figuration von Scherenschnitten, wie es Robert Ginsberg für die Ruine von St. Andrews in Schottland hervorhebt und in Tuschezeichnungen von eigener Hand betont herausarbeitet. Er hat sich ganz intensiv mit der Ästhetik von Ruinen befasst, und ich werde nun Bezug zu seinen Ausführungen nehmen. Er hat der Ruine von St. Andrews Cathedral ein ganzes Kapitel seines Buches „The Aethetics of Ruins“ gewidmet. Und nach eigenen Aussagen ist es diese Ruine, die in ihm vor langer Zeit die Faszination für das Thema auslöste. Es ist die Isolierung einzelner Teile, die auf diese Weise eine zuvor so nicht wahrgenommene Bedeutung erlangen. Der Bogen, das Fenster, die Mauer und das Strebewerk in St. Andrews haben keine Funktion mehr zu erfüllen. Der elegante Turm steht ohne ihre Hilfe. Es war ein Treppenturm, der den Zugang zu den oberen Stockwerken erlaubte, doch führt er jetzt nirgends mehr hin, endet direkt unter dem Himmel.
“Am Eingang der Ruine regt der ‘Ver-rückte Turm’ die Fantasie an. Durch eine verwirrende Zurschaustellung von Formen artikuliert sich der Aufwärtsschub des Turms kraftvoll gegen den Himmel. Der Schaft mit seinen vielfältigen Facetten wird von einer gefalteten Kappe abgeschlossen und wird selber in geradezu unangemessener Weise, aber doch stolz von einer Wetterfahne gekrönt. Der Turm feiert seine Loslösung von dem Gebäude durch einen raschen einvernehmlichen Aufstieg.“
“At the entrance to the ruin, the Crazy Tower, so aptly named by Marian Olin, seizes the imagination. A dazzling display of forms, the tower’s upward thrust is vigorously articulated against the sky. The multifaceted shaft is delicately topped by a pleated cap, itself crowned, incongruously but proudly, with a weather vane. The tower celebrates its release from the building with the celerity of its ascent /assent.” – Für das Wortspiel von ascent (Aufstieg) und assent (Zustimmung) gibt es im Deutschen kein Äquivalent. 5
Tuschezeichnung von St. Andrews in: Robert Ginsberg, „The Aestheticcs of Ruins“, Bucknell Review, Volume XVIII, Winter 1070, Number 3, pp. 95-96
Er schreibt: „Die Doppeltürme stehen am Ende der Ruine. Wir bereiten uns das Vergnügen, sie zu umrunden, um ihre Rückseite zu betrachten. Statt das Ende eines Gebäudes darzustellen, sind sie selbst ein Ende, insofern als sie frei in einem Gräberfeld stehen. Unsere Gestalten mischen sich mit den Grabsteinen, und wir teilen ihren Blick auf die Ruine. Die Türme sind wie vergrößerte Grabsteine.“
Robert Ginsberg sieht die Silhouette durch unterschiedliche geometrische Formen geprägt. Da ist zum einen ein Bogenfenster, das die Horizontale betont, zum andern die Diagonale eines Strebebogens. Beide Bewegungen sind zunächst Stütze, müssen dann aber dem Turm die vertikale Kraft überlassen. Wichtig wird die Kontur, das Zurücktreten des Details vor den großen Linien.
St. Andrews, Twin Towers
Foto: Robert Ginsburg
a.a.O. p.176
„We see the Twin Towers at the back of the ruin, but we take pleasure in going around and behind them. Instead of the end of the edifice, they are an end in themselves, free standing in a field of tombs. Our form mixes with theirs, and we share their view on the ruin. The towers are like enlarged tombstones.” 6
Es erscheint notwendig, sich in einer Ruine zu bewegen, Standpunkte zu wechseln, um sich auf die Details einlassen zu können. Eine Ruine gleicht somit einer Skulptur. Unten im Turm finden sich Stufen, die aber nirgends hinführen außer in die Luft, die hier dem Grau des Steins in hellerer Tönung folgt. Doch wird der Besucher wohl stets mit den beiden Zwillingstürmen konfrontiert, die am Ende eines weiten Raumes aufsteigen, mit einer Wand verbunden, die sich ihrerseits durch ein großes Fenster öffnet.
Für Robert Ginsberg macht eine gotische Ruine etwas Neues und Frisches erfahrbar, indem sie gerade nicht dem ursprünglichen Gebäude und den damit verbundenen Botschaften entspricht. Eine Ruine lässt die Vergangenheit hinter sich. Es geht Ginsberg nicht darum, in der Ruine die Vergangenheit zu rekonstruieren, sondern das Erlebnis Ruine als solches auf sich einwirken zu lassen, die Augenblicke von etwas Neuem, so nicht Dagewesenem zu erleben: „Etwas Neues zu erfahren ist gerade, was wir nicht erwarten.“ 7
Das kann nicht überall, nicht an jeder Stelle und nicht zu jedem Zeitpunkt gelingen. Es ist der kreative Moment, der sich für den Unvoreingenommenen ereignet. Dafür kann es kaum eine Vorbereitung geben.
“The ruin is a whole with holes“
„In der Ruine lässt sich Einheitlichkeit und Integrität erkennen im Gegensatz zu dem Zerbrochenen und Fragmentierten. Die Ruine wird zur Einheit. Sie kreiert ein Ganzes, aber nicht das ursprüngliche Ganze. Eine neue Einheit tritt zu Tage und die benötigt keinen Bezug zum Ursprünglichen. Die Integrität der Ruine erweitert sich auf neue Art, die ihre Umgebung und vielleicht auch deren Kultur aufnimmt.“ „Das vormalige Ganze wird zerlegt in eine Vielzahl von Einheiten und wird sich auf eine neue Art und Weise in die Umgebung einpassen. Die Ruine wird zum Teil eines Ganzen, ein Ganzes, das sich aus Löchern, aus Leerräumen, zusammensetzt. Und manchmal ist die Ruine als Ganzes eine neue Einheit.“
„In the ruin it is unity and integrity, in contrast to the broken and fragmented. The ruin unifies. It makes wholes. Not the original whole, but new unities appear, and these need have no reference to the original. The ruin reforms itself into a plurality of unities. […] The ruin’s integrity extends in new fashion to include its site and perhaps its culture.”
„We think the ruin tobe a part of a whole filled with holes, but the ruin is a whole filled with holes. Sometimes, the ruin as a whole has a new unity.”
Es geht Ginsberg darum zu zeigen, dass auf diese Weise etwas Neues entsteht, aber man muss es entdecken und erkunden. Es will gefunden werden. Für ihn bedeutet das eine Loslösung von der ursprünglichen Gestalt, ihrer Funktion und ihrem Zweck. Die Ruine erscheint in einem neuen Kontext und ist für ihn ein Lebensprozess („life process“, a „Being-in process“). Der ästhetische Genuss wird dadurch erhöht, dass die Ruine nicht vorgibt, ein Kunstwerk zu sein. 8 / 9
Eine Ruine ist in einer Entwicklung begriffen, es handelt sich um einen Vorgang in der Zeit, der einem Prozess unterworfen ist. Sie ist Wind und Wetter ausgesetzt. Sie gewährt einer Flora Heimatrecht. Zu manchen Jahreszeiten bringen Blüten Farbe. Büsche und Bäume lehnen sich an ihr Mauerwerk. Ihr Wurzelwerk wird die Ruine wiederum verändern.
Die Figur der Eva, ursprünglich als Türsturz der Kathedrale von Autun / Burgund, heute separat ausgestellt. Isoliert betrachtet, ohne den ursprünglichen Kontext, besticht sie allein durch ihre Schönheit.
Wasserspeier von Melrose Abbey, Figur außerhalb des ursprünglichen Bildprogramms der Abbey.
1 „Standing in the chill wind outdoors, we have been looking through the window to the outdoors. Inner and outer no longer matter. The window does not keep the wind out nor the warmth in. Nothing is in the window, save a luminous sky, stained with clouds. The window is no longer a window. R.Ginsberg a.a.O. p.17
2 Robert Ginsberg: The Aesthetics of Ruins (New York 2004), p.17/18
3 Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin (Frankfurt am Main 1955 /1984, S.13
4 R.M. Rilke, Auguste Rodin a.a.O. S.14
5 R. Ginsberg, The Aesthetic of Ruins NY 2004, a.a.O. p.177
6 R. Ginsberg, The Aesthetic of Ruins NY 2004, a.a.O. p.177
7 R. Ginsberg, The Aesthetic of Ruins NY 2004, a.a.O. p.155 „Newness is precisely what we do not expect to experience.“
8 R. Ginsberg, a.a.O. p.155f
9 „It is a work of life, Being-in-process.“ R. Ginsberg, a.a.O. p.157
Literatur:
Robert Ginsberg, The Aesthetics of Ruins
The Aesthetics of Ruins by Robert Ginsberg (New York 2004)
Robert Ginsberg, “The Aesthetics of Ruins”
Bucknell Review, Volume XVIII, Winter 1970, Number 3, pp.93-99.
Zu den Ruinen des Border country:
Ingeborg Bauer, Distel – dornige Schönheit – Auf Spurensuche in Schottland (Norderstedt 2015)
Der Torso als Skulptur
Venus, though disarmed,
disarms us still,
with undiminished charms,
as if unharmed. 10
Eine Begegnung mit antiken Figuren
Das vorangestellte Motto: ein Wortspiel von ‚disarm’: ohne Arme und entwaffnen, verbunden mit dem Reim, der ‚charms’ und ‚unharmed’ gegenüberstellt: Venus ohne Arme entwaffnet den Betrachter durch unverminderten Charme, als sei sie unverletzt. Damit nimmt Ginsberg das Ergebnis vorweg, statuiert er die These, dass es gerade das Unvollkommene eines Torsos sei, eines nicht mehr in seiner Gänze unverletzten Zustands, das seine Wirkung auf den Betrachter nicht verfehlt.
Die meisten antiken Statuen zeigen heute Verletzungen, Brüche der Glieder, Verletzungen des Kopfes, der Oberfläche. Erstaunlicherweise wirken gerade diese Torsi ausgesprochen lebendig. Sie wirken auf uns als vollkommene Kunstwerke. Es ist gar nicht notwendig, dass wir sie mit unserer Vorstellungskraft in ihren Urzustand zurückversetzen. Wir nehmen den zerklüfteten Halsansatz und die Bruchstelle der Arme wahr, die das Gewicht des Kopfes und die Bewegung des Armes andeuten. Die Statue ist lebendig, aber ihr Leben ist unabhängig von einer Perfektion des Ganzen. Der Torso ist eine Umformulierung und bietet sich als neue ästhetische Einheit an. Wir sehen ab von ihrem ursprünglichen Ort, betrachten sie außerhalb eines früheren Kontexts. Der Betrachter ist in der Regel näher an einem Torso, als es der antike Besucher etwa eines Tempels jemals war. Wir treten dem Kunstwerk auf Augenhöhe entgegen.
Im November 1999 hatte ich in Rom ein für mich äußerst eindrucksvolles Erlebnis. In einem ehemaligen Kraftwerk wurde nach dem Vorbild des Gare d’Orsay in Paris ein Museum eingerichtet. Es zeigte über 150 griechische und römische Statuen, die zur Sammlung der Kapitolinischen Museen gehörten und teilweise zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurden: „Scultura di Roma Antica alla Centrale Montemartini“. In einem Ambiente, das für die Technik des 20. Jahrhunderts eingerichtet und jetzt am Ende des Jahrhunderts durch eine neue Anlage ersetzt worden war, waren nun Skulpturen ausgestellt, die bis zu 2000 Jahre älter waren. Sie waren hier in eine völlig fremde Umgebung gestellt worden. Es handelte sich nicht um einen für sie gemachten Museumsraum. Vielmehr standen die Statuen in unmittelbarer Nachbarschaft von Rohren und Behältern aus einer anderen Welt. Das Eigenartige daran war aber, dass sie gerade durch diese ungewöhnliche Konfrontation an Lebendigkeit gewannen. Unter ihnen waren viele Torsi, fragmentarische Statuen, denen die Köpfe fehlten, so dass nur der Halsansatz mit einer Bruchstelle die Richtung der Kopfhaltung andeutete. Es fehlten ihnen Arme, und doch fühlte der Betrachter die darin verborgene Bewegung. Auch wenn es nur die Hände waren, die fehlten, störte das keinesfalls die Gestik der Figur. Dünne, durchscheinende Stoffe gaben mehr vom Körper preis als es ein nackter Körper hätte tun können. Die drapierten Körper der Frauen erinnerten an solche von Henry Moore, auch wenn seine Körper ausladend und schwer sind und eine Nähe zur Abstraktion zeigen. Erstaunlich war auch die Nähe der Statuen zum Besucher. Sie standen oft fast auf einer Ebene mit ihm, was eine Vertrautheit vermittelte, die beim distanzierten Blick etwa auf die Karyatiden der Akropolis in Athen nicht aufkommen kann, da sie so erhaben über dem Besucher stehen. Auch wirkt ein Torso bewegter, wenn der Betrachter unwillkürlich glaubt, einer lebendigen Gestalt gegenüber zu stehen. Die Vorstellungskraft wird belebt durch eine solche Darstellung in einem so unerwarteten Ambiente, das gerade durch diese Verfremdung eine neue Perspektive vermittelt. Soviel zu diesem Erlebnis.
In der Darstellung antiker Statuen, die nicht mehr die Perfektion zu der Zeit ihrer Entstehung aufweisen, werden Lücken erkennbar, Zwischenräume, die der Betrachter in seine Sicht einbeziehen muss. Lücken fordern ihn, lassen ihn nahe an den künstlerischen Schöpfungsprozess herankommen. Eine Kraft, die dem Körper entströmt, wird in der Darstellung antiker Statuen, die nicht mehr die Perfektion zu der Zeit ihrer Entstehung aufweisen, werden Lücken erkennbar, Zwischenräume, die der Betrachter in seine Sicht einbeziehen muss. Lücken fordern ihn, lassen ihn nahe an den künstlerischen Schöpfungsprozess herankommen. Eine Kraft, die dem Körper entströmt, wird verstärkt, verdichtet durch den Verlust von Extremitäten. Der ursprünglich glatte Marmor erscheint aufgeraut, durchlöchert. Spalten an den Kanten zeigen offen Brüche, wodurch Tiefe entsteht. Indem eine äußere Haut aufgebrochen ist, tritt Inneres an die Oberfläche. Der Torso stellt keine Imitation eines makellosen Körpers dar.
Für Robert Ginsberg gilt: „Die Dreidimensionalität der Statue wächst von etwas das Raum einnimmt zu einer Tiefe im Raum. Sie ist nicht mehr (nur) ein Äußeres.“ 11
In Rilkes Aufzeichnungen über Rodin stellt er bei der Beschreibung einer Figur fest, dass die Arme fehlen, dass Rodin sie offenbar nicht als notwendig empfunden habe. „Man steht vor diesen [armlosen] Stelen als vor etwas Ganzem, Vollendetem, das keine Ergänzung zulässt. Nicht aus dem einfachen Schauen kommt das Gefühl des Unfertigen, sondern aus der umständlichen Überlegung, aus der kleinlichen Pedanterie, welche sagt, dass zu einem Körper Arme gehören und dass ein Körper ohne Arme nicht ganz sein könne, auf keinen Fall.“ 12
Im Falle Rodins schafft der künstlerische Wille mit dem Torso ein Kunstwerk.