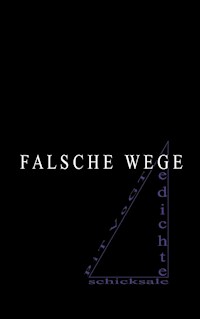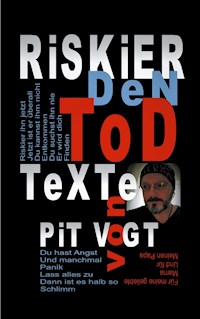Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Manchmal frage ich mich, ob das Wort nicht doch schon längst gestorben ist? Ist es tot? Ist es am Ende? Ist es abgewetzt, verbraucht vielleicht? Aus so vielen ganz wichtigen Leuten fällt so viel ganz wichtige Unwissenheit heraus! Ist dies das wahre Wort vielleicht, wirklich? Aber dann spüre ich, dass die Menschen um mich herum mehr zu sagen haben, als diejenigen, die immerzu von wichtigen Dingen sprechen, doch nur, um ihr Ansehen noch zu steigern. Das ehrliche Wort finde ich bei meinen Nachbarn, bei meinen Einkäufen und irgendwo da draußen in der Menge. Es ist eine Melodie, ein Sound, der niemals enden will. Es ist das Lied der Menschen, der ganz normalen Leute. Es ist die Melodie der Arbeit und des Schaffens. Es ist der Sound des Lebens. Und plötzlich weiß ich es, fühle es ganz genau, ganz tief in mir: Das Wort lebt! Es zieht durch alle Generationen und nährt sich an den Menschen, an den alltäglichen Dingen. Und das ist es, was mich stark sein lässt, auch, wenn ich mich manchmal schwach fühlen mag. Ich bin nicht allein, denn um mich herum sind die Menschen, der Sound der Gesellschaft und der Hoffnung, immer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Sein Traum
Intensivstation
Kneipenschluss
Diamant
Nachts am Fluss
Aufbruch
Am Morgen
Chronik
Du willst
Der Seemann
Zwei Monde
Glück
Dein Leben
Alpträume
Mauern
Ein Mann
Aufstehen!
Ohne Titel
Betrachtung
Der Traum
Da draußen
Heimwärts
Mir träumte
Hoffnung
Gib nicht auf!
Was ich bin
Die Muschel
Nachtflug
Wimpernschlag
Gezeiten
In der Nacht
Trauer
Am Ziel
Nebel
Liegnitz
Fort
Nebel
Angst
Flut
Fremd
Gebet für einen Freund
Roter Ball
Morgenluft
Bahnsteig 2
Orange Drive
Nach Hause
Teufelsort
Letzter Vers
Der Stieglitz
Fragen
Fjord
Alptraum
Kraniche
Schwarze Materie
Die Tänzerin
Nomade
Die Mörderin
Hollywood im Blut
Chancen
Am Berg
Träume
Spiegelbild
Der Dumme
An einen Soldaten
Glogaulied
Düsternis
Gewitter
Weg
Singen
Erinnerungen
Alb
Lied
Was
Sommer
Gedanke
Eines Tages
Danach
Spielplatz
Abgesang
Blizzard
Letzte Reise
Zeit der Störche
Nachtmahr
Drift
Watt
Was bleibt?
Fern
Ohne Titel
Manchmal
Endlich daheim
Heimkehr
Am Deich
In der Bucht
Weihnacht
Am Hafen
Der Elefant
Weihnachtsengel
Achttausender
Am See
Die Hafenbar
Der Dicke
Die Wahrsagerin
Am Straßenrand
Da fliegen sie nun hin
Gedanken
Die Herde
Für meine Mama
Sein Traum
Er hat geträumt vom Haus am Fluss
Von hohen Bäumen, ewig grün
Er tat, was er wohl tuen muss
Für diesen Traum, das Haus am Fluss
Er wollt die Mutter wiedersehn
Doch um ihn rum war´s laut und kalt
Im Häusermeer der großen Stadt
Im Sumpf der Straßen gab´s kein Wald
Hier wurde niemand reich und alt
Hier, wo man keinen Traum mehr hat
Da machte er sich auf und ging
Dorthin, wo Mamas Stimme rief
Als tief der gelbe Mond schon hing
Da machte er sich auf und ging
Nur raus, nur fort vom Großstadtmief
Durch viele Länder lief er so
Bis zu dem Wald, dem Haus am Fluss
Die Stille machte ihn dort froh
Und seine Mutter sowieso
Die gab ihm einen sanften Kuss
Er war am Ziel – ja, und er blieb
Mit Mutter dort am Fluss im Haus
Dort fand er endlich jenes Glück
Von dem er träumte, was ihn trieb
Hier sah die Welt so friedlich aus
Er träumte oft vom Haus am Fluss
Von seiner Mutter, die dort lebt´
Er tat, was man wohl tuen muss
Man fand ihn tot im Großstadtfluss
Und seine Spur ward schnell verweht
Intensivstation
Die Mutter liegt im Krankenhaus
Auf einer Intensivstation
Tief in mir drin sieht´s düster aus
Die Mutter liegt im Krankenhaus
Ich lieb sie sehr, ich bin ihr Sohn
Geh jeden Tag zu ihr dorthin
Dort scheint mir alles fremd, steril
Die Mama wollte nie dorthin
Und ich geh jeden Tag dorthin
Hoff auf ein Wunder, gar nicht viel
Die Apparate piepsen leis
Die Schläuche liegen überall
Der Kreislauf ist mal dünn, mal heiß
Ich weiß nicht mehr, was sonst ich weiß
Mein Leben ist in freiem Fall
Hab so viel Fragen in mir drin
Stell sie dem Arzt, der Schwester auch
Wie geht’s nur weiter, wo geht’s hin?
Tief hämmern Fragen in mir drin
In meinem Hirn zieht Angst und Rauch
So viel geht mir durch Mark und Sinn
Und durch mein Herz, das schmerzt so sehr
Geh jeden Tag zu ihr dorthin
Und weiß ansonsten nicht wohin
Ach, meine Seele wiegt so schwer
Manchmal spricht Mama leis ein Wort
Das ist so kostbar, wichtig, lieb
An diesem schwierig schweren Ort
Zählt jedes Streicheln, jedes Wort
Zählt mein Gebet, dass leise zieht
Die Schnabeltasse auf dem Tisch
Mit Wasser, Brei gefüllt nur halb
Ach Mama, warum trinkst du nicht
Ich halt die Tasse doch für dich
Kommst du nach Hause wieder – bald?
Die Mutter ist im Krankenhaus
Auf einer Intensivstation
Mit meiner Hoffnung halt ich´s aus
Bin jeden Tag im Krankenhaus
Ich lieb sie sehr
Ich bin ihr Sohn
Kneipenschluss
Ich stolpre mich durch nächtlich Straßen
Kein Mond, kein Himmel über mir
Nur eine Pfütz´ im Straßengraben
Feucht ist der Nebel, feucht mein Kragen
Noch immer dreht das letzte Bier
Mir ist so übel – ich muss kotzen!
An jener Wiese, die sonst schön
Starr krank ins Nichts, ich kann nicht protzen
Ich blinzle nur – ich kann nicht glotzen
Will lang noch nicht nach Hause gehn!
Mein Schrei gellt durch die düstern Gassen!
Die Angst kriecht scharf ins schlaffe Hirn
Ich lass mich falln, ins Gras, dem nassen
Zäh klebt die Zeit, ist nicht zu fassen
Die Düsternis will mich verwirrn
Mein Geld versoffen in der Kneipe
Wo stundenlang ich so gehofft
Im Spiel der Eitelkeit schnell pleite
Des Lebens allertrübste Seite
Manch Hoffnung längst von Frust verstopft
Ein Auto zischt an mir vorüber
Erkenn das rote Rücklicht kaum
Es gießt in Strömen in den Flieder
Durchnässt behänd mich immer wieder
Ich schieb mich heulend untern Baum
Ob sich das alles mal verändert?
Obs anders wird vielleicht, und wann?
Das halbe Leben so verschwendet!
Ich weiß nicht mehr, ob das mal endet!
Will heim, nur heim – ganz schnell – sodann!
So stolpre ich mich immer weiter
Kein Mond, kein Stern blitzt über mir
Vielleicht werd ich schon bald gescheiter?
Denn nachts ist´s dunkel, gar nicht heiter!
Im Spiegelbild von Schnaps und Bier
Diamant
Wie Diamant sind deine Augen
Verführen sinnlich, atemlos
Wie Diamant, wie süße Trauben
Die einem fast die Sinne rauben
Du Edelstein, Du meine Ros´
Wie Diamant sind deine Worte
Verführerisch und sanft und süß
Wie ein Brillant der besten Sorte
Bist du mein Diamant am Orte
Wo Glück in Edelsteinen spießt
Wie Diamant sind deine Küsse
Wie Diamant dein Mund, dein Stern
Ein Liebes-Diamant der Lüste
Dies Funkeln, ach, ich ahn und wüsste
Ob jener Diamant zu fern?
Nachts am Fluss
Nacht am wundersamen,
verträumt einsamen Fluss
Lieg ich auf dem Rücken und starre träumend
in den Nachthimmel
Ich seh´ die Arme - diffus leuchtend –
unserer Milchstraße
Sie greifen nach der ungeahnten Ferne
im unsichtbaren
Sein aller Dinge und aller noch so fern
wabernden Materie
Gleich einer singend,
vielleicht auch schreienden Melodie
Gehalten von einer Kraft
Einer dunklen Energie
Die ich nicht kenne
Die doch da ist und gottesgleich
Durch mich gleitet
Unmerklich fast – ja ja, genau
Das alles, was ich dort draußen sehe, hält
Zusammenhält und auseinanderreißt
Wie meine Gedanken, wie meine Träume auch
Sehnsucht keimt in meinem Herzen
Will ich dort hinaus?
Ist dieses Leben vielleicht doch mehr
als nur hier zu sein?
Ist es die umfassende Art, alles zu beherrschen?
Ist es das Entstehen und das Sterben im
zusammenhängenden
Gleichnis aller Zeit? Wildheit der Entstehung?
Vielleicht? Vielleicht auch nicht?
Ich verwandele mich in einen Strahl
voll heller Energie
Und gleite rasend schnell hinein in diese Fülle
Spüre, wie mein Denken sich verbindet
mit allem um mich herum
Sinke in die nicht mehr existente Materie,
die brodelnd in einem
Schillernden Ur-Ozean in sich versinkt und
aufwachend in einer
Neuen Art des Daseins schließlich verglimmt
Sterben, Tod oder doch eine Wiedergeburt?
Ich bin das Universum und bin doch nur
ein winziger Teil desselben
Jedoch weiß ich um mich und um das
Universum
Es lebt und es gedeiht wie auch mein Sinn
Der sich an ihm nähret
Welch Vielfalt sich da entbindet
Aus einem Uhrwerk aller Zeit und aller Zeiten
Kehre ich zurück, weil ich doch etwas
Unerklärliches in mir trag
Etwas, das nirgends in diesem undefinierbaren,
nicht definierbaren Sein
Zu finden war – und ist
Etwas, das mich zurückkehren lässt in meinen
eigenen Schoß
Dass sich entfalten kann und doch meine
Herkunft niemals verschleudert
Ich trage es in mir, welche Form die Materie,
die Antimaterie in diesem unendlichen All
Auch immer annehmen mag
Es ist so tief in mir, dass selbst die noch so
ausgefeilte Erdachtheit allen Seins
Es nicht zu entziffern vermag
Ich schließe meine Augen und tauche in mich ein
Ich höre diesen dahin plätschernden Fluss
Bin erleichtert, dass ich nicht fliehen muss
Ja, ich kann bleiben – hier auf der Erde
Weil ich weiß, dass es mich überallhin begleitet
Es ist immer da und lebt, so lang es mich gibt
Denn ich weiß es längst
und ich kenne es nur zu gut
Dieses, was da tief in mir ist
und nie mehr weichen kann
Ich lächele in mich hinein und weiß, dass ich das
weite Universum dazu gar nicht brauche
Bei aller Merkwürdigkeit der Materie und des
Universums
Bleibt doch eines stets tief in mir drin:
Die Sehnsucht, die Tränen, die Angst,
die Hoffnung und
Die Liebe
Aufbruch
Ich schau mich um
Bemerke irgendwie nur Proll und Angst
Worum du bangst
Mag Liebe sein und Freude
Doch bleibt nur Sehnsucht nach dem
Leben
Dummheit, nichts zu geben
Eine Sehnsucht nach dem Anderssein
Doch bleibt am Ende nur ein fader
Schein
Ich dreh mich um
Irgendwo liegt da wohl ein Mensch im Dreck
Ein Blitz, ein Schreck
Doch will ich ihn nicht sehen
Will wieder weg mich drehen
Doch bleibt mein Blick
Ein kleines Stück
Wie ein Magnet
Er geht nicht fort
Ich hab für ihn ein kleines Wort:
„Ach“
Ich wend mich ab
Von dieser Welt, die doch nur hasst!
Zu viel verpasst?
So gar nichts mehr gefunden?
Es bleibt die Hoffnung, unumwunden!
Die Hoffnung auf mich selbst
Doch lauf ich immer weg
Fort von all dem stinkend seichten Dreck
Ich find mich nirgends wieder
Blöd!
Ich mach mich auf – jetzt
In eine ungewisse Zukunft
Wie jeder hier – und da
Bin voller Tatendrang, noch immer
Nichts scheint mir schlimmer
Als ein allzu tristes Leben
Ich muss doch leben und bestehen
Schau schnell nach vorn
Ich tat´s ja immer
Und spür in meinem Herzen plötzlich
Mich!
Am Morgen
Ich schau müd in den Morgen
Was ist aus dem geworden?
Wo bin ich nachts gewesen?
Ich schlief wohl ein am Tresen
Fühl mich noch nicht geborgen
Ich seh die Leute rennen
Die wollen nichts verpennen
Voll „Alltag“ scheint ihr Morgen
Manch Wunsch schon lang gestorben?
Ob die noch träumen, brennen?
Ich werd den Tag beginnen
Ganz neue Pläne spinnen
Hinein ins Stadtgetöse!
Bin plötzlich nicht mehr böse
So werde ich gewinnen!
Chronik
Es zogen die Menschen
aus dem so fremden Lande
Hinaus in die Fremde,
zu dem sehr langen Strande
Sie wollten nur ganz einfach weit weg
von Zuhause
Sie gaben sich selbst, der Familie nie Pause
Und zogen und liefen flugs zum Weltenrande
Es waren so viele,
die nimmermehr blieben
Ach, so viele Seelen,
die himmelwärts schrien
Es waren Familien, die in Armut und Kriege
zu suchen begannen nach Glück, Geld und Liebe
Man hätte sie sonst wohl zu Tode getrieben
Ja, auch jenes Kind,
dieser schwarzhaarige Junge,
zog fort mit den Eltern,
mit pfeifender Lunge
Zum Strand aller Märchen,
zur Küste der Wunder
Zum riesigen Meer
mit manch Fisch und manch Flunder
Er schaute so lieb, hatte Augen, so runde
Man sagte, da hinter dem brausenden Wasser
verbirgt sich das Gute,
ward die Welt nie mehr blasser
Dort ist ewiger Reichtum, sind nett alle Leute
Dort gibt es kein Elend, keine hungrige Meute
Dort gibt’s keinen Krieg, keine ewigen Hasser
Der Sturm war so stark – am Meer, an der Küste
Fern lag ihre Heimat, diese schreckliche Wüste
Verträumt schaut´ der Junge hinaus in die Ferne
Es sah dort am Himmel all die funkelnden Sterne
Und er sah auch den Mond,
der gelächelt und grüßte
Und dann auf der schlingernden
Schlauchboot-Schaluppe,
da gab´s nichts zu essen,
nicht mal eine Suppe
Dreihundert gefangen im Seelenverkäufer
Gehofft und gebetet zu Gott und manch Täufer
Doch war da nicht einer, der klagte und murrte
Ganz plötzlich dort draußen im tosenden Meere,
da schlugen die Wogen mal hoch und mal quere
Das Boot sank so schnell in die dunkelsten Tiefen
Es war Mitternachte,
ach, wo alle schliefen
Darüber hin klatschte das Wasser mit Schwere
Von all diesen Menschen, dem Jungen,
dem kleinen,
blieb nichts als nur Tränen,
ich kann nur noch weinen
So viele geblieben im schäumenden Meere
Es schlugen nur hoch all die Wasser,
voll Schwere
Am Meeresgrund war´s reich
an Stille und Steinen
Gestorben die Hoffnung,
die Sehnsucht nach Frieden
Die Freiheit der Leute – im Sturm fortgetrieben
Dem Tod nicht entkommen,
Familien und Kinder
Warum so viel Kälte? Warum so viel Winter?
Die Menschlichkeit
längst auf der Strecke geblieben?
Es gehen die Stunden, es ziehen die Tage
Es fliehen die Menschen –
mir bleibt nur die Frage:
Was wird, wenn auch ich aus der Heimat
mal fliehe?
Wird dann jemand sein,
der mich aufnimmt mit Liebe?
Bleibt übrig nur Trauer, nur Tränen und Klage?
Doch sah jener Junge die funkelnden Sterne
Er flog hoch ins All,
bis hinauf in die Ferne
Ich hör ihn noch singen,
den schwarzhaarigen Jungen
Er hat von der Liebe im Traumland gesungen
Ich denk oft an ihn,
hab ihn wirklich sehr gerne
Du willst
Du willst doch leben irgendwie
Du willst doch tanzen, fragst nicht wie
Du willst auch schreien voller Hass
Willst dich befreien, sonst noch was
Du willst doch lieben manche Nacht
Du willst doch sein wo jeder lacht
Du willst doch auch zu Hause sein
Willst stark und echt sein, nicht nur Schein