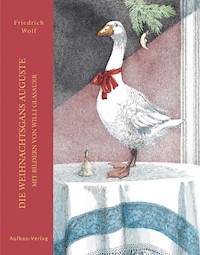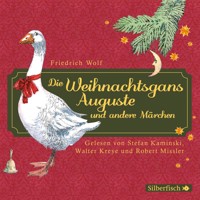7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung von 115 Gedichten bringt uns die poetische Seele eines Autors näher, der als Arzt, Dramatiker und Schriftsteller tief in die Konflikte seiner Zeit eintauchte. Ob Arbeiterkampf, Antifaschismus, Friedenskampf, Liebe oder Hoffnung – Friedrich Wolfs Verse sind durchdrungen von sozialem Engagement, menschlicher Wärme und kämpferischem Geist. Ein literarisches Zeugnis, das zwischen Melancholie, Pathos und Aufbruch oszilliert. Entdecken Sie die lyrische Welt eines Künstlers, der keine Angst hatte, für seine Ideale einzustehen und die Leser bis heute inspiriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Friedrich Wolf
Stimmen einer zerrissenen Zeit
Gedichte
ISBN 978-3-68912-399-4 (E–Book)
Die Gedichte sind in der Zeit von 1904 – 1953 entstanden.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2024 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
AUS DER SCHWEIZ
(1904)
Wie funkelt klar und helle
Des Sternenhimmels Pracht!
Wie flüstert hier die Welle
Des Sees zur Nacht …
Aus tiefem Dunkel dringet
Ein weiches Sehnsuchtslied.
Ein Fremder einer Fremden singet
Am See, im Ried.
ARDENNEN
(1909)
1
Mit dampfenden Flanken stehn die Berge da,
Rauch quillt aus ihren offnen Munden,
Um Felsenfirste streicht der Häher nach dem Horst.
Die Straße, die ich wandre, greift
Mit fahlen Nebelhänden nach mir aus,
Ein Baum reicht mich dem andern weiter.
In tausend gierigen Poren saugt die Erde
Des Himmels Atem zu sich nieder,
Der wirft ein golden Blatt im Taumel unter
meinen Fuß –
Um Felsenwände klagt des Hähers Ruf.
2
Schon rückt das Dunkel gegen mich heran
Und lauert mir an allen Pfaden auf,
Die Sträucher stehen, Mönche im Gebet erstarrt,
Gleich einem Riesen liegt das Land.
Und da
Das Flimmern eines Auges aus gesenkter Wimper
Bricht die Nebel.
Licht?
Nein, dieser Schatten ist ein Riesenhaupt …
Gelobt sei Jesus Christ –
Ein Haus!
In schweren Garben stürzt das Licht aus einer Lampe;
Und eine Frau, im goldnen Netz umsponnen, steht
Und schneidet Brot.
Rings die Familie, zinnerne Becher, ein kleiner Junge
Hält seine Hand auf zu der Mutter und dem Brot,
Nur eine Katze noch zum Knäul gerollt vor der beschlagnen Scheibe.
Da trägt mein Schritt mich aus dem Schattenriss der Frau.
In breiten Garben fällt das Licht jetzt auf die Straße –
Und wieder Nacht.
Ein letztes goldenes Korn nur
Rinnt in dem Spiegel der Gosse mir nach.
3
Bergheide und ich mitten darin. Ganz darin versunken in die krausen Schöpfe der Erika, und um mich nur das Schwarz-grün ihrer Haare. Die Sonne fällt durch die hellen Blüten wie ein Geschmeide. Sonst kaum welche Störung dieser schweigenden Andacht. Vielleicht das sterbende Braunrot der Heidelbeeren, das weiche Blond der Wiesenhalme, aber sonst auch nichts. Die Sonne steht auf Mittag. Eine wohltuende Schwermut liegt über dem Land. Als habe der Himmel seine Hand beruhigend auf die Berge gelegt.
Und doch greift mein Auge nach der Sonne und schließt sich.
„Immer noch Kind, das seine Hand streckt nach dem blinkenden Ball?“, lächelt meine Seele.
„Immer noch!“
Und ein Gewölbe mit tausend Wänden schallt die Antwort zurück: „Gibt es denn einen, der nicht –“
Wenn ich ihn wüsste, ich wollte mit ihm steigen auf diese Bergheide, ihm das Land rings zeigen, das in breiten Würfen gegossen liegt, wie von der Hand eines glücklichen Sämanns, das starke Land des „Hohen Venn“ bis zu den Ardennerbergen drüben im Belgierland.
Und die Sonne, die ihr Gold um jede Scholle legt.
NICHT BREMSEN!
(1909)
Weißt du noch, wie wir talab gefahren,
Den Wind und Schnee vom Saus in den Haaren,
Die Dauben sich an den Kurven bogen,
Die Flocken flogen,
Die Herzen flogen
Hoch – höher – über der Berge Joch,
Weißt du das noch?
„Nicht bremsen!“, das kam wie aus einem Munde,
Aus einem Herzens- und Wesensgrunde.
Jetzt da du andre Berge erstiegen,
Nicht zielwärts kriechen,
Nein zielwärts fliegen!
Wie damals nicht bremsen! Lasst los am Start,
Von mir ein Heil und volle Fahrt!
SCHERZO
Gleich einem bösen Witze hängt der Mond an der Kirchturmspitze, so kreidebleich und groß, und macht mir meine beiden jungen unerfahrenen Pappeln namenlos bang.
Der Strom drunter lang ist diesen schlechten Witz vom Mond schon gewohnt. Auch die grauen Silhouetten der steinalten Bergesketten rauchen nur amüsiert ihre Nebelpfeifen und beugen sich dem Land zum Schlaf.
In graziösem Lichtstreifen zeichnet sich die Brücke zum andern Hafenufer.
Fonografenwalzer, die Schnalzer und Rufer der Burschen zerbrechen von drüben die breite Nebelschicht.
Dann noch eines Ankers Fallen – und über allen Schatten wie ein ernstes sinnendes Angesicht der tiefblaue Sternhimmel.
ADVENT AM RHEIN
Wasser bleigrau und schwarz der Schiefer,
Weinlaub welkgrün am Felsensprung,
Und die Weihnacht rückt immer tiefer
In die sinkende Dämmerung.
Schiffe lassen die Ruder rasten,
Flaggen hängen müde am Knauf,
Hoch von allen Rahen und Masten
Leuchten Weihnachtskerzen auf.
NIEDERRHEIN
Das Land ein Federstrich
Und nur des Himmels Ragen,
Die Luft vom Wind gefegt
Und nur der Möwen Flügelschlagen.
Brause, Strom!
Seid ja des Meeres alle.
Spürt ihr den Meister
Im salzigen Sturmhauch nicht?
Sprühn seine Werbegeister
Nicht auch dir?
Ja – ja, ich komme, Meer!
Zerbrich die Küste,
Die mich noch hält!
Nur deine stärksten Wellen rüste mir,
Meer!
WINDSTÖßE
(1910)
Das Kupfer meiner Lampe flammt empor:
Petschaft und Feder, glanzmetallne Kanten,
Ein Glas-Kristall um dunkler Nelken Blut,
Windstoß!
Ein Falter lichtgetroffen fällt auf mein Papier,
Windstoß!
Da stürzt die Flamme jäh in ihren Kelch
Zurück in Nacht.
Und alle Dinge fallen von mir ab
Und legen sich in dunklen Mänteln nieder,
Der Regen trommelt auf den Fließen
Wie auf gedämpften Fell ein Totenlied,
Windstoß!
Was stöhnt ihr alten Bäume
Und lasst die Früchte durch die Äste brechen,
dass ich erschreckt zusammenfahre? Windstoß und
Totenstille …
Kein Hund heult mehr in dieser Nacht
Und keine Kette klirrt, warum?
Warum nur Regenfallen, Früchtefallen und Warten
Warten bis der Wind die Zweige knickt …
ALTE PAPPELALLEE AM RHEIN
(1911)
Hoch trage deinen Blick durch diese ragenden Kolonnen,
Du spürst den Wuchs im eigenen Genick,
Den Wuchs der steilen Pappeln,
Und die Sonnenfeuer
Durch Wolken lodern.
Und spürst den Takt aus dieser schlanken Zeile
Des Weges jach durch deine Glieder schlagen
Und greifst den Takt,
Nimmst Schritt, den Kopf ins Steile
Emporgeworfen …
Am hohen Himmel jagen noch
Die weißen Möwen.
GALOPP
(1911)
Schmeiß ein Wort über Bord, das
von jeher als Hort
Allem Jammergelappe gegolten! –
Was da schal und banal, heißet sentimental
Bei den Halben, die immer nur wollten!! -–
Glaube nicht, was man spricht, dass ein
schmelzend Gedicht
Deine Traute versetzt in den Himmel, –
– Ist sie's wert, nimm ein Schwert,
setz sie vorn auf dein Pferd,
Dann Galopp übers Tantengewimmel!
Lass sie schrein, – sie ist dein,
es ist alles nur Schein!
Drück dem Gaul den Sporn an die Rippe;
Ob sie grollt, ob sie schmollt, –
ach, wie bald wird sie hold
Und gefügig, die zornige Lippe!
Ob die Welt nicht umbellt, ob's den
Muckern gefällt
Oder nicht – reit fort zu den Sternen!
Nur den Blick nicht zurück, denn es
rollet das Glück
Immer vorwärts in fliehende Fernen! –
HEIMKEHR
(1912)
Rhein, Rhein! Das sind deine Wellen,
Das ist des Niederwalds Thron,
Und das sind deiner schnellen
Möwen Flüge schon,
Dies deine wallenden Nebel
Und auch das alte Signal,
Wenn die Anker knarren im Hebel
Und das Schiff abstößt zu Tal,
Und dies der Anschlag der Zungen
Und der feurigen Reden Lauf –
Rhein, Rhein nimm deinen Jungen
In Gnaden wieder auf!
NACHTS ALLEIN
(1912)
Wieder ein Tag vergangen,
Regen rinnt ihm nach,
Leute haben die Fenster verhangen,
Auch ich hab mein Dach.
Heimliche Nebel bleichen,
Nur drüben vom Zimmer zerbricht
Das Dunkel ein Feueranstreichen,
Auch ich hab mein Licht.
Zwei braune und noch zwei Arme,
Eine Diele, die selig knarrt,
Und die feuchte, regenwarme,
Einsame Nacht.
DER SCHWARZE RIESE MIT SEINEM ENGEL
(1912)
Dort hinter jenem Straßenrücken
Steigt ihr hinab in Schwarz und Blond gepaaret,
Das Lumpchen Huckepack auf deinem Rücken,
Und du, der schwarze Riese mit den Feuerblicken,
Der seinen blonden Engel wahret.
Die Straße tanzte unter deinen Schritten,
Wie Lumpchens Rosenarme deinen Schopf umwanden,
Und wie die stolzen Farren – aller Sitten
Vergessend – weich zu deinen Füßen glitten,
Bis eure Jauchzer in dem Wald verschwanden.
TROTZ
(1913)
Des ersten Denkers königliches „Nein!",
Das blitzend in die Nacht der Dogmen flammte,
Der erste Zorn, der aus der Wahrheit stammte
Und Leben heischte und nicht toten Stein,
Das erste Wort, im Beilglanz des Schafotts
Nicht widerrufen, das für Freiheit zeugte,
Der erste Geist, der sank und sich nicht beugte,
Das warst Du, erdentsprossener Kämpfer, Trotz!
Weit über Wüsten, über Gletscher gebt,
Wen Du beseelst im Wünschen und Entsagen,
Du kennst die Bitte nicht und laute Klagen;
Verlass mich nicht! Das nur ist mein Gebet!
Lehr hassen mich, was niedrig und infam,
Und wehre mir des Lebens Alltagsbangen,
Des Kleinmuts feige Blässe meinen Wangen,
Bewahr das Rot mir nur der Edelscham!
Leih mir der Tiefe Kraft, in Not zu schweigen,
Den Stolz vor heißer und vor kalter Höh,
Nicht Liebeshauch und seines Sturmes Bö
Lass diesen Nacken auf die Erde neigen!
Erhalt mich wahr! Die weiche Liebe schmiegt
So gern sich an in lieblichen Gestalten;
Heiß' mich die Treue auch der Gasse halten,
Dem Bruder, auch wenn er in Lumpen liegt!
Mich grüßt ein Aug, in dem die Liebe glänzt;
lass keinen schaun, wenn ich drum Schmerz erleide!
Halt aufrecht mich, wenn je die stille Weide
Ich pflanzen muss, wo man den Stein umkränzt!
Und geht mein Pflug einst nur durch Felsenerde,
Mir soll auch raues Brot willkommen sein!
Und fehlt auch dies, lass sterben mich allein!
Nur wahre mich, dass ich kein Bettler werde!
PURZELNDER KRONOS
(1913)
Zählt ihr die Zeit nach Tagen nur,
ich zähle sie nach Nächten,
In denen meiner Liebsten braune
Arme mich umflechten.
Da wird ein jedes Wort mir Sinn,
ein jeder Sinn lebendig,
Geheimstes wird Verkünderin
und Äußerstes inwendig.
Da wird, was mühsam sonst geleimt
die Herren Philosophen,
Von zweien allein zurechtgereimt
und in lebendigen Strophen,
In Strophen, die der Frühling spielt
auf zweien Menschenkindern
Mit eigener Hand; wer’s mitgefühlt,
den soll kein Herrgott hindern.
DÄMMERUNG
(1913)
Der Tag hat müde Augen,
Bald wird es dunkel sein,
Die hohen Dächer rauchen
Die Stadt zum Schlummer ein.
Und durch die leere Gasse
Streift nur der Abendwind,
Drüben badet die blasse
Junge Mutter ihr Kind.
Hat jedes seine Stätte
Und seinen Schoß zur Ruh,
Drinn’ es zur Nacht sich bette –
Wo bleibst du?
LOSUNG
(1913)
Soll der Liebe Flamme sprühn,
Muss der Leib verbrennen;
Soll das Erz zum Stahl zerglühn,
Flamme muss es trennen.
Flamme ist der Untergang
Alter Form in altem Leibe,
Flamme ist der Werdegang
Neuen Seins zu neuer Bleibe.
Dass die Losung sich erfüllet,
Zwischen Sterben und Gebären
Ganz umhüllet, Tod umspület,
Sollst du ernste Hoffnung nähren!
EIGEN
(1914)
– In meinem Traum bin ich noch reich
und rein! –
– Was seht ihr denn? – Die Fratze,
die Grimasse! –
Den falschen Gruß und meine Tracht der Gasse
In Red' und Art, im Denken, Tun und
Sein! –
Ich zieh brav an einem wackern Pfluge
Und sorge, dass die Furche möglichst grad
--- Und dass mein vorschriftsmäßiger Lebenspfad
Frei bleib' von offenkundigem Betruge.
Ich bin mit euch und gröl mit eurer Lust
Und wünsche jedem Biedermann das Beste;
Viel Wert leg ich darauf, mit weißer Weste
Vor euch zu stehn, auf stolz gewölbter Brust!
Ich tu wie ihr, dass ihr mich ja nicht tadelt!
Mein höchstes Ziel: dass ihr zufrieden seid
Mit meinem Leben, meinem Wort und Kleid!
Durch euer Lob gar fühl ich mich geadelt!
Und wenn ihr nickt und sagt: „So ist es recht!"
– Wie bin ich glücklich dann und
hochzufrieden! –
Wenn ich in nichts von euch mich unterschieden,
Nennt ihr mich treu und wahr, famos und echt;
– So soll es sein! – Wonach ich
sonst noch trachte,
Ist mein von je und soll's für immer sein. –
– In meinem Traum bin ich noch reich
und rein! –
– Was geht's euch an, wie tief ich
euch verachte?!
DIE GRAUSIG SCHÖNE GESCHICHTE VON DER PRINZESSIN MARGOT UND DER ENTDECKUNG DER HOMÖOPATHIE
Aufgefunden, aufgebessert und der Prinzess Margot untertänigst zugeeignet von Onkel Wolf aus Repelen
(1914)
In alten, alten Zeiten
Eine Prinzessin war,
In Glanz und Herrlichkeiten
Und goldig blondem Haar.
Die hatte viele Diener
Und Knechte mancherlei,
Sogar ein Mediziner
War damals schon dabei.
Die Knecht versahn das Leben
Der Herrin fein und zart,
Doch jener saß daneben
Nach Medizinerart.
Indessen eines Tages,
Da ist es wohl geschehn,
Ich weiß nicht, ob ich wag es
Der Nachwelt zu gestehn,
Es ist so schwer zu sagen
Und wider den Respekt,
Denn der Prinzessin Magen
War eines Tags – defekt.
Man rief zwar schnell den Doktor;
Der prüfte sehr gelahrt
Den Puls; doch plötzlich stockt’ er
Nach Medizinerart,
Und sprach das Wort, das freche,
Mit dreistem Mienenspiel:
Es sind wohl nicht die Köche,
Es war bloß was zu viel!
Die Höflinge erbleichten.
Doch die Prinzess Margot
Sprach nur: „Man schaff den seichten
Frechling auf das Schafott!“
Da warf der Schelm sich nieder
Wohl auf den Boden hart
Und tat gar fromm und bieder
Nach Medizinerart.
Und die Prinzessin milde,
Ließ sich erweichen schon
Von diesem Jammerbilde
Und sprach in gnädigem Ton:
„Mach mich bis zehen Uhren
Von diesem Übel heil
Mit einer deiner Kuren,
Sonst fällst du durch das Beil!“
Nun gab er sich ans Brauen,
Der ganz armsel’ge Wicht,
Und jene musst es kauen,
Doch helfen tat es nicht.
Da sprach die Prinzess dumpfe:
„Fort mit dem Medikus!
Trennt ihm das Haupt vom Rumpfe! –
Ich sterbe mit Genuss.
Man bringe mir sechs Törtchen,
Stell drei auf jede Seit:
Ihr Ladys und ihr Lördchen
Lebt wohl in Ewigkeit!“
Und als sie die sechs Törtchen
Genossen sonder Not,
Da sprach sie die sechs Wörtchen:
„Lebt wohl, jetzt kommt der Tod!“
Der Tod tät zögern indes
Mit seinem Sensenschwung,
Statt dessen kam der Prinzess
Plötzlich Erleichterung.
Da sprach die Prinzess plötzlich,
In ihrem Herzen gut:
„Der Tod ist doch entsetzlich,
Ich ahne, wie er tut.
Zur Richtstatt schnellstens eile
Ein Bote, eh’s zu spät,
Dass er nicht fern mehr weile
Von unsrer Majestät!“
Man bracht ihn augenblicklich,
Da es befohlen ward;
Er tat recht unerquicklich
Nach Medizinerart.
Doch die Prinzess sich wendet
Zu jenem Bösewicht:
„Beinah wär ich verendet,
Allein ich wollt es nicht.
Denn ob man wohl auch lachet,
– Man mache sich die Kur! –
Wen Kuchen krank gemachet,
Den heilet Kuchen nur!
Und zum Beweis, ihr Lördchen,
Stellt vor mich zweimal drei
Recht delikate Törtchen,
Auf dass es glaubhaft sei!“
Und es geschah wie oben.
Der Doktor war perplex,
Dann fing er an zu toben:
„Man bring mir gleichfalls sechs!“
Da war sie ganz versöhnet,
Die Prinzess fein und zart;
Der Speise jener frönet