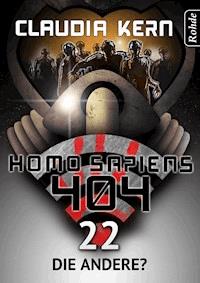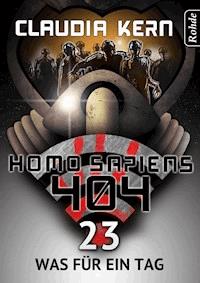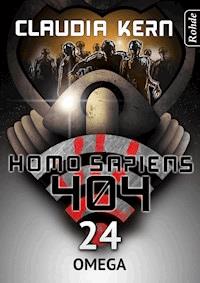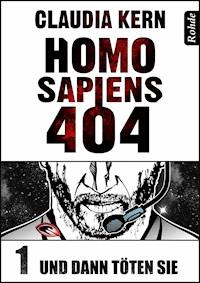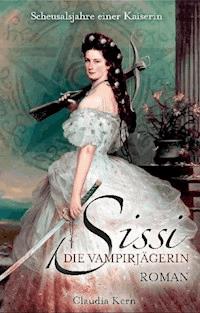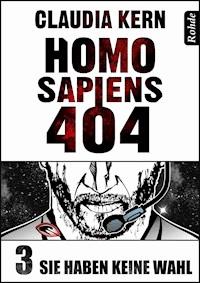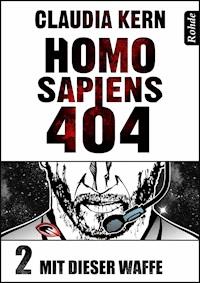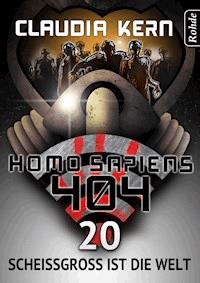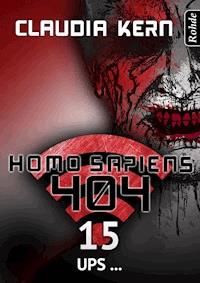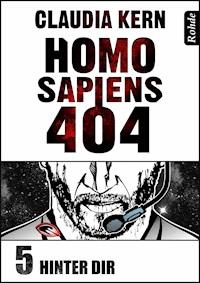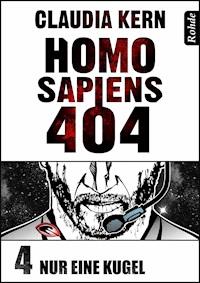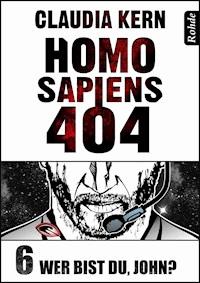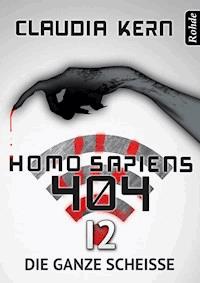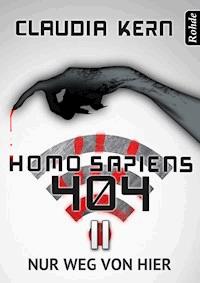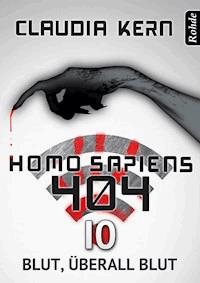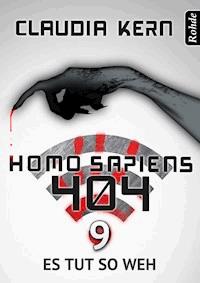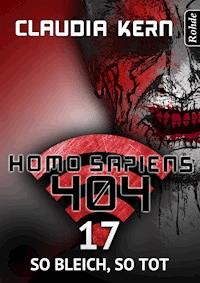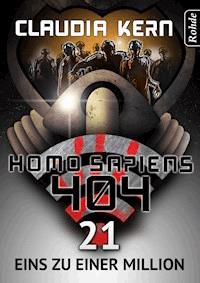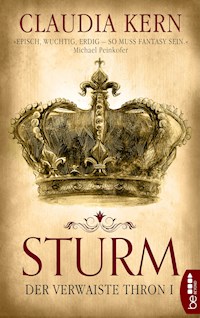
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der verwaiste Thron
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Ein fesselndes Debüt! Episch, wuchtig, erdig - so muss Fantasy sein." Michael Peinkofer
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Es ist ein großer Tag für Ana, die einzige Tochter des Fürsten von Somerstorm. Ihr siebzehnter Geburtstag beginnt mit den Darbietungen von Gauklern und Schaustellern - und endet in einem Massaker an ihrer Familie. Jetzt ist Ana auf der Flucht, nur begleitet von einem Leibwächter, den sie kaum kennt und dem sie noch weniger traut. Auf Burg Somerstorm, ihrer verlorenen Heimat, herrschen nun die schrecklichen Nachtschatten.
Was Ana nicht weiß: Auch ihr Bruder Gerit hat überlebt und hält sich auf Somerstorm versteckt. Bis ihn die Nachtschatten finden. Doch das Schicksal hält mehr für Gerit bereit, als in Sklaverei den Ungeheuern zu dienen, die seine Familie ermordet haben. Langsam, Schritt für Schritt, erlangt er ihr Vertrauen. Ob er sein Wissen jedoch für oder gegen die Angreifer einsetzt, ist ungewiss.
Der Auftakt zu Claudia Kerns farbenprächtiger Fantasy-Trilogie voller Abenteuer, Intrigen und geheimnisvoller Geschöpfe.
Sturm - Der verwaiste Thron I.
Verrat - Der verwaiste Thron II.
Rache - Der verwaiste Thron III.
Claudia Kern hat als Autorin historische, Fantasy- und Science-Fiction-Romane verfasst. Sie ist außerdem als Übersetzerin tätig, schreibt Film- und Serienkritiken, Stories und Dialoge für Computerspiele und eine regelmäßige Kolumne im Science-Fiction-Magazin "Geek!". Als Kind entdeckte sie dank "Herr der Ringe" ihre Liebe zur Fantasy, der sie bis heute treu geblieben ist. Claudia Kern lebt und arbeitet in Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungPrologErster TeilKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Zweiter TeilKapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28EpilogIm nächsten BandÜber dieses Buch
Wer Wind sät, wird Sturm ernten!
Es ist ein großer Tag für Ana, die einzige Tochter des Fürsten von Somerstorm. Ihr siebzehnter Geburtstag beginnt mit den Darbietungen von Gauklern und Schaustellern – und endet in einem Massaker an ihrer Familie. Jetzt ist Ana auf der Flucht, nur begleitet von einem Leibwächter, den sie kaum kennt und dem sie noch weniger traut. Auf Burg Somerstorm, ihrer verlorenen Heimat, herrschen nun die schrecklichen Nachtschatten.
Was Ana nicht weiß: Auch ihr Bruder Gerit hat überlebt und hält sich auf Somerstorm versteckt. Bis ihn die Nachtschatten finden. Doch das Schicksal hält mehr für Gerit bereit, als in Sklaverei den Ungeheuern zu dienen, die seine Familie ermordet haben. Langsam, Schritt für Schritt, erlangt er ihr Vertrauen. Ob er sein Wissen jedoch für oder gegen die Angreifer einsetzt, ist ungewiss.
Über die Autorin
Claudia Kern hat als Autorin historische, Fantasy- und Science-Fiction-Romane verfasst. Sie ist außerdem als Übersetzerin tätig, schreibt Film- und Serienkritiken, Stories und Dialoge für Computerspiele und eine regelmäßige Kolumne im Science-Fiction-Magazin »Geek!«. Als Kind entdeckte sie dank »Herr der Ringe« ihre Liebe zur Fantasy, der sie bis heute treu geblieben ist. Claudia Kern lebt und arbeitet in Berlin.
Claudia Kern
STURM
Der verwaiste Thron I
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt aufVermittlung der Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Originalausgabe STURM – DER VERWAISTE THRON erschien 2008 bei Blanvalet,einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Lektorat/Projektmanagement: Mirka Uhrmacher
Umschlaggestaltung: © Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deunter Verwendung von shutterstock: hayr pictures
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4367-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Stephan
Prolog
Ich hoffe, dass der Krieg noch ganz lange dauert«, sagte Craymorus. Der Waldboden raschelte und knackte unter seinen Sohlen. »Mindestens noch zwei Jahre, bis ich zwölf bin.«
»Und dann?«, fragte Purves. Er war ein großer Mann mit knochigen Händen und strähnigen, langen Haaren.
»Dann darf ich auch in den Krieg ziehen, so wie Jasse Drehmburgen. Er hat sogar ein Schwert.« Craymorus bückte sich und hob einen Ast auf. Halbherzig stocherte er damit in der Luft herum, aber der Ast war zu krumm, um wie ein richtiges Schwert auszusehen. Also ließ er ihn wieder fallen.
»Jasse will dem Roten König den Bauch aufschlitzen, hat er gesagt, so wie sein Vater immer die Schweine aufschlitzt.«
»Was hat denn Jasse gegen den Roten König?«
Das war eine seltsame Frage. Jeder, den Craymorus kannte, hasste den Roten König. Er war ein Räuber und Dieb, der seinen eigenen Vater vergiftet hatte, um auf den Thron zu gelangen. Die Wandermusikanten sangen in ihren Liedern davon.
»Jasse kann den Roten König nicht leiden, weil der seinen Vater umgebracht hat«, sagte er schließlich.
»Jasses Vater?«
Craymorus lachte. »Nein, den Vater des Königs, nicht Metzger Drehmburgen.«
»Und wieso kümmert es Jasse, was der König mit seinem Vater macht?«
»Weiß nicht. Weil es falsch ist?«
»Ist es das?«
Die Fragen waren Craymorus unangenehm. Er hob die Schultern und blickte an Purves vorbei in den Wald. So hoch im Norden gab es keine Laubbäume, so wie er sie aus seiner Heimat kannte, nur Fichten und Tannen, deren Nadeln den Boden bedeckten. Alles war vertrocknet. Die Luft roch sandig und scharf. Es war Craymorus nicht aufgefallen, dass sie den Weg verlassen hatten, doch als er jetzt danach suchte, konnte er ihn nirgends entdecken. Die Dunkelheit legte einen Schleier über den Wald.
»Wo sind wir?«, fragte er.
»Wo du sein wolltest.« Purves blieb stehen und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Die Nägel kratzten durch Craymorus’ Hemd hindurch über seine Haut. Er duckte sich und wich der Hand aus.
»Ich will hier nicht sein.«
Er meinte nicht nur den Wald mit seinen ausgeblichenen Farben, sondern auch das uralte Anwesen, auf dem sie seit einigen Wochen lebten, und den ganzen menschenleeren, trostlosen Norden. Sein Vater hatte gesagt, es sei wichtig, dass sie den Süden verließen, aber Craymorus verstand nicht, warum das so war. Es hatte wohl etwas mit dem Roten König und dem Krieg zu tun.
»Ich will nach Hause.« Seine Stimme klang weinerlich. Craymorus wischte sich mit dem Hemdsärmel über die Augen. Man zeigte keine Schwäche in Gegenwart anderer.
»Wolltest du nicht die Ungeheuer sehen?«
Er zog die Nase hoch. »Ja.«
Beinahe hätte er vergessen, dass sie deswegen aufgebrochen waren. Stunden waren seitdem vergangen. Der Tag war der Nacht gewichen.
»Sind sie hier?«, fragte er.
»Siehst du sie denn?«
Craymorus blinzelte Tränen aus seinen Augen und starrte in die Dämmerung. Der Wald war still. Die Vögel hatten längst aufgehört zu singen.
»Siehst du sie jetzt?«
Craymorus kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich mit aller Kraft, zwang sich dazu, die Ungeheuer zu entdecken. Er suchte sie in der Dunkelheit, wo die Nacht mit den Schatten verschmolz, und er suchte sie in der Luft, weil Jerzebal, seine Zofe, erzählte, die Ungeheuer kämen mit dem Wind über das Land.
Jerzebal nannte sie Nachtschatten. Craymorus’ Vater nannte sie Spinnerei.
»Sind sie wirklich hier?«, fragte Craymorus. »Mein Vater sagt, dass sie schon lange tot sind.«
»Dein Vater ist ein Narr.«
Unwillkürlich wich Craymorus vor dem Hass, der in den Worten lag, zurück.
»Ist er nicht«, war das Einzige, was er hervorbrachte, obwohl er so viel mehr hatte sagen wollen. »Wie …«
Er brach ab und drehte sich um. Der Wald umgab ihn wie ein undurchdringlicher schwarzer Wall. Ein Insekt summte neben seinem Kopf und verstummte.
Er war allein.
Ich hab doch nur einmal geblinzelt, dachte er. Die Angst ließ ihn frösteln. Wo ist er denn hin?
Irgendwo kicherte jemand. Es klang wie Purves’ Stimme, aber sie schien weiter von ihm entfernt zu sein, als möglich war.
»Wo bist du?«, rief er. Der Wald verschluckte seine Worte.
Vorsichtig tastete er sich an den Bäumen entlang. Die Dunkelheit pulsierte im Rhythmus seines Herzschlags. Schatten lösten sich aus der Nacht und umflossen ihn.
Etwas kitzelte sein Ohr. Augen, so kalt und hell wie Sterne, sahen ihn an.
»Lauf, kleiner Junge«, flüsterte Purves. »Lauf, so schnell du kannst.«
Seine Hände zitterten vor Angst, aber dennoch schlug er nach dem Schatten. Sein Schlag traf nur Luft. Er wurde vom eigenen Schwung nach vorne getragen und fiel auf die Knie. Seine Finger streiften Fell. Es roch nach Essig.
»Lauf!«, schrie Purves ihn an.
Craymorus sprang erschrocken auf.
Um ihn herum wurden aus Schatten Gestalten. Klauen streckten sich ihm entgegen, aufgerissene Mäuler schnappten nach seinen Beinen. Er sprang über sie hinweg, tauchte unter ihnen hindurch, stolperte über Wurzeln und prallte gegen Zweige. Dornen rissen sein Hemd auf, dann seine Haut, aber er lief weiter. Er war schnell und stark, das sagte jeder. Eines Tages würde er die Aufgaben seines Vaters erben und an den Tafeln der Könige sitzen. Das war seine Zukunft, nicht der Tod.
Er trat ins Leere. Einen winzigen Moment lang sah er den sternenklaren Himmel über sich wie die Augen von tausend höhnischen Ungeheuern, dann stürzte er dem Abgrund entgegen – lange, viel zu lange.
Als der Aufprall schließlich kam, glaubte Craymorus, sein Körper müsse zerspringen wie Glas. Zweimal überschlug er sich, dann blieb er zwischen den Felsen liegen.
Hinter ihm rutschten Dreck und Steine nach unten. Er schmeckte Blut, aber er spürte keine Schmerzen, nur eine dumpfe Enttäuschung, als habe ihn das Leben betrogen.
Craymorus wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis er den Schatten bemerkte, der die Sterne verdeckte.
»Kleiner Junge«, flüsterte Purves’ essigsaure Stimme. »Du wirst nie wieder vor irgendetwas davonlaufen. Dies ist mein Geschenk an dich.«
Craymorus schloss die Augen und erwartete den Tod.
Doch auch der Tod betrog ihn.
Erster Teil
Kapitel 1
Schroff und grau sind die Gesichter der Menschen von Somerstorm, so schroff und grau wie die Berge, die das Land von allen Seiten umschließen. Bei all meinen Erkundungen traf ich weder auf ein übellaunigeres Volk noch auf eine schlechtere Küche.
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Sie hatten ihre Farben auf dem Weg durch Somerstorm verloren, die Händler, Gaukler und Maler, die sich langsam den Weg zur Festung hinaufkämpften. Manche rissen an den Zügeln ihrer Ochsen, andere stemmten sich gegen Karren, deren Räder im Schlamm versunken waren. Die Farben ihrer Gewänder waren dem Schlamm gewichen, die bunten Fahnen, auf denen sie ihr Können anpriesen, hingen schlaff und nass herab. Der Nebel, der aus dem Tal aufstieg, zog Rot, Gelb, Grün aus ihren Stoffen und ließ nur Grau zurück.
Es war Frühling in Somerstorm.
»Komm vom Fenster weg, bevor die Götter dich sehen.«
Zrenje hatte das Zimmer betreten, ohne anzuklopfen, so wie es ihre Art war. Ana drehte sich nicht um zu ihr, sondern blickte weiter durch den schmalen Spalt nach draußen. Fast einen Meter dick waren die Steine, aus denen die Fürsten Somerstorms vor Jahrhunderten ihre Festung erbaut hatten. Die Spalte darin waren so schmal, dass ein erwachsener Mensch kaum den Kopf hindurchstecken konnte. Ana hatte einen Schemel unter das Fenster ihres Turmzimmers geschoben und stand jetzt auf Zehenspitzen darauf, die Ellenbogen auf den kalten Stein gestützt.
»Komm da weg. Fordere dein Schicksal nicht heraus. Nicht an diesem Tag.«
»Es ist mein Geburtstag, Zrenje, das ist doch nichts Schlimmes.« Ana sah ihre Zofe an. »In Westfall feiert man jedes Jahr Geburtstag.«
»Aber nicht hier.« Zrenje stemmte die Arme in die Hüften. Sie war eine kräftige Frau mit rauer Haut und heruntergezogenen Mundwinkeln. Ihre Haare waren grau. Sie trug sie zusammengesteckt unter einem Kopftuch. »Das weißt du doch.«
»Ja, ich weiß.«
Geburtstage waren Geheimnisse in Somerstorm. Während man in anderen Fürstentümern feierte, verkroch man sich hier an einem dunklen Ort und hoffte, dass die Götter nicht bemerkten, dass man dem Tod ein weiteres Jahr entgangen war. Ana lebte mit diesem Aberglauben seit ihrem vierten Lebensjahr, ihr jüngerer Bruder Gerit sein ganzes Leben lang.
Sie wandte sich von den Ochsenkarren ab und von den Flüchen, die der Wind nach oben trug. »Aber eure Götter sind nicht unsere Götter. Sie können von uns nicht die gleiche Ehrerbietung erwarten wie von ihrem eigenen Volk. Ich bin sicher, dass sie uns diesen einen Tag verzeihen werden.«
Das waren die gleichen Sätze, die ihr Vater, Fürst Lennard, sagte, wenn ihn ein Diener vor dem bevorstehenden Fest warnte, doch erst jetzt, wo Ana sie selbst aussprach, fiel ihr auf, wie leer und naiv sie klangen. Die Götter Somerstorms vergaben nicht.
Zrenje sah sie an. In ihrem Gesicht lag eine Mischung aus Besorgnis und Enttäuschung. Sie schien etwas sagen zu wollen, wandte sich dann jedoch wortlos ab und ging zu dem gewaltigen sechstürigen Kleiderschrank, der die gesamte linke Wand von Anas Zimmer einnahm. Ein Kleid hing außen an einer der Türen. Es war in dunkles Tuch eingehüllt. Ein Diener hatte es an diesem Morgen dort hingehängt.
»Das Glück bleibt Euch treu, Mefrouw«, hatte er gesagt. »Der Fürst befürchtete bereits, es würde nicht mehr rechtzeitig zur Feier eintreffen.«
Aber es war eingetroffen, so wie es der Händler aus Bochat versprochen hatte. Im Herbst hatte er die Festung besucht und Anas Maße genommen. Zwei Kleider sollte er anfertigen, eines für ihren Geburtstag, ein zweites für ihre Hochzeit. Er hatte sie nicht nach ihren Wünschen oder Vorlieben gefragt, sie nur gebeten, ihm eine Strähne ihres Haars zu überlassen. Von Anas Mutter hatte er erfahren, welches Wetter am Tag ihrer Geburt geherrscht hatte. Mehr, so hatte er erklärt, würden die Schneider nicht benötigen, um das passende Gewand für sie zu nähen. Seitdem hatte Ana gewusst, wohin der Händler seine Informationen bringen würde, denn eine solche Arroganz fand man den Erzählungen nach nur an einem einzigen Ort.
»Die Feier wird bald beginnen«, sagte Zrenje. »Ich nehme an, du willst das Kleid tragen, das dein Vater hat anfertigen lassen?«
Ihre Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass Ana sich ihrer Meinung nach besser in einen Jutesack gehüllt hätte.
»Natürlich.« Den ganzen Morgen hatte sie der Versuchung widerstanden, unter das Tuch zu blicken. Ein besonderer Augenblick hatte es werden sollen, und den sollte Zrenje nicht ruinieren.
»Wie du möchtest.« Die Zofe nahm das Kleid vom Bügel und legte es auf den Ankleidetisch neben dem Schrank. Das Tuch wurde von Metallklammern zusammengehalten. Zrenje begann sie mit ihren breiten Fingern aufzubiegen.
»Nein«, sagte Ana. »Lass mich das machen.«
Sie trat neben ihre Zofe und klappte die erste Metallklammer auf, dann die zweite und dritte. Das Tuch lag schwer und dunkel auf dem Kleid. Ana öffnete die beiden letzten Klammern, atmete tief durch und zog das Tuch auseinander.
Sie hörte, wie Zrenje neben ihr den Atem ausstieß. Schönheit war etwas, woran man in Somerstorm nicht gewöhnt war. Alles, was man hier herstellte, hatte einen Nutzen, einen klar umrissenen Zweck. Doch dieses Kleid, das vor ihnen auf dem Tisch lag, dieses Kleid, aus dem der Geruch nach warmen Sommerabenden emporstieg, weigerte sich, nützlich zu sein. Seine Linien waren schlicht und klar, der Stoff weiß und so weich, dass Anas Fingerspitzen davon abglitten. Keinem Windstoß würde es standhalten, keinem Ritt durch Matsch und Schnee. Stickereien betonten die Falten des Kleids und zogen sich wie ein sanft fließender Fluss vom Saum über den Kragen bis hin zu den Schultern. Es strahlte Weichheit, Sanftheit, Schönheit aus, das genaue Gegenteil von all dem, was Somerstorm ausmachte.
»Es ist wunderschön«, flüsterte Zrenje. Ihre Hände mit den längst verblassten Sklavenmalen schwebten über dem Kleid, wagten nicht, es zu berühren.
»Ja, das ist es«, sagte Ana. Vergeblich bemühte sie sich, die Enttäuschung aus ihrer Stimme herauszuhalten.
Zrenje verschränkte die Arme vor der Brust. »Was gefällt dir daran nicht?«
»Nichts. Es ist schön, wunderschön. Es…«
»Der Fürst hätte zehn gute Sklaven mit dem Gold kaufen können, das er dafür ausgegeben hat. Wenn mit dem Kleid etwas nicht stimmt, werde ich es ihm sagen.«
»Nein.« Ana schüttelte den Kopf, versuchte ihre Enttäuschung in Worte zu fassen.
»Es ist … Meine Mutter hat mir immer von den Meisterschneidereien von Braekor erzählt. Die Seide, die sie dort verwenden, stammt von Raupen, die ein Leben lang mit Honig gefüttert werden. Deshalb ist der Stoff feiner und weicher als jeder andere. Die besten Wahrsager der Königreiche arbeiten für die Schneider. Sie blicken in die Seele von all denen, die zu ihnen kommen. Das, was sie dort finden, arbeiten sie in die Gewänder ein, damit das Äußere das Innere widerspiegelt.«
Sie betrachtete das weiße, weiche Kleid. »Aber das hier bin nicht ich. Das ist gelogen.«
Zrenje betrachtete sie mit gerunzelter Stirn. »Was ist daran gelogen?«
»Es ist zu schön.« Ana wandte den Blick ab. »Ich bin nicht so schön.«
»Nicht so schön wie ein Kleid?« Die Zofe lachte. Es klang wie das Schnaufen eines Ochsen. »Da hast du natürlich Recht.«
»Was?«
Sie zeigte auf den makellosen Stoff. »Es hat keine Narbe am Schienbein, weil es nicht von einem Pferd getreten wurde, als es zehn Winter alt war. Deine Haut ist nicht so weich, weil du mit dunklem Roggenbrot, Möwenfleisch und Dornenbeeren großgezogen wurdest. Dein Haar ist kein goldener Fluss, sondern hat die Farbe von gefrorenem Sand. Du bist zu groß und zu dünn, trotzdem ist jeder Junge in der Festung, im Dorf und in den Minen verrückt nach dir. Und Rickard hat den weiten Weg von Westfall auf sich genommen, nur um dir sein Eheversprechen zu geben. Weißt du, warum?«
Weil ich eines Tages das reichste Fürstentum in allen Königreichen erben werde?, wollte Ana zurückgeben, aber Zrenje ließ sie nicht zu Wort kommen. »Weil du keine leere Hülle bist wie dieses Kleid. Ich kenne die Schneider von Braekor nicht, aber wenn sie behaupten, sie könnten die Seele eines Menschen in ein Stück Stoff bannen, egal, wie schön es ist, dann lügen sie. Das kann niemand. Nicht einmal die Götter, mögen sie die Ohren vor meinem Frevel verschließen. Du musst dich nicht mit einem Kleid messen. Es ist nichts ohne dich. Verstehst du das?«
Zrenje sprach stets mit großer Vehemenz, so als müsse sie einen Unschuldigen vor dem Henker retten. Ana hatte sich längst daran gewöhnt, trotzdem berührten die Worte etwas in ihr.
»Hilf mir beim Ankleiden«, entgegnete sie statt einer Antwort. Es war nicht statthaft, sich bei einer Sklavin für einen Rat zu bedanken.
»Jawohl, Mefrouw.«
Zrenje lächelte und begann Anas Samtwams aufzuknöpfen. Drei Schichten Kleidung legte Ana an jedem Frühlingsmorgen an, wollene Unterkleidung, einen langen Wollrock, Lederstiefel, ein Leinenhemd mit hohem Kragen, der den Hals vor Wind und Nässe schützte, und ein Samtwams, um die Wärme im Körper zu halten. Nach und nach legte sie die Schichten jetzt ab. Ana spürte die Wärme des Kaminfeuers auf ihrem Bauch und die Kälte der Steine in ihrem Rücken. Das Kleid glitt wie Wasser über ihre Haut. Es schmiegte sich an sie und wirkte so vertraut, als habe sie nie etwas anderes getragen. Sie wischte sich die Hände an ihrem Hemd ab und strich vorsichtig über die Seide.
So weich.
Zrenje legte ihre raue Hand auf Anas Arm. »Du musst mir etwas versprechen.«
»Keine Sorge, ich werde die Götter das Kleid nicht sehen lassen.«
In Somerstorm glaubte man, dass der Blick der Götter Steine nicht durchdringen konnte. Es war der Schutz, den der Fels denen gewährte, die in seiner Kargheit lebten.
»Ich trage es nur zum Fest heute Abend.«
Zrenje nickte. »Gut. Du weißt ja, wie sehr sie Schönheit verabscheuen. Ich habe es deinem Vater schon oft gesagt, und ich sage es dir auch noch mal. Diese Männer, die er holt, beschützen dich vor dem Bösen in der Welt, aber ich beschütze dich vor dem Bösen über der Welt. Das ist die Aufgabe einer Zofe, und solange du bei mir bist, werde ich sie erfüllen.«
Solange du bei mir bist … Das war eine Phrase, die Zrenje seit Anas Verlobung immer häufiger benutzte. Im Sommer schon würde sie nach Westfall gehen und die Kälte, die Kargheit und die zornigen Götter für immer hinter sich lassen. Ana sehnte den Tag herbei.
»Das weiß ich«, sagte sie. »Du bist…«
Sie unterbrach sich, als die Tür ihres Turmzimmers aufgerissen wurde und Gerit ins Innere stürmte.
»Weißt du schon, dass die Gaukler da sind?« Ihr Bruder klang atemlos, war wohl den ganzen Weg nach oben gerannt. »Mutter begrüßt sie gerade. Kommst du mit runter?«
»Ich weiß nicht. Führen sie denn irgendwas vor?«
Gerit hob die Schultern. Er war dünn und, obwohl er erst dreizehn Winter erlebt hatte, bereits genauso groß wie sie.
»Es sind doch Gaukler, oder?«, fragte er zurück. »Was sollen sie sonst machen?«
Ana dachte an die Wagen mit ihren verschlossenen, geheimnisvollen Kisten. Das Desinteresse, das sie bisher aufrecht gehalten hatte und mit dem sie Gerits Begeisterungsstürme meistens konterte, wich der Befürchtung, dass sie etwas Einzigartiges verpassen würde, wenn sie in ihrem Zimmer zurückblieb. Gerit würde wochenlang von dem schwärmen, was er dort unten gesehen hatte, von den Tieren, der Magie, der Musik.
»Ich bin gleich zurück.«
Mit zwei Schritten hatte sie die Tür erreicht. Gerit grinste und lief an den Wachen vorbei auf die Treppe zu. »Wer als Erster unten ist!«
»Dein Kleid!«, rief Zrenje hinter ihr her. Ana griff nach dem Umhang, der an einem Haken neben der Tür hing, und warf ihn sich im Lauf über.
»Ich bin gleich wieder da!«, rief sie zurück.
Zrenje antwortete etwas, was Ana nicht verstand. Vor ihr lief Gerit die ersten Stufen der Wendeltreppe nach unten. Hinter ihr klatschten die Stiefelsohlen der Wachen rhythmisch auf den Steinboden. Der Schatten ihres Leibwächters glitt über die Wände, lautlos und dunkel, so wie er.
Gerits Lachen hallte durch den Turm. »Du wirst verlieren!«
Seine Siegesgewissheit spornte Ana an. Zwei, drei der ausgetretenen Stufen nahm sie auf einmal. Das Licht der Kerzen tauchte die Treppe in ein diffuses gelbes Licht, in dem die Stufen kaum zu erkennen waren. Doch sie kannte den Weg so gut, dass sie nicht ein einziges Mal strauchelte.
Als das graue Rechteck des Tageslichts vor ihr sichtbar wurde, erkannte sie, dass sie das Rennen nicht mehr gewinnen konnte. Gerit nahm den letzten Absatz mit einem einzigen Sprung und lief durch die offene Tür hinaus in den Hof.
»Sieg!«, rief er, ohne sich umzudrehen.
Ana folgte ihm nach draußen. »Gar nicht wahr. Wir hätten gleichzeitig loslaufen müssen. Der Sieg zählt nicht.«
»Würde ich auch sagen, wenn ich so eine lahme Ente wäre.« Gerit wischte sich die Haare aus dem Gesicht. »Wo sind denn die Gaukler?«
Ana sah sich um. Der Turm lag auf der Westseite der Festung, direkt neben der Küche und dem Gesindehaus. Das schwere eiserne Nebentor, durch das die meisten Waren in die Festung gebracht wurden, stand offen. Wachen lehnten an der Mauer. Zwei von ihnen richteten sich auf, als sie Anas Blick bemerkten.
»Sind die Gaukler etwa durch das Haupttor gekommen?«, fragte Gerit. »Das sind doch keine Familien von hohem Blut.«
»Vater hat sie bestimmt durch das Haupttor eingelassen, um sie für die lange Reise, die sie auf sich genommen haben, zu ehren«, sagte Ana.
»Trotzdem ist es unangemessen.« Ihr Bruder schüttelte den Kopf. In seinen Studien befasste er sich gerade mit Höflichkeitsregeln und Traditionen, Dingen, die er wissen musste, wenn er später einmal die Festung leiten sollte. Er war der Zweitgeborene – der Viertgeborene, wenn man die Zwillinge mitzählte, die dem Blick der Götter nur wenige Stunden lang entgangen waren –, er hatte keine Wahl. Sein Leben war vorbestimmt.
So wie meines, dachte Ana, schob den Gedanken aber sofort zur Seite.
»Red mit Vater darüber«, sagte sie. »Er wird dir erklären, weshalb er so gehandelt hat.«
»Ja.« Gerit hörte ihr nicht mehr zu. Der Wind trug Ochsengeruch und Stimmen über den Hof. Die Gaukler waren da.
Ana bog um die Ecke, die zum Haupttor führte. Dieser Bereich der Festungsanlagen war normalerweise der Fürstenfamilie und ihren Gästen vorbehalten. Der Boden war gepflastert, Fahnen und Banner im Grau und Gold Somerstorms wehten auf den Mauerzinnen. Die Sklaven, die hier arbeiteten, trugen grau-goldene Uniformen, nicht die sackähnliche Kleidung aus schwerer Wolle und Ziegenfellen, die einem sonst rund um die Festung begegnete. Bereits vor einigen Tagen hatten sie innerhalb und außerhalb der Mauern Zelte aufgestellt, um dem Gefolge der eintreffenden Gäste eine Unterkunft zu bieten. Ein Teil des Hofes war mit Fellen überdacht worden, unter denen sich Feuerstellen und Bierfässer befanden. Jetzt eilten sie mit Tabletts voller Bierkrüge zwischen den Ochsenkarren und den neugierigen Zuschauern umher.
Die Gaukler drängten sich um die Feuerstellen. Einige saßen auf Strohballen, andere hatten sich Felle über die Schultern gelegt und wärmten ihre Hände an Krügen mit dampfendem Obstbier. Ihre Kleidung hing nass an ihren Körpern, und sie duckten sich jedes Mal, wenn eine Windböe durch den Unterstand fuhr. Nur wenige sprachen miteinander. Die meisten starrten vor sich hin.
»Die sehen aber nicht sehr lustig aus«, sagte Gerit. »Was sind denn das für Gaukler?«
Ana hob die Schultern und blickte zu ihren Eltern, die umringt von Wachen auf der Eingangstreppe standen. Zwei Gaukler, ein kahlköpfiger Zwerg mit krummen Beinen und ein junger, stark tätowierter Mann unterhielten sich mit ihnen. Ana hoffte, dass die beiden begriffen, welche Ehre der Fürst ihnen mit einer persönlichen Begrüßung gewährte.
»Komm, mal sehen, was sie sagen.« Ana bahnte sich einen Weg durch die Ochsenkarren, Gerit folgte ihr. Es hatte aufgehört zu regnen, aber das Kopfsteinpflaster glänzte noch nass. Ihre glatten Ledersohlen schlitterten darüber.
Ihre Mutter nickte Ana zu. Sie war eine selbstbewusste Frau, etwas größer als der Fürst, etwas schlanker als er und etwas strenger als er.
»Daneel und Grom, dies sind meine Kinder, Ana und Gerit.«
Die beiden Männer verneigten sich tief. »Ihr beschämt uns mit Eurer Großmut, Fürstin Marie«, sagte Daneel. Seine Aussprache war undeutlich. Ana bemerkte die eingefallenen Lippen und die hohlen Wangen unter den Tätowierungen. Daneel hatte keine oder nur noch sehr wenige Zähne. »Ihr gebt uns Bier und Brot und stellt uns Euren Kindern vor, als wären wir Euresgleichen«, fuhr er fort. »Unsere Gebete werden Euch stets einschließen, denn mehr haben wir nicht zu entgegnen.«
Die Fürstin neigte den Kopf. Sie schien antworten zu wollen, aber Gerit kam ihr zuvor.
»Warst du in der Ewigen Garde?« Die Frage schoss aus ihm heraus.
Daneel sah ihn an. »Das werde ich häufig gefragt, aus ersichtlichen Gründen. Aber die Antwort wird Euch leider enttäuschen. Ich hatte nie die Ehre, in der Ewigen Garde zu dienen. Ich war nur ein Matrose, den die Götter mit der fleckigen Krankheit gestraft haben, wofür, wissen nur sie selbst.«
»Ach so.« Ana sah die Enttäuschung auf Gerits Gesicht.
Daneel lächelte. »Vielleicht ist das aber auch eine Lüge. Vergesst nicht, wäre ich in der Ewigen Garde gewesen, so wäre ich jetzt ein Deserteur. Man nennt die Garde schließlich nicht die Ewige Garde, weil man kommen und gehen kann, wie man will. Aber warum, würdet Ihr Euch dann fragen, würde jemand die Garde verlassen wollen, wenn er doch alles getan hätte, um ein Teil von ihr zu werden? Darauf müsste ich antworten, dass es wahrscheinlich die Liebe zu einer Frau wäre, die einen aufrechten Offizier ins Unglück stürzen und ihn zwingen würde, sein Gesicht hinter Tätowierungen zu verbergen und sich zwischen Taugenichtsen und Halsabschneidern zu verstecken.«
Gerits Augen leuchteten. »Ist das wahr?«
»Ihr seid der Sohn des Fürsten. Es wäre unverschämt von mir, Euch zu diktieren, was Wahrheit und was Lüge ist. Darüber solltet Ihr selbst bestimmen.«
Gerit runzelte verwirrt die Stirn. Ana lachte. »Du bist sehr eloquent, Daneel. Ist dies das Talent, mit dem du uns heute Abend erfreuen wirst?«
»Nun…«
»Wenn es Euch beliebt«, unterbrach ihn der Zwerg. Seine Stimme klang merkwürdig gepresst.
»Ich glaube, es wird uns belieben.« Der Fürst nickte den Wachen zu zum Zeichen, dass die Audienz beendet war. »Ich habe die Dienerschaft angewiesen, euch mit allem zu versorgen, was ihr benötigt. Der Geburtstag meiner Tochter soll für alle ein Fest sein.«
»Es wird ein Fest werden, das niemand so schnell vergessen wird, mein Fürst.« Daneel lächelte erneut und zeigte nichts außer rosa Zahnfleisch. »Mit Eurer Erlaubnis werden wir uns jetzt um den Aufbau kümmern. Einige Vorführungen sind recht aufwendig.«
»Natürlich.« Der Fürst nickte.
Ana betrachtete die beiden Gaukler. Obwohl Daneel fast das gesamte Gespräch bestritten hatte, wurde sie den Eindruck nicht los, dass der Zwerg es eigentlich bestimmt hatte.
»Ana«, sagte Gerit, als seine Eltern sich abwandten, um ins Haus zurückzugehen, »glaubst du, dass Daneel wirklich bei der Ewigen Garde war?«
Ana wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Er wollte es glauben, und wenn sie ehrlich war, wollte sie es auch. Sie hätte lieber einen Offizier beherbergt, der sein Leben für die Liebe geopfert hatte, als einen Matrosen, dem die Zähne ausgefallen waren.
»Ja«, log sie, »ich glaube es.«
Gerit nickte. »Ich auch.«
Ein plötzlicher Windstoß riss den Himmel auf. Banner und Fahnen begannen zu knattern, die Gaukler rückten näher aneinander. Anas Umhang blähte sich auf und flatterte hinter ihr im Wind. Das Sonnenlicht ließ ihr Kleid glitzern und blendete sie.
»Was für ein wunderschönes Kleid«, sagte der Zwerg mit seiner seltsamen Stimme. »Ein Kleid gemacht für eine Göttin.«
»Sag das nicht.« Ana zog den Umhang hastig zusammen.
»Warum nicht? Warum sollte ich die Wahrheit verschweigen?« Der Zwerg stand vor ihr und starrte sie aus wässrigen blauen Augen an. Sie hatte nicht bemerkt, dass er ihr so nahe gekommen war.
»Komm, Gerit, wir gehen rein.« Sie zog ihren Bruder die Stufen hinauf. Der Zwerg schien ihr folgen zu wollen, aber der dunkle Schatten, der vor ihm auf den Boden fiel, hielt ihn so sicher zurück wie eine Kette.
»Glaubst du etwa an diesen abergläubischen Mist?« Gerit löste sich aus ihrem Griff und schüttelte den Kopf. »Vater sagt, das sei alles Unsinn.«
»Natürlich glaube ich nicht daran. Mir ist nur kalt, das ist alles.« Ihre Worte klangen so scharf, dass Gerit nicht weiter nachhakte.
»Schon gut«, sagte er.
Ana ignorierte ihn. Sorgfältig knotete sie den Gürtel des Umhangs zusammen. Er hat Recht, dachte sie, das ist nur Aberglaube. Die Götter werden mich nicht strafen. Wahrscheinlich haben sie gar nichts bemerkt. Es war doch nur ein paar Atemzüge lang zu sehen.
Sie blickte zurück zum Eingang. Der Zwerg stand in der Sonne, der dunkle Schatten des Leibwächters neben ihm.
Er lächelte.
Kapitel 2
Nur selten sieht man einen Altar am Wegesrand, und wenn man die Menschen Somerstorms nach ihren Göttern fragt, schütteln sie nur ablehnend den Kopf. Dies ist eine Geste, an die sich der Reisende gewöhnen sollte, denn er wird ihr auch bei vielen anderen Fragen begegnen.
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Es war heiß und stickig im Bankettsaal der Festung Somerstorm. Acht Kamine waren in die steinernen Wände des Saals eingelassen, in vieren davon brannte Feuer. Das Aroma des Süßholzes, das man eigens vom Großen Fluss hierhergebracht hatte, vermischte sich mit dem Geruch nach Schweiß und Ziegenfett.
Ana hatte die Gäste nicht gezählt, die an den hufeisenförmig aufgestellten Tischen saßen, aber sie schätzte, dass es über zweihundert waren. Fast alle, die ihr Vater eingeladen hatte, waren gekommen. Ana sah Karral, den Fürsten von Braekor, der mit zwei seiner Frauen und elf seiner Kinder einen ganzen Tisch für sich allein beanspruchte. Er saß am oberen linken Ende des Hufeisens zum Zeichen für die guten Beziehungen, die Somerstorm und Braekor pflegten. Einen Tisch weiter entfernt saßen die Zwillingsbrüder Huko und Ramon, die gemeinsam über einige kleine Inseln regierten. Im Krieg waren sie neutral geblieben, deshalb wurden sie von den meisten Herrscherhäusern geächtet. Einem dieser Herrscherhäuser stand Fürst Marg vor. Sein hageres, finsteres Gesicht verriet die Schmach, die er empfand, weil man ihn neben die Brüder und weit entfernt von den Gastgebern platziert hatte. Weiter entfernt saßen nur noch die Häuptlinge der drei großen Somer-Stämme und einige Händler, mit denen Anas Vater seit Jahren Geschäfte machte. Die Botschaft, die dahintersteckte, war für jeden im Saal deutlich lesbar. Man hinterging Somerstorm nicht, ohne den Preis dafür zu zahlen.
»Das ist ein Witz.«
Fürst Otar sprach so laut, dass Ana zusammenzuckte. Er saß auf einem der Ehrenplätze an ihrer rechten Seite. In einer Hand hielt er eine Bergziegenkeule. Fett lief über sein Handgelenk in den Ärmel seines Hemds und sammelte sich als dunkler Fleck am Ellenbogen. »Dieses ganze Fürstentum ist ein Witz.«
Aus den Augenwinkeln sah Ana zu ihm hinüber. Otar war ein großer, fleischiger Mann. Sein Kopf war kahl, sein Gesicht voller roter Flecken und aufgeplatzter Adern. Früher hatte er als stärkster Kämpfer der Königreiche gegolten, doch aus seinen Muskeln war längst Fett geworden, das ihn nach unten zu ziehen schien und seinen Rücken krümmte.
Otar bemerkte Anas Aufmerksamkeit. Er drehte den Kopf und sah sie aus blutunterlaufenen Augen an. »Ein Witz, verstehst du das?«, sagte er leiser.
Sie wich seinem Blick aus. »Ihr seid betrunken, Fürst Otar. Vielleicht solltet Ihr Euch aus…«
Er unterbrach sie. Sein saurer Weinatem strich über ihr Gesicht. »Ich lasse mir von dir nichts befehlen. Du und deine Familie, ihr seid niemand. Euer Gold gibt euch die Macht, einen guten Mann wie Marg zwischen Verräter und Bauern zu setzen, dabei solltet ihr vor ihm niederknien.«
»Die Fürsten von Somerstorm knien vor niemandem.« Ana versuchte Entschlossenheit in ihre Worte zu legen, doch ihre Stimme zitterte.
Otar lachte. Die Ziegenkeule in seiner Hand fiel auf den Teller zurück. Das Messer, das darauf lag, schepperte.
»Fürsten von Somerstorm? Kleines Mädchen, ich sehe keine Fürsten von Somerstorm, nur einen Sklavenhändler und seine Brut.«
Seine Stimme war wieder lauter geworden. Gesichter wandten sich ihm zu und dann rasch wieder ab. Niemand wollte in diesen Streit hineingezogen werden. Auf der anderen Seite des Hufeisens gingen die Unterhaltungen ungestört weiter. Ana blickte zu ihren Eltern und ihrem Bruder hinüber, hoffte, dass sie die Situation erkannten, in der sie gefangen war. Aber sie waren in ihre eigenen Gespräche vertieft. Von ihnen war keine Hilfe zu erwarten.
»Mein Vater«, sagte Ana, als sie sich Otar wieder zuwandte, »hat das Fürstentum für seine Kriegsdienste erhalten. Es steht ihm zu.«
»Ein Stück Felsen stand ihm zu, das niemand haben wollte, so war es gedacht. Ohne das verdammte Gold würden ihn heute alle noch den Sklavengeneral nennen, nicht Fürst von Somerstorm.« Otar schnaubte. »Fürst – als flösse auch nur ein Tropfen altes Blut durch seine Adern.«
Er griff nach dem Messer und begann wütend, das Fleisch vom Knochen der Keule zu trennen. Ana spürte, wie ihr Herz hämmerte. Eine unsichtbare Grenze schien um sie und Otar entstanden zu sein, die niemand zu übertreten wagte. Selbst die Diener machten einen Bogen um sie.
»Keiner sagt euch ins Gesicht, wie sehr wir euch verachten.« Otar richtete den Blick starr auf die Ziegenkeule. Knochen knirschten und Sehnen zerrissen unter der Messerklinge. »Wir sitzen an seinem Tisch, trinken seinen Wein, essen sein Fleisch, aber am liebsten würden wir ihm ins Gesicht spucken, diesem Sklavenhändler mit seiner Sklavenbraut und seinen Bastarden.«
Er schien vergessen zu haben, dass Ana neben ihm saß. Sie wagte es kaum, sich zu bewegen, bemerkte mit Erleichterung die Gaukler, die am offenen Ende des Hufeisens hektisch begonnen hatten, ihre Instrumente und Requisiten aufzubauen. Eigentlich hätte die Vorstellung erst nach dem Essen anfangen sollen. Jemand hatte wohl erkannt, dass es Zeit war, die Aufmerksamkeit einiger Gäste voneinander abzulenken.
»Und noch was.« Otar zog das Messer aus dem Fleisch und zeigte damit auf Ana. Sie wich zurück, doch im gleichen Moment fiel ein Schatten über den Fürsten und die fetttriefende Klinge in seiner Hand.
Otar sah kurz auf, dann legte er das Messer zur Seite. Der Schatten verschwand. »Ich habe deinem Vater die Ehre erwiesen, ihm eine Verbindung mit dem ältesten Blut der vier Reiche anzubieten.« Seine Stimme zitterte vor Wut. »Er hat abgelehnt. Mein Sohn war wohl nicht gut genug für dich.«
»Es waren bereits andere Arrangements getroffen worden. Euer großzügiges Angebot erreichte uns leider zu spät.« Das war die offizielle Begründung, die Anas Familie stets angab, wenn sie auf das Heiratsangebot von Fürst Otar angesprochen wurde. Die Briefe mussten sich überschnitten haben, Fürst Balderick von Westfall hatte nur wenige Tage zuvor im Namen seines Sohnes vorgesprochen, man war untröstlich über die voreilige Entscheidung, aber sicherlich würde Fürst Otar verstehen, dass man sie nicht mehr rückgängig machen konnte. Ana hatte die Geschichte oft erzählt. Die Wiederholung der Floskeln gab ihr Sicherheit, so als würde sie ein sorgfältig gelerntes Gedicht aufsagen.
»Euer Sohn ist ein guter und anständiger Mann«, sagte sie und brachte sogar den Mut auf, dem Fürsten in die Augen zu sehen. »Die Fürstentochter, die sein Herz für sich gewinnt, kann sich glücklich schätzen. Ich bedaure, dass ich es nicht sein werde.«
In Wirklichkeit war Uz, Otars Sohn, ein berüchtigter Trinker, der schon mit seinen knapp neunzehn Jahren die Körpermaße seines Vaters angenommen hatte und zu jähzornigen Ausbrüchen neigte. Ana war froh, dass er weit weg am Tisch der jungen, unverheirateten Krieger saß.
Otar schüttelte den Kopf. »Du verlogene kleine Schlampe.« Er sprach so leise, dass Ana im ersten Moment glaubte, ihn missverstanden zu haben. Doch dann wiederholte er den Satz noch einmal lauter, als begänne er Gefallen daran zu finden. »Verlogene kleine Schlampe. Du würdest den Kadaver eines Ebers ehelichen, wenn dich das nach Westfall brächte!«
Seine Worte hallten durch den Saal. Blicke richteten sich auf den Fürsten, Münder schlossen sich.
Otar stand auf. Er schwankte und musste sich mit einer Hand an der Tischkante abstützen, während er mit der anderen seinen Weinkelch hob.
»Einen Trinkspruch!«, brüllte er durch den Saal. Auch die letzten Unterhaltungen verstummten. Diener und Musikanten blieben stehen. Das Klappern von Geschirr erstarb.
Otar ließ seinen Blick über die Gesichter der Gäste gleiten. »Lasst uns trinken auf das Ende der Heuschrecken, die über das Land herfallen.« Er sah Ana an. »Und auf das Ende ihrer Brut.«
Gerit sprang mit einem wütenden Schrei auf. Sein Leibwächter legte ihm die Hände auf die Schultern und drückte ihn zurück auf seinen Stuhl.
»Noch sind sie hier«, sagte Otar, »aber der nächste Sturm wird sie davonwehen. Trinken wir auf diesen Sturm!«
Er hob den Kelch hoch. Rotwein schwappte über den Rand und tropfte auf seinen Kopf. In langen roten Bahnen lief er über sein Gesicht.
»Trinken wir auf den Sturm!«, brüllte Otar.
»Ja.« Eine Stimme, die fast wie seine eigene klang, antwortete ihm. Uz erhob sich schwerfällig und schwankend. Der Kelch in seiner Hand zitterte. »Auf den Sturm!«
Die anderen Krieger rückten von ihm ab, als fürchteten sie, ihre Nähe allein gäbe ihm Unterstützung. Die Blicke aller im Saal richteten sich auf Fürst Lennard. Otar und Uz hatten ihn in seinem eigenen Haus beleidigt. Das Gesetz gab ihm das Recht, sie zum Duell zu fordern oder ihnen den Krieg zu erklären. Ana hoffte, er würde beides tun.
Der Fürst von Somerstorm erhob sich. Er war kein großer Mann und wirkte in den schweren goldbestickten Roben, die er trug, beinahe verloren, als sträube sich sein Körper gegen das Amt, das der Geist ihm aufgezwungen hatte.
Er sah weder Otar noch Uz an, die immer noch mit erhobenen Kelchen an ihren Plätzen standen. Stattdessen wandte er sich den Künstlern am anderen Ende des Saals zu und klatschte einmal kurz in die Hände.
»Musik«, sagte er und setzte sich.
Grom, der Zwerg, nickte. Die Trommler, die hinter ihren großen Beckentrommeln standen, begannen sofort einen Rhythmus vorzugeben. Die Flötenspieler verneigten sich, dann setzten sie ihre Instrumente an die Lippen. Sie waren so nervös, dass sie zwei verschiedene Melodien spielten, ohne es zu bemerken.
Otar und Uz standen noch einen Moment reglos da, dann schleuderte der Fürst seinen Kelch zu Boden. Es schepperte laut. Rotwein spritzte. Dann drehten sich beide Männer um und gingen zu den großen, offen stehenden Türen. Auf seinem Weg dorthin riss Uz zwei Stühle und einen Diener um.
Ana hielt den Kopf gesenkt. Niemand sollte die Schamesröte sehen, die ihr ins Gesicht gestiegen war.
Die schrägen Melodien der Musikanten hallten durch den Saal, täuschten über die Stille der Gäste hinweg. Ana konnte sich das geheuchelte Mitgefühl auf ihren Gesichtern vorstellen und die Gier, mit der sie insgeheim darauf brannten, untereinander über die Schmach herzuziehen, die Anas Vater seiner Familie zugemutet hatte. Sie konnte es sich vorstellen, weil sie an ihrer Stelle genau das Gleiche getan hätte.
Das Lied der Musikanten endete mit einem letzten ersterbenden Flötenton. Die fünf Männer verneigten sich und sahen einander an. Keiner von ihnen wagte es, den Blick auf das schweigende Publikum zu richten.
Ein Stuhl wurde zurückgeschoben. Ana hob den Kopf, bis sie sehen konnte, dass Norhan, der alte General ihres Vaters, aufgestanden war. Seine Paradeuniform war ebenso grau wie sein Haar.
»Steht ein Sarg in diesem Saal?«, fragte er. »Liegt hier ein Toter, der an eurer Fröhlichkeit Anstoß nehmen könnte?« Er lächelte, als einige der Gäste den Kopf schüttelten. »Worauf wartet ihr dann noch? Esst, trinkt und tanzt, um der Fürstentochter von Somerstorm zu zeigen, dass ihr euch mit ihr über ihren Festtag freut.« Er nickte den Dienern zu. »Bringt mehr Fleisch und geizt nicht mit dem Wein. Für jeden leeren Kelch, den ich an diesem Abend sehe, gibt es zehn Stockschläge.«
»Es wird keine Klagen geben, Herr«, sagte Peck, der Hauptdiener, rasch.
»Davon bin ich überzeugt. Musikanten, spielt ›Das Frühlingslied des Hirten‹, wenn es euch vertraut ist.«
»Das ist es, Herr.« Die Erleichterung im Gesicht des Trommlers war nicht zu übersehen. Er flüsterte den Flötenspielern etwas zu und begann in schnellem Rhythmus zu trommeln. Er hatte kräftige, stark behaarte Arme und ein vernarbtes Gesicht.
Norhan klatschte übertrieben fröhlich in die Hände und stimmte die Melodie an, noch bevor die Flötenspieler eingesetzt hatten. Seine Offiziere schlossen sich ihm auf einen Blick an, nach und nach folgten die anderen Gäste. Einige junge Krieger standen von ihren Plätzen auf und gingen auf die Mädchen zu, um sie zum Tanz aufzufordern. Keiner von ihnen blickte in Anas Richtung.
Ein Schatten fiel über sie. Im ersten Moment dachte sie, es sei ihr Leibwächter, der den ganzen Abend noch kein Wort gesprochen hatte, doch als sie aufsah, blickte sie in das Gesicht ihres Vaters.
Er lächelte. »Morgen werden sie es alle bereits vergessen haben«, sagte er so leise, dass sie ihn gerade noch im Lärm der Musik verstehen konnte. »Glaub mir.«
Mühsam hielt sie ihre Tränen zurück. Er schien nicht zu begreifen, wie tief die Beleidigungen saßen, die Otar ausgesprochen hatte, und wie hämisch seine Gäste darauf reagiert hatten. Auch jetzt beobachteten sie den Fürsten und seine Tochter, versuchten wohl in ihren Gesichtern zu lesen.
Ana erwiderte das Lächeln ihres Vaters. »Sie werden es nie vergessen«, sagte sie leise. »Ihr habt zugelassen, dass dieser schreckliche alte Mann Eure Tochter eine Schlampe nennt. Wie konntet Ihr das erlauben?«
Sein Lächeln war so falsch wie das ihre. »Du wirkst müde«, sagte er nach einem Moment. »Du hast meine Erlaubnis, dich zurückzuziehen.«
»Wie Ihr wünscht.«
Sie spürte die Blicke der anderen, als sie sich erhob und den Saal verließ. Hinter ihr schlossen Diener, deren Gesichter ihr fremd waren, die Türen. Tränen der Scham und der Wut brannten in ihren Augen. Ihr Vater schickte sie zu Bett wie ein nörgelndes Kind, dabei hatte er diese Situation verschuldet. Wenn nur Rickard hier gewesen wäre. Er hätte niemals zugelassen, dass seine Verlobte und ihre Familie beleidigt wurden. Rickard war auf den Schlachtfeldern des Krieges aufgewachsen. Er wusste, was Ehre bedeutete.
Die Musik wurde leiser, Anas Schritte schneller. Sie hallten durch die dunklen Steingänge, dicht gefolgt von denen ihres Leibwächters. Es war kein Diener zu sehen. Wer nicht im Bankettsaal eingesetzt wurde, arbeitete in der Küche. Der Rest der Burg war verlassen.
Als Ana sicher war, dass niemand in ihrer Nähe war, fuhr sie herum. Ihr Leibwächter prallte beinahe gegen sie. Mit einer gemurmelten Entschuldigung trat er einen Schritt zurück.
»Warum hast du nichts unternommen?«, fuhr sie ihn an.
Er blinzelte. »Mefrouw?«
Er nannte sie bei ihrem Somerstorm-Titel, aber seine Größe verriet, dass er nicht aus dieser Gegend stammte. Die Menschen von Somerstorm waren klein und gedrungen, er hingegen groß und hager.
»Du bist mein Leibwächter, wieso hast du nichts gegen Fürst Otar und seine Beleidigungen unternommen?«
»Es ging nicht um Euer Leben.«
»Aber um meine Ehre.«
»Eure Ehre ist nicht meine Sorge.«
Seine Unverschämtheit raubte Ana fast den Atem. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Sie sollte aber deine Sorge sein«, sagte sie, »wie alles, was mich betrifft.«
Er schwieg. Die Schatten des Gangs verhüllten sein Gesicht. Den ganzen Abend hatte er hinter Ana gestanden, aber sie hatte nicht darauf geachtet, wie er aussah. Wichtigere Dinge hatten ihre Aufmerksamkeit erfordert.
»Wie heißt du?«, fragte sie.
»Jonan, Mefrouw.«
»Jonan, ich werde deine Unverschämtheit morgen früh dem Kastellan melden.« Sie wandte sich ab und ging tiefer in den Gang hinein. »Er wird entscheiden, was mit dir …«
»Seid still.«
Er stand plötzlich vor ihr und blockierte den Weg. Ana wollte sich an ihm vorbeidrängen, befürchtete plötzlich, ihn provoziert zu haben. Sie kam zwei Schritte weit, dann holte er sie ein.
»Seid still.« Jonans Worte waren nicht mehr als ein Zischen an ihrem Ohr. Sein Körper war so dicht neben ihr, dass sie seine Anspannung spüren konnte. »Lauscht.«
Sie blieb stehen. Im ersten Moment hörte sie nur ihren eigenen Herzschlag, dann Jonans Atem und entfernte Musik. Die Türen des großen Saals mussten offen stehen, sonst hätte man die Klänge nicht so tief in den Gängen hören können.
Sie erkannte die Melodie, die die Musikanten angestimmt hatten, den »Klagegesang des gierigen Bauern«. Das Lied erzählte die Geschichte eines Mannes, der eine Goldader findet, sie nicht mit seinen armen Brüdern teilt und durch diese Gier ins Unglück gestürzt wird. Ana fand es merkwürdig, dass Musikanten gerade dieses Lied an einem Hof spielten, dessen Wohlstand allein dem Gold zu verdanken war. Doch die Gäste schien das nicht zu stören. Sie sangen mit. Ana hörte ihre Stimmen bis in den Gang hinein. Sie sangen durcheinander, als würde jeder seiner eigenen Melodie folgen, ohne auf die anderen zu achten. Laut und schräg klangen sie.
Kreischend.
»Sie schreien«, flüsterte Ana. Ihre Lippen begannen zu zittern. Irgendwo schlugen Türen. »Wieso schreien sie?«
»Wartet hier.« Jonan löste sich aus den Schatten. Der Fackelschein spiegelte sich in den langen, gekrümmten Klingen in seinen Händen. Ana hatte nicht gehört, dass er sie gezogen hatte.
»Ich komme mit«, sagte sie. Die entfernten Schreie dröhnten in ihren Ohren. »Ich bleibe nicht allein hier.«
Er drehte den Kopf. Sie sah Ablehnung in seinen Augen, dann so etwas wie Verständnis. »Folgt mir.«
Obwohl die Fackeln in regelmäßigen Abständen brannten, schien der Gang, durch den sie zurückgingen, dunkler und enger geworden zu sein. Eine Männerstimme brüllte über die Musik hinweg und verstummte so plötzlich, als habe man eine Tür geschlossen. Der »Klagegesang des gierigen Bauern« erstarb, nur die Trommeln schlugen ungerührt weiter ihren Rhythmus.
»Wir müssen zu meinem Vater«, sagte Ana. »Er wird wissen, was hier geschieht.«
Jonan schwieg.
Ana wünschte sich, sie hätte sein Gesicht sehen können, aber er drehte ihr den Rücken zu. Die Angst krampfte ihren Körper zusammen.
»Es wird doch alles gut, oder?« Sie wusste, dass sie wie ein kleines Kind klang. Es war ihr egal.
Jonans gleichmäßige Schritte stockten. »Natürlich.«
Ana hörte die Lüge in seiner Stimme.
Der Bankettsaal war nur noch zwei Biegungen entfernt. Die Trommeln waren jetzt lauter als ihr Herzschlag. Es roch nach gebratenem Fleisch. Ein zweiter, seltsam metallischer Geruch mischte sich darunter. Etwas schabte über den Boden wie eine Schwertspitze, die über Stein kratzt.
Jonan blieb stehen. »Lauft.«
Ana schüttelte den Kopf. »Allein gehe ich …«
»Lauft!«
Vor ihr verlöschten die Fackeln. Dunkelheit stürzte Ana entgegen. Erschrocken wich sie zurück, drehte sich um und begann zu rennen. Ihre Ledersohlen schlugen im Rhythmus der Trommeln auf den Stein. Sie wagte es nicht, dorthin zurückzublicken, wo die Schwärze Jonan verschluckt hatte, glaubte, sie würde erstarren, wenn sie sah, was sich darin verbarg.
Eine Biegung nach der anderen ließ sie hinter sich. Ihre Kehle brannte, ihre Seiten stachen. Sie hörte jemanden schluchzen. Erst nach einer Weile begriff sie, dass sie es selbst war.
Der Gang endete in einer Tür, die zum Ostturm führte. Sie stand offen, aber Ana bog nach links ab, lief tiefer in die Burg hinein, den Gemächern ihrer Eltern entgegen. Sie hörte keine Schreie mehr, keinen Lärm. Alles war still.
Als Ana den Schatten sah, war es bereits zu spät. In vollem Lauf prallte sie gegen ihn und wurde zurückgeschleudert. Etwas schlug gegen ihren Hinterkopf. Sie lag auf einmal auf dem Boden, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen war.
Ein verschwommenes Gesicht tauchte über ihr auf. »Ich bringe Euch in Sicherheit.«
»Nein.« Sie wollte sich gegen Jonans Griff wehren, aber ihre Arme waren zu schwer. »Wir müssen Vater finden.«
Seine Stimme wurde dumpfer, leiser. »Ich habe ihn längst gefunden.«
Schwärze hüllte Ana ein.
Er hatte gesehen, wie sein Vater starb. Mit dem Rücken zu seinen Angreifern, die Hände in das Holz der verschlossenen Tür gekrallt, war er den Tod eines Feiglings gestorben. An nichts anderes konnte Gerit denken. Er sah das Bild, wann immer er die Augen schloss.
General Norhan hatte ihn gerettet, war sterbend zu ihm gekrochen, um ihn mit seinem eigenen Körper zu decken. »Beweg dich nicht«, hatte er geflüstert, und so war Gerit liegen geblieben, eingehüllt vom Eisengeruch des Blutes, umgeben von den röchelnden Lauten des Todes, niedergedrückt von einem Sterbenden.
Er wusste nicht, wann er sich befreit hatte und wie er auf das Dach gekommen war. Beim einen Lidschlag hatte er noch auf dem Boden gelegen, beim nächsten saß er bereits auf dem Dach. Eine Decke lag neben ihm. Mit zitternden Händen griff er danach und legte sie sich über die Schultern. Die bluttriefende Kleidung klebte an seinem Körper. Es war kalt.
Ich werde hier oben bleiben, dachte er. Ich werde Ratten fangen und Regenwasser trinken. Niemand wird mich finden.
Der Hof tief unter ihm war verlassen. Rauch zog träge aus einem der Gesindehäuser. Gerit sah Flammen hinter den Fensterlöchern, aber niemanden schien das Feuer zu kümmern. Nach einer Weile erlosch es von selbst.
Hufschlag riss ihn schließlich aus seinem Dämmerzustand. Gerit drehte den Kopf und blickte zu den Stallungen. Zwei Pferde trabten heraus. Im Licht der Monde hob sich der schwarz gekleidete erste Reiter scharf von der roten Stalltür ab. Er führte das zweite Pferd an den Zügeln. Eine Frau war mit Seilen daran festgebunden. Ihr Kopf war hinter dem Hals des Pferdes nicht zu sehen, aber Gerit bemerkte sofort das Kleid, das goldbestickte weiße Kleid, das sein Vater – gestorben wie ein Feigling – in Braekor hatte anfertigen lassen.
Er stand auf. Die Decke rutschte von seinen Schultern. »Ana!«, rief er. »Ana!«
Ana bewegte sich nicht, aber der vordere Reiter zügelte sein Pferd. Er blickte zum Dach empor. Das Pferd tänzelte nervös.
Gerit hob den Arm. »Ich bin hier.«
Der Reiter zögerte, dann wandte er sich ab und gab seinem Pferd die Sporen. Im Galopp ritt er durch das Tor, das zweite Tier hinter sich herziehend.
Gerit sah ihm nach, bis er in der Nacht verschwand.
»Lasst mich nicht allein«, sagte er leise. »Bitte lasst mich nicht allein.«
Kapitel 3
Nicht die Schwerter der Fürsten und Könige regieren in Somerstorm mit gnadenloser Allmacht, sondern das Wetter. Jedem Reisenden sei geraten, die Zeit seines Besuchs mit Bedacht zu wählen. Im Winter mag er leicht Opfer des Schnees werden, aber dies kann ihm auch zu jeder anderen Jahreszeit passieren. Sturm, Regen und Kälte sind die Gegner, denen er sich stellen muss, doch bleibt er dafür von einer anderen Plage verschont, denn Banditen sind in diesem Land so selten wie Sonnentage. Wer wäre auch so unvernünftig, sich den Elementen auszusetzen und einem Reisenden aufzulauern, wenn man gefahrlos die Leichen anderer, weniger glücklicher Reisender plündern kann?
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Ana wusste nicht, wann es Morgen geworden war, aber plötzlich blinzelte sie in helles Sonnenlicht. Überrascht bemerkte sie, dass sie Zügel in den Händen hielt und dass die Welt hin und her schaukelte. Sie saß auf einem Pferd.
Bilder aus der vergangenen Nacht standen reglos wie Monumente in ihrem Gedächtnis, isoliert von den Ereignissen, die sie mit ihnen verband. Sie betrachtete sie, aber sie wirkten weit entfernt, so als habe ein anderer sie erschaffen und in ihren Geist gesetzt.
Sie richtete sich im Sattel auf. Die Landschaft, die sie sah, bestand aus zerklüfteten Felsen, grünem Moos und gelbem Gras, das vom Wind gegen die Hügel gedrückt wurde. Es roch nach Salz.
Ich bin nicht weit vom Meer entfernt, dachte Ana. Was mache ich hier?
»Geht es Euch besser, Mefrouw?«
Ana drehte sich erschrocken um. Hinter ihr, keine fünf Schritte entfernt, ritt Jonan auf einem Rappen. Er trug einen langen Mantel aus Ziegenfell.
»Das ist Laws Mantel«, sagte sie. Der Stallmeister trug ihn bei jedem Ausritt. Er hatte ihn vom Fürsten als Belohnung für etwas erhalten, an das sich Ana nicht mehr erinnern konnte.
»Er braucht ihn nicht mehr.«
Sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, also schwieg sie. Die Sonne wärmte ihr Gesicht, der schwere Umhang, der nicht ihr gehörte, aber nach dessen Ursprung sie auch nicht zu fragen wagte, schützte sie vor dem Wind. Der Pfad, auf dem sie ritten, führte zwischen Hügeln, Felsen und kargen Wiesen hindurch. Wahrscheinlich nutzten die Hirten die Wiesen als Sommerweiden, denn Ana sah einige Unterstände, aber keinen einzigen Menschen.
»Wo sind wir?«, fragte sie nach einer Weile.
»Kurz hinter Nrje.«
Ana schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich. Nrje liegt mehr als einen Tagesritt von der Festung entfernt. Du musst dich irren.«
»Dies ist der dritte Tag unserer Reise, Mefrouw.«
Ihr Herz schlug schneller. Ihr Mund wurde trocken. »Du lügst.«
»Wie Ihr meint.« Jonan lenkte sein Pferd an ihrem vorbei. Seine Haut war beinahe so dunkel wie der Ziegenfellmantel.
Ana blickte auf seinen Rücken. Seine Gleichgültigkeit machte sie wütend. »Was soll das heißen? Wo sind wir wirklich?«
»Hinter Nrje«, sagte Jonan. Er drehte sich nicht um. Ana musste sich im Sattel vorbeugen, um ihn zu verstehen.
»Wegen der Flüchtlinge und der Patrouillen reiten wir abseits der Straßen«, fuhr er fort. »Deshalb kommen wir so langsam voran.«
»Was für Patrouillen?«
»Die Patrouillen, die nach Euch suchen, Mefrouw.«
Ana zog ihren Umhang fester zusammen. Darunter trug sie immer noch das Seidenkleid aus Braekor. Der Saum, der unter dem Umhang hervorragte, war schwarz vor Schmutz.
»Deine Worte verwirren mich«, sagte sie und versuchte ein wenig von der Würde ihrer Mutter in ihre Stimme zu legen. »Warum sollten wir uns vor den Patrouillen verstecken? Sie wollen mich doch sicherlich zurück zur Festung geleiten.«
»Es sind nicht unsere Patrouillen.« Jonan hielt den Rappen an und drehte sich zu ihr um. Seine dunklen Augen musterten sie einen Moment lang.
»Ihr erinnert Euch doch an das, was geschehen ist?«, fragte er dann.
»Natürlich.« Ana unterdrückte ein nervöses Lachen, das urplötzlich in ihr aufstieg. »Wer könnte sich an solche Gräuel nicht erinnern?«
Sein Blick ließ nicht von ihr ab. Sie senkte den Kopf. Ihre Finger drehten die Zügel mal in die eine, mal in die andere Richtung.
»Es ist nur so…«, sagte sie. Die Worte fielen ihr schwer. »Es ist nur so, dass ich es manchmal vergesse, so wie man vergisst, wo man einen Schal abgelegt hat.«
Ein Teil von ihr hoffte, dass Jonan sie anschreien würde, dass er sie voller Verachtung daran erinnern würde, dass ihre Mutter und ihr Vater kein Schal waren, den man einfach vergaß. Sie hoffte, dass er irgendetwas tun würde, um die starren Monumente in ihrem Geist umzuwerfen. Sie wollte all das fühlen, was sie hätte fühlen sollen, Trauer, Wut, Angst, aber da war nichts außer einer dumpfen Leere.
Jonan musterte sie einen Moment länger, dann wandte er sich ab.
»Ich verstehe«, sagte er und ritt weiter.
Ana starrte auf seinen Rücken, enttäuscht und verärgert zugleich. Wie konnte er es wagen, sie so zu ignorieren? Sie hatte ihm etwas Schändliches offenbart, obwohl er nur ein Leibwächter war. Er hätte darauf mit mehr als zwei Worten reagieren müssen, das gebot der Respekt. Aber vielleicht respektierte er sie gar nicht. Vielleicht respektierte er nur das Gold, das ihr Vater seinem Orden gab. Gegeben hatte.
»Welche Pflichten hat mein Vater dir auferlegt?«, fragte sie.
Er drehte sich nicht um, ein weiteres Zeichen seiner Missachtung.
»Ich war der Nachtwache zugeteilt, Mefrouw. Zwei Winter lang bewachte ich jede Nacht die Tür zu Eurer Kammer.«
»Warst du nicht gut genug, um mich bei Tag zu begleiten?«
Sie glaubte zu sehen, wie sich seine Schultern strafften. »Die Priester des Ordens bestimmen über meinen Dienst. Diese Frage müsstet Ihr an sie richten.«
»Du gehörst zum Orden der Trauernden Klingen, nicht wahr?«
»Wie all Eure Leibwächter, Mefrouw.«
»Ist es richtig, dass Verbrecher diesem Orden beitreten, um dem Scharfrichter zu entgehen?«
»Jeder Mann und jede Frau, die etwas zu sühnen haben, können dem Orden beitreten.«
»Und was hast du zu sühnen?«
Dieses Mal strafften sich seine Schultern tatsächlich. Wie eine Statue saß er auf seinem Pferd.
»Ich habe einen Schwur geleistet, Euch zu beschützen«, sagte er. »Alles andere betrifft nur mich.«
Er sprach ebenso ruhig wie zuvor, aber eine Kälte war in seine Stimme gekrochen, die Ana vorher nicht bemerkt hatte. Sie schwieg, wurde sich langsam der Situation bewusst, in der sie sich befand. Hier draußen zwischen den Hügeln gab es keine anderen Menschen, nur sie und einen Mann, dessen Namen sie bis vor kurzer Zeit noch nicht einmal gekannt hatte. Niemand war hier, der sie beschützen konnte, die Wachen, an deren Gegenwart sie sich so gewöhnt hatte, waren in der Festung zurückgeblieben, ob lebendig oder tot, wusste sie nicht. Überallhin hatten Wachen und Leibwächter sie begleitet, auf jedem Gang, sei er auch noch so kurz. Sie hatten Spiele gespielt, sie und ihr Bruder, hatten sich vor ihnen versteckt, aber man hatte sie stets nach kurzer Zeit gefunden.
Die Erinnerung daran versetzte ihr einen Stich.
»Wo ist Gerit?«, fragte sie. »Ist er …«
Sie ließ den Satz unvollendet.
»Er lebte, als wir die Festung verließen, Mefrouw.« Jonans Stimme klang immer noch kalt. Ana wünschte, sie hätte sein Gesicht sehen können, aber der Pfad war so schmal, dass sie nicht nebeneinander reiten konnten.
»Du hast nicht versucht, ihn zu retten?«
»Das war nicht möglich.«
Sie wartete, aber Jonan entschuldigte sich weder dafür, noch erklärte er, weshalb das nicht möglich gewesen war. Unter anderen Umständen hätte Ana ihn wie jeden Dienstboten für seine Unverschämtheit zurechtgewiesen, aber das wagte sie nicht.
Ich muss klug sein, dachte sie, klug und vorsichtig.
Der Pfad wurde breiter, die Hügel niedriger. Sumpfiges Hochland breitete sich vor Ana aus. Es erstreckte sich nach Osten bis zum Meer, nach Norden bis zu den Bergen und nach Süden bis zu der Grenze nach Braekor. Im Sommer war das Hochland wegen der gewaltigen Mückenschwärme fast unpassierbar. Im Winter war es nur hoch in den Bergen kälter. Ana wusste das von den Reisen, die sie mit ihrer Familie nach Braekor unternommen hatte. Ihr Vater und Fürst Karral waren Freunde. Gewesen.
»Wir sind tatsächlich hinter Nrje«, sagte sie leise. Jonan antwortete nicht. Er hatte sich im Sattel aufgerichtet und blickte auf die wogenden Gräser hinaus.