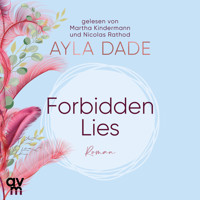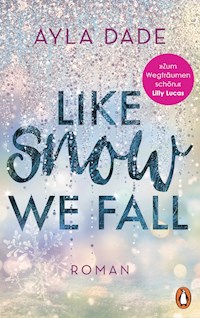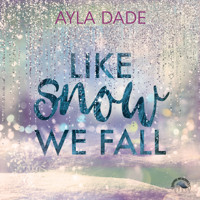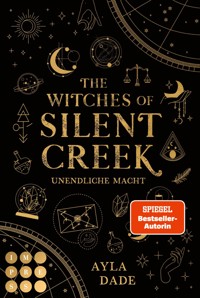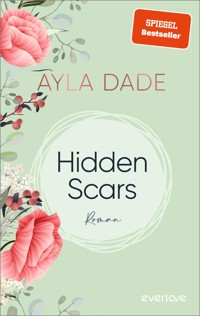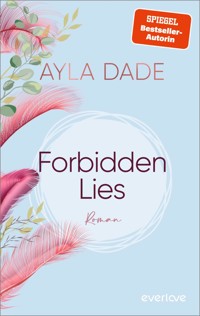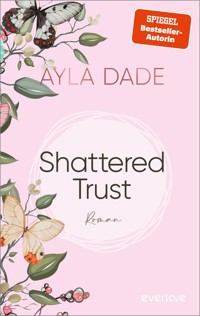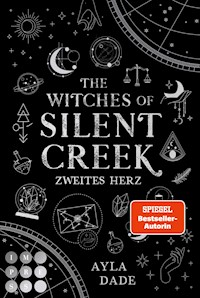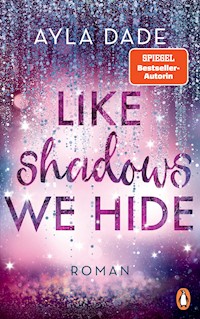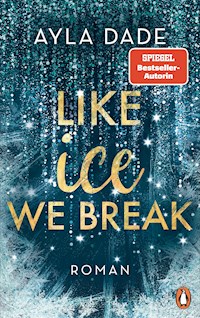The Witches of Silent Creek: The Witches of Silent Creek: Die magische Romantasy Dilogie in einer E-Box! E-Book
Ayla Dade
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
NIEDRIGER EINFÜHRUNGSPREIS NUR FÜR KURZE ZEIT! **Sieben Hexenzirkel, drei Artefakte, eine bedrohliche Aufgabe** Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß: An diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hel vor allem in Tyrael Burnett zu spüren glaubt – ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creek's College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hel wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste: Sie fühlt sie in sich selbst … Entdecke die erste, magische Romantasy-Dilogie der SPIEGEL-Besteller Autorin Ayla Dade! Persönliche Leseempfehlung von der Autorin und Bloggerin Jennifer Bright (@wort_getreu): »Ein grandioser Fantasyauftakt voller spannender Geheimnisse und Plottwists, großen Emotionen, mitreißenden Charakteren und einem absoluten Six Of Crows Flair!« //Diese E-Box enthält alle Bände der magischen Romantasy-Dilogie »The Witches of Silent Creek«. -- Band 1: Unendliche Macht -- Band 2: Zweites Herz//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses E-Book ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizensiert und wurde zum Schutz der Urheberrechte mit einem digitalen Wasserzeichen versehen. Das Wasserzeichen beinhaltet die verschlüsselte und nicht direkt sichtbare Angabe Ihrer Bestellnummer, welche im Falle einer illegalen Weitergabe und Vervielfältigung zurückverfolgt werden kann. Urheberrechtsverstöße schaden den Autor*innen und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH, Völckersstraße 14-20, 22765 Hamburg © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2024 Text © Ayla Dade, 2022; 2023 Coverbild: stock.adobe.com / © ZinetroN / © rawpixel Covergestaltung der Einzelbände: Viktoria Bühling – Covered in Colours Buchdesign, Formlabor ISBN 978-3-646-60921-9www.impressbooks.de
© Frank Böker
Ayla Dade wurde 1994 geboren und lebt in einer Hafenstadt im Norden Deutschlands. Neben dem Jura-Studium entdeckte sie das Schreiben für sich und veröffentliche bereits erfolgreiche Liebesromane, unter anderem die bekannte Winter-Dreams-Reihe. Ihr Herz schlägt für authentische, mitreißende Geschichten und dramatische Plottwists. Wenn sie nicht gerade neue Welten erschafft, widmet sie sich ihrer Liebe zum Gesang, Hund und Pferd und dem Sport.
Wohin soll es gehen?
Autor*innenvita
Band 1: Unendliche Macht
Band 2: Zweites Herz
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Ayla Dade
The The Witches of Silent Creek 1: Unendliche Macht
Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß: An diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hel vor allem in Tyrael Burnett zu spüren glaubt – ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hel wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste: Sie fühlt sie in sich selbst …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
To those who doubted me
Thank you for knockin’ me down’Cause these scars have just made me strongerAnd your words, they don’t matter nowSo thank you, thank you for knockin’ me down– Lena Meyer-Landrut, thank you
Stammbäume
HELENA
ACHT JAHRE ZUVOR
»Nicht weinen.« Seine Stimme klang sanft und beruhigend, aber ich konnte die Tränen nicht aufhalten. Finlay strich mir das Haar aus dem Gesicht. »Es sieht nicht schlimm aus.«
»Du lügst!«
»Nein, wirklich.« In der Dunkelheit bildeten wir nur schwache Schemen vor dem Hintergrund der hohen Bäume, doch der Mond prangte voll und hell am schwarzen Nachthimmel. »Es macht dich zu etwas Besonderem.«
»Hör auf«, murmelte ich und wischte mir mit dem Handrücken über das Gesicht. Das dichte Blätterdach über unseren Köpfen tanzte im sachten Wind. »Ich bin ein Monster.«
»Dann bist du das hübscheste Monster, das ich kenne.«
Jetzt lachte ich. Finlay strahlte. Ich schlang die Arme um meinen Körper und betrachtete den Jungen neben mir. Die Strähnen seines goldenen Haars machten einen weichen Eindruck. Ich kannte niemanden, der so schön war wie er. Später wollte ich ihn heiraten. Das wusste ich ganz sicher.
»Ich habe dich vermisst. Mein … mein ganzes Leben ist zerstört, Finlay.«
»Ist es nicht. Es wird nur anders.«
»Ich vermisse meine Mom.«
»Nicht weinen«, wiederholte er. Mit seiner Hand malte er unbeholfene Kreise auf den Stoff der Jacke über meiner Schulter. »Es wird leichter. Du schaffst das, weil du stark bist.«
»Bin ich nicht«, flüsterte ich.
»Doch.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil du meine beste Freundin bist. Ich kenne dich schon so lange. Helena Iversen ist das stärkste Mädchen, das ich kenne.«
Eine dicke Träne tropfte von meiner Wange. Sie traf das Pferdebügelbild auf meiner Jeans. Mein Kinn zitterte. Ich zog die Beine an den Oberkörper und vergrub das Gesicht zwischen meinen Knien. Mir war bewusst, dass meine nächsten Worte unfair waren, aber sie rutschten mir trotzdem heraus. »Du warst nicht da, obwohl ich dich gebraucht habe.«
Stille kehrte zwischen uns ein, bis Fin erneut seine einzigartige Stimme erhob. »Was ist passiert, Helena?«
Eine Weile schwieg ich. Ein Frosch hüpfte in den trüben Teich vor uns. Irgendwann zuckte ich die Achseln. »Ich kann mich nicht erinnern.«
Bis auf das fürchterliche grelle Licht …
»Was hat dein Vater dir erzählt? Warum ist deine Mutter gestorben?«
Ich schluckte hart. »Wir waren zusammen. Mom und ich. Im anderen Wald, südlich von hier. Irgendjemand hat sich einen Spaß daraus gemacht, die trockenen Blätter auf dem Boden zu entzünden. Dad sagte, die Flammen haben uns eingefangen. Mom … Sie ist …« Ich rang nach Atem. »Und ich …« Ich verzog das Gesicht, um die Tränen zurückzudrängen. Fast zeitgleich spürte ich Finlays Finger, die sanft über meine Brandnarbe strichen.
»Du hast überlebt«, beendete er den Satz. Der melodische Ton seiner Stimme klang ehrfürchtig und in seinen Augen erkannte ich Stolz. Doch ich fühlte mich grauenvoll. Fast wünschte ich, die Flammen hätten mich mitgenommen.
»Ja«, flüsterte ich, die einzelne Silbe begleitet von tiefem Schmerz.
Finlay nahm mich in die Arme und drückte mich fest an sich. »Das war ein Wunder, Helena. Die Götter wollen, dass du lebst.«
Ich wusste nicht, wie lange wir uns in den Armen lagen. Irgendwann löste ich mich von ihm, denn ich musste etwas loswerden, was mir die ganze Zeit schon auf der Seele brannte. »Du könntest zu mir ziehen. Neulich meinte Dad, er würde alles tun, damit es mir wieder besser gehe.«
»Oh, Hel.« Finlay lächelte traurig. »Vielleicht eines Tages.«
Der Mond bettete seinen Schein auf Finlays bronzefarbenen Teint. Er war immer gut gebräunt. Ich fragte mich, wie das möglich war, wenn es in Schottland ständig regnete. Fin sah aus wie ein sonnengebrannter Prinz, und obwohl er nur ein Jahr älter war als ich, war er deutlich reifer. Vielleicht fühlte ich deshalb diese besondere Wärme in seiner Nähe. Er gab mir das Gefühl von Sicherheit. Die Tatsache, dass dies unser letzter Abend im Wald war, bis seine Familie das nächste Mal Urlaub machen konnte, verursachte einen brennenden Schmerz in mir. Seine Eltern führten eine Arztpraxis und konnten sich selten Zeit nehmen, um das Land zu verlassen. So hatte es mir Finlay zumindest erklärt. Bei dem Gedanken daran, ihn wieder gehen lassen zu müssen, verzog ich das Gesicht.
»Hör zu.« Fin nahm meine Hände und drehte mich so, dass er mir direkt in die Augen sehen konnte. »Deine Mom ist nicht mehr da, aber ich verspreche dir, dass ich niemals verschwinden werde, okay? Ich bin dein bester Freund, ich werde immer dein bester Freund sein, und wenn ich älter bin, gehe ich nie wieder weg.«
»Versprochen?«
»Bei meinem Leben«, sagte er. Dann wühlte er einen scharfkantigen Stein aus der Erde, hielt ihn prüfend ins Mondlicht und drehte den Handteller Richtung Himmel. Plötzlich senkte er den Stein und schnitt sich in die Haut.
Ich keuchte. »Finlay!«
»Jetzt du«, sagte er und hielt mir den Stein mit entschlossenem Gesichtsausdruck entgegen. »Es tut nicht weh.«
»Warum sollte ich das tun?« Mein Blick hing erschrocken an dem Blut in seinem Schnitt.
»Wir schließen einen Blutschwur«, sagte er. »Damit wir für immer zusammen sind. Auch wenn wir uns mal nicht sehen können.«
Ich zögerte. Der Schnitt machte mir Angst, aber nicht so sehr wie der Gedanke, nicht mehr zu Fin zu gehören. Also nahm ich den Stein, aber ich konnte mich nicht überwinden. »Mach du.«
Er schüttelte den Kopf. »Du musst. Sonst wirkt es nicht.«
»Der Schwur?«
»Ja. Es muss deine eigene Entscheidung sein. Sei mutig, Helena.«
Ich atmete tief durch, öffnete die Faust und schloss die Augen. »Okay.« Schnell schnitt ich mir in die Innenfläche. Es brannte kurz, ehe Wärme an die verletzte Stelle eilte. Als ich die Augen öffnete, färbte sich die Haut bereits rot. »Und jetzt?«
»Komm her.« Finlay rutschte näher an mich heran und hielt die Hand in die Höhe. Ein einsamer Blutstropfen folgte dem Pfad seiner Lebenslinie. »Sieh mich an.«
Ich hob den Kopf. Mein Herz machte einen seltsamen Hüpfer, den ich nicht einordnen konnte.
»Jetzt vereinen wir unser Blut, aber niemand von uns darf wegsehen, ja?«
Ich nickte. Mein Blick klebte an seinen großen Augen. Wie goldener Honig. Ich hätte ihn die ganze Nacht ansehen können und es wäre kein Problem gewesen. In der nächsten Sekunde spürte ich Finlays Hand an meiner. Unsere Wunden trafen aufeinander. Ein merkwürdiges Gefühl durchströmte mich. Es war, als würde mich reinstes Sonnenlicht fluten, und mein Herz sprang wild gegen meine Brust. Es war aufregend.
Er verschränkte die Finger mit meinen. »So. Jetzt sind wir für immer zusammen.« Doch während er mich ansah, erlosch sein Lächeln langsam. Am Ende wirkte er traurig. »Ich sollte dich nach Hause bringen.«
»Ich will nicht«, sagte ich leise.
»Du musst. Dein Vater macht sich sicher große Sorgen.«
Ich senkte den Blick und nestelte an meinem Jackenreißverschluss. »Wann werde ich dich wiedersehen?«
»Bald.« Er wirkte abwesender als zuvor. Sein Blick wanderte über das Blätterdach der Bäume, die Brauen zusammengezogen. »Versprochen.« Plötzlich löste er seine Hand aus meiner. Mit der gesunden kramte er in seiner Anoraktasche und holte etwas heraus, das aussah wie ein grauer Stein. Er sah mich an. »Der hier ist für dich.«
Mit gerunzelter Stirn nahm ich das kleine Ding entgegen und ließ es durch meine Finger gleiten, um die Form zu betrachten. »Ist das ein Drache?«
»Ja.« Endlich lächelte er wieder. »Er beschützt dich, wenn ich nicht da bin.«
Ich drückte mir das winzige Tierchen an mein Herz und schenkte Finlay den wärmsten Blick, zu dem ich imstande war. »Danke.«
Seine Augen fokussierten die furchtbare Narbe in meinem Gesicht. Ich senkte den Blick, doch er legte einen Finger unter mein Kinn, damit ich ihn wieder ansah. »Du bist eine Kämpferin, Helena. Schäme dich niemals. Für nichts. Und lass dir von keinem sagen, dass deine Narbe dich entstellt. Sie macht dich zu dem schönsten Mädchen der Welt.«
Finlay sprach immer auf diese altertümliche Weise. Er unterschied sich von den Jungs, die ich hier kannte. Jeder von ihnen grölte, machte dumme Scherze oder zog über die Mädchen her. Er nicht. Er war anders.
»Danke«, flüsterte ich erneut.
»Ich komme bald wieder«, sagte er, und ich hörte seine Worte noch, als ich längst in meinem Bett lag und durch das Fenster in die Sterne blickte. In dieser Nacht schlief ich seit langer Zeit mit einem Lächeln auf den Lippen ein. Doch der Abend im Wald sollte der letzte gewesen sein, an dem ich Finlay gesehen hatte. Er kehrte nicht zurück. Nie wieder.
Noch Jahre später waren Gedanken an goldenes Haar und edle Züge eines bronzefarbenen Gesichts der Auslöser für meine schlaflosen Nächte.
HELENA
Heute
Meine Finger schmerzten. Mit aller Kraft umklammerte ich das rostige Geländer des wackligen Stegs, der mich auf das schottische Festland führen sollte. Hinter mir schnalzte jemand mit der Zunge.
»Wird das heute noch was?«
»Gleich«, presste ich hervor, wobei es mich große Mühe kostete, nicht zu würgen. Meine Augen huschten zur Gischt, die in sanften Wellen gegen den Kai schwappte. Ich stöhnte.
»Mach schon, Mädchen«, rief eine weibliche Stimme. Sie klang genervt. »Es ist sechs Uhr. Ich brauche meinen Kaffee, verdammt!«
Ich schloss die Augen. Zitternder Atem entwich mir. Meine Hände bebten, als ich sie vom Geländer löste, um einen Schritt vorzugehen. Der Wind wehte mir die übergroße Cordjacke um die nackten Knie. Ich hätte mir denken müssen, dass mich in Schottland keine Sommerhitze erwarten würde.
»Die hat sie nicht mehr alle«, murmelte die Person hinter mir. Gerade dachte ich noch, dass sie wütend klang, doch plötzlich spürte ich, wie mein Arm zur Seite gerissen wurde. Mein schützender, rettender, überlebenssichernder Arm!
Das rostige Geländer bohrte sich unangenehm in meinen Rücken. Ich keuchte. Mein Körper reagierte, als mein Verstand ihm vorschrieb, die Augen zu öffnen. Die Panik verschluckte den Schrei, der sich einen Weg aus meiner Kehle bahnte.
Vor mir erstreckte sich die Nordsee. Ein graues, verschlingendes Monster. Es war Furcht einflößend. So schlimm, dass ich nicht denken konnte, nicht atmen, nicht einmal leben. In dieser Sekunde existierte bloß das Meer, nur das Wasser, das mich in einen anderen Moment katapultierte. Einen Moment, der dafür gesorgt hatte, dass ich heute hier stand.
»Hey.« Eine angenehm klingende weibliche Stimme drang durch den Nebel zu mir durch. »Es ist alles gut. Sieh mich an, okay? Hier.«
Das Geräusch von schnippenden Fingern erklang. Ich blinzelte, aber momentan waren meine Augen wie eine schlecht fokussierende Kamera. Es dauerte, bis mein Sichtfeld sich schärfte und ich die Frau vor mir erblickte. Kurze schwarze Haare umrahmten ihr spitzes Gesicht. Sie hatte Augen so hell wie der Himmel, in dem frische Wolken tanzten. Sie lächelte, und das war schön, denn das Meer war es nicht.
»Ist es das Wasser?«
Ich nickte. Sie auch. Wir waren uns einig. Wunderbar.
»Schließ die Augen und nimm meine Hand. Ich führe dich.«
Ich kannte sie nicht, aber meine Möglichkeiten waren begrenzt. Also vertraute ich ihr. Alles drehte sich, obwohl ich bloß schwarze Pünktchen vor meinen Augen sah. Aber ich erkannte den Strudel, schwarz in schwarz, ein riesengroßes, düsteres Chaos. Nach schrecklichen Sekunden mit schrecklichen Gedanken darüber, wie das hier ausgehen könnte, spürte ich festen Boden unter den Füßen.
Vor Erleichterung wimmerte ich. Gierig füllte ich meine Lungen mit der salzigen Luft. Ich öffnete die Augen, um der Frau zu danken, doch … sie war verschwunden.
Ich drehte mich im Kreis und suchte die Hafenpromenade ab. Seefahrer luden Kisten in ihre Fischerboote, bereiteten sich auf den Tag vor; hinter einem Zeitungswagen wedelte ein Mann mit blaugrau gestreifter Mütze und Regenjacke mit dem neusten Newspaper. »Die First Ministerin verkündet!«, rief er. »Kein stationiertes Militär in den Städten Aberdeenshires!«
Ich hatte über die Vorkommnisse in Aberdeenshire gelesen – vor allem rund um Silent Creek. Seit einiger Zeit verschwanden Menschen spurlos. Schon länger wurde über eigentümliche »Unfälle« berichtet, die genauen Ursachen der Tode meist unklar, doch das Verschwinden von Personen war neu.
Ein Zurren gesellte sich zur Hafenluft, als der Besitzer eines Fischimbisses seine Markise ausrollte. Neuankömmlinge der Fähre orientierten sich oder hetzten über den Hafen, doch egal, wo ich hinsah … die fremde Frau war fort.
»Eh, Henne!«, rief eine Stimme neben mir. Sie klang entnervt.
Ich wandte mich um und erkannte ein Crewmitglied der Fähre an seiner dunkelblauen Uniform. »Meinst du mich?« Es sah so aus, denn er trug meinen schweren Überseekoffer über die ungleichmäßig gesetzten Asphaltsteine. Ein rechteckiger Kasten, der alle Habseligkeiten enthielt, die mir noch geblieben waren. Mich verwirrte bloß, weshalb er mich mit einem Hühnchen verglich, bis mir einfiel, dass es der schottische Slang für »Mädchen« war.
Mit dem Kinn deutete er auf den Koffer in seinen Händen. »Haste auf dem Schiff vergessen.« Die Zigarette in seinem Mundwinkel wackelte bedrohlich. »Ist schwer, das Teil.«
Er wollte ihn absetzen, doch ich riss protestierend die Arme in die Höhe. »Nicht!«
Furchen gruben sich in seine Stirn, ehe er die schütteren Brauen zusammenzog. »Hä?«
»Nicht … absetzen.« Hastig streckte ich die Hände aus und nahm ihm den Koffer ab. »Tut mir leid. Ich … ja. Danke.«
Perplex musterte er mich. Schließlich nahm er seine Zigarette zwischen die Finger, verpestete die Luft mit ihrem giftigen Qualm und kehrte um. Ich lauschte dem tiefen Schallsignal eines ankernden Schiffs, während mein Blick zur angrenzenden Straße schweifte, um die Gegend nach einem gelben Haus abzusuchen. Ich sollte Nathaniel dort treffen. Er hatte gemeint, er mied den Hafen. Zu viele Leute. Nun, in dieser Hinsicht ähnelten wir uns schon mal.
Nach einer Weile fand ich den Weg, den er mir geschildert hatte. Eine aufsteigende, schmale Straße, die in einem Rundbogen verlief und zum Fähranleger führte. Die hohen Sohlen meiner Knöchel-Docs klangen dumpf auf dem Asphalt. Außer mir befand sich niemand in dieser Nebenstraße, doch in der Ferne vernahm ich den hellen Klang einer Glocke, die zum Betreten der Fähre aufrief. Ein rotgoldener Farbverlauf warf seine Pinselstriche an den Horizont, als die Sonne ihren Aufgang ankündigte.
Silent Creek war ein sonderbarer Ort. Alles schien still. Ich vernahm das Rascheln der Blätter, die sich in der seichten Frühlingsbrise wiegten, und den Singsang vereinzelter Vögel, der anders klang, als ich ihn von zu Hause kannte. Eine leise, melancholische Melodie. Sie begleitete mich, bis ich den vereinbarten Treffpunkt erreichte und wartete.
Die Minuten verflogen. Andere hätten gedacht, ich stünde allein vor dem verwaisten Lädchen mit rot-weißer Markise, in dessen Schaufenster zurückgebliebene Apothekergläschen Staub ansetzten. Aber ich wusste es besser. Ich wurde beobachtet. Nur wenige Minuten nachdem ich den Treffpunkt erreicht hatte, war er mir aufgefallen. Die Ärmel seines grauen Wollpullovers schmiegten sich um seine Ellbogen, schwarze Linien zierten die sehnigen Unterarme. Der Kontrast zwischen Tinte und blasser Haut war so enorm, dass er mich beinahe blendete. Der Typ hockte auf einem Baum auf der anderen Straßenseite und gaffte mich an.
Ich versuchte, eine nüchterne Maske zu wahren. Er sollte nicht denken, mich einschüchtern zu können. Obwohl er genau das tat. Mit jeder Minute, die verging, fühlte ich mich unwohler. Ich dachte an Jack the Ripper und wurde nervös. Die Lust, an meinem ersten Tag in dieser Stadt von einem gestörten Serienkiller angegriffen zu werden, hielt sich in Grenzen.
Feuchtigkeit bildete sich auf meinen Handflächen. Der Ledergriff des rustikalen Überseekoffers meines Vaters drohte mir zu entgleiten, weshalb ich meine Hände um das schmale Wildlederstück zu Fäusten ballte. Unter der Last spürte ich meine Muskeln brennen. Doch etwas in mir sträubte sich, den Koffer abzustellen; etwas in mir wollte sich nicht eingestehen, dass mein Aufenthalt in Silent Creek endgültig war.
Ich nahm den Koffer in eine Hand, kramte aus meiner Jacke den kleinen Stein, den ich immer bei mir trug, und strich beruhigend über seine Kerben. In all den Jahren, nachdem Finlay ihn mir geschenkt hatte, war er immer bei mir gewesen. Mein Anker. Ein Schutzbringer. Er gab mir das Gefühl von Sicherheit. Von Wärme. Das Gefühl, nicht allein zu sein. Obwohl ich es längst war.
Immer wieder wanderte mein Blick zu der hohen Eiche, die hinter dem Ziegelhäuschen auf der anderen Straßenseite in die Höhe ragte. Auf einem breiten Ast, halb verborgen zwischen dem dichten grünen Blätterwuchs, saß der blasse Typ und ließ mich nicht aus den Augen. Seinen Rücken hatte er gegen den breiten Baumstamm gelehnt, ein Bein angezogen, das andere lässig in der Luft baumelnd. Der Schnürsenkel eines seiner schwarzen Chucks hatte sich aus der Schleife gelöst.
Wir lieferten uns ein bitteres Blickduell, aber er sah nicht weg. Es schien ihn nicht zu interessieren, dass ich ihn bemerkt hatte. Sein wild abstehendes rabenschwarzes Haar verteilte sich auf der braunen Rinde, während er seine Unterlippe geistesabwesend zwischen Daumen und Zeigefinger knetete.
»Helena?«
Ich zuckte zusammen. Der Ledergriff entglitt mir, woraufhin der Koffer mit einem dumpfen Aufprall auf den Asphalt traf. Hastig bückte ich mich, um ihn wieder an mich zu drücken, ehe ich in das wettergegerbte Gesicht eines alten Mannes blickte. Tränensäcke prangten unter seinen wässrigen grauen Augen, ein deutlich hervortretendes Merkmal seiner dünnen Pergamenthaut.
»Nathaniel?«
Er nickte. In seinem Gesicht regte sich nichts. Die blassen Lippen waren zu einer schmalen Linie zusammengepresst. Ich musterte ihn genauer. Unter seinem schäbigen Pullunder trug er ein faltiges vergilbtes Hemd, das vielleicht einmal weiß gewesen war. Seine steife Jeanshose wirkte verwaschen und eine zu große Armbanduhr baumelte an seinem dürren Handgelenk. Die Zeiger lagen auf den falschen Zahlen. Sie bewegten sich nicht.
Mein Großvater machte einen bemitleidenswerten Eindruck.
Er trat einen Schritt vor. »Ich nehme deinen Koffer.«
Ich betrachtete seine langen Finger. Zögernd sah ich ihn an. »Aber nicht abstellen, okay?«
Nathaniel Iversen hinterfragte meine Aussage nicht. Aus seinem Mund ertönte bloß ein zustimmendes Grunzen. Ausdruckslos nahm er mir den Koffer ab, wobei sein Blick auf meiner Stirn ruhte. Ich drehte den Kopf weg. Die Brandnarbe in meinem Gesicht glühte, als hätte seine Musterung das verschlingende Feuer neu entfacht.
Eine unangenehme Sekunde verstrich. Ich vernahm das Pochen meines Herzens. Schließlich machte mein Großvater auf dem Absatz kehrt. Wortlos lief er die Straße hinab. Ich folgte ihm, doch in meinem Nacken prickelte es unangenehm. Der Drang, einen Blick über die Schulter zu werfen, war enorm. Ich gab mir größte Mühe, es auszublenden, doch je weiter ich mich entfernte, desto intensiver wurde das Kribbeln.
Als wir eine Gabelung erreichten und Nathaniel nach rechts abbog, war es unmöglich, unmöglich, das Bedürfnis weiter zu ignorieren. Langsam wendete ich den Kopf. Die weißblonden Strähnen meines Pferdeschwanzes streiften meine Cordjacke. Fast sofort fokussierten meine Augen den Ast der Eiche, die einsam hinter dem Ziegelhäuschen thronte. Nur Sekunden lagen zwischen diesem Moment und unserem letzten Blickkontakt, doch … der Typ war verschwunden.
»Wie war die Überfahrt?«
»Ganz okay«, presste ich hervor. Nathaniel musste nicht wissen, dass ich bloß zitternd auf meinem Sitzplatz gekauert und die Nacht damit verbracht hatte, dem Schnarchen meines Sitzpartners zu lauschen, um das Geräusch des schwappenden Wassers auszublenden.
Nathaniel grunzte, und damit schien sein Small-Talk-Versuch beendet. Nach einer Weile erreichten wir den Marktplatz der Stadt. Das Licht der Dreiflammenlaterne brach sich im gusseisernen Material einer imposanten Frauenstatue inmitten des quadratisch angeordneten Häuserwalls. Meine Schritte verlangsamten sich, während ich sie betrachtete.
Dies war keine normale Frau. Ihr Gesicht wirkte eigenartig, geradezu bizarr. Ich konnte nicht wegsehen. Die rechte Hälfte war gezeichnet durch unverkennbare Schönheit: detailliert herausgearbeitete Merkmale in dem hohen Wangenknochen, der Lippenhälfte und dem Auge. Die rechte Seite ihres Gesichts jedoch … Himmel! Selten hatte ich etwas derart Gruseliges gesehen. Je länger ich die eigentümlichen Symbole betrachtete, die mit fein säuberlicher Präzision in das Material eingearbeitet worden waren, desto unbehaglicher fühlte ich mich. Das Auge der rechten Gesichtshälfte war detailarm, ein düsteres Loch. Zerschundene Lippen kontrastierten zu der kunstvoll gearbeiteten Seite; ein langer Schlitz stellte die Nase dar.
Nathaniel war fast an der Statue vorbei, als er bemerkte, dass ich stehen geblieben war. Sein Blick glitt von mir zum Bildnis der Frau und wieder zurück. »Kommst du, oder was?«
Ihre einnehmende Aura fesselte mich. Es fiel mir schwer, mich abzuwenden. In meinen Nacken legte sich eine bedrückende Decke, als würde die Luft wispernde Worte zu mir herübertragen und sich an mich heften. Ein Schauder überkam mich.
Schließlich schüttelte ich den Kopf und folgte meinem Großvater. Als wir den Marktplatz auf der gegenüberliegenden Seite verließen und einen ansteigenden Weg nach links einschlugen, bemerkte ich, wie er unauffällig in meine Richtung schielte.
»Morrigan«, sagte er plötzlich.
Ich blinzelte. »Hm?«
»Die Statue im Zentrum. Ein Gedenken an die Totengöttin.«
»Oh.« Ich sah über die ramponierte Backsteinmauer hinweg, die den aufsteigenden Pfad begrenzte. Sie bewahrte uns vor einem Sturz von der ansteigenden Küste, reichte jedoch nur bis zum Ende des Weges. Unter uns erstreckte sich die endlose Weite des graublauen Wassers. Ich zog den Kopf zurück, doch der kurze Augenblick hatte gereicht. Meine Knie wackelten.
Ich musste tief durchatmen. Der salzige Duft der Meeresbrise stieg mir in die Nase. Mit der Fingerkuppe fuhr ich am rauen Fugenmörtel zwischen den Abrisssteinen entlang, den Blick starr geradeaus gerichtet. Ich hatte keine Ahnung, wer die Totengöttin war oder welchem Mythos sie entsprang.
»Morrigan«, wiederholte ich leise, um mich von dem Gedanken des Wassers abzulenken. »Klingt edel.«
Nathaniel nickte. Eine Möwe kreischte. Sie flog über uns hinweg und ließ sich auf der Spitze eines einsamen Masts nieder. Als der Pfad endete und wir uns in einer kleinen Siedlung vereinzelter Häuser wiederfanden, war meine Atmung einem angestrengten Keuchen gewichen. Mein Großvater hingegen verzog keine Miene.
Ich ließ den Blick über die schiefen, unsauber gezimmerten Häuser schweifen. In Silent Creek stand die Zeit still. Es war so anders als Deutschland. So anders als alle Städte, die ich je gesehen hatte. Silent Creek wirkte altertümlich und unzeitgemäß. Es war, als besuchte ich die Requisiten eines Filmsets, der auf dem vorangegangenen Jahrhundert basierte. Die Tatsache, dass ich an diesem Ort in wenigen Stunden zum ersten Mal das College betreten würde, erschien mir in dieser Sekunde völlig realitätsfern. Eher begegnete ich Smaug in seiner Einöde.
»Hier.« Nathaniel blieb neben einem rechteckigen Haus aus braunem Gestein stehen. Dreck zierte die äußeren Fensterläden und den verschnörkelten Rahmen, der die Tür umgab. Stürmische Tage schienen das weiße Holz mit Moder und Morast bedeckt zu haben. Ein Schornstein ragte aus dem mit bunten Ziegeln gepflasterten Dach. »Das ist mein Haus.«
Diesmal war ich diejenige, die bloß nickte. Mir fehlten die Worte, denn das Zuhause meines Großvaters wirkte wie ein Lost-Place-Gebäude.
Nathaniel ging voran. Ich nutzte seine Unaufmerksamkeit, um den Vorgarten zu inspizieren. Eine teils zerstörte Steinwand und eine ungepflegte Hecke umgaben die verdorrte Rasenfläche. Wirrer Efeu schlängelte sich um eine verwitterte Eisenbank. Durch den wuchernden Busch, der sie umgab, war der Sitzplatz kaum zu erkennen. Ich zählte fünf verwahrloste Pflanzen. Zwei von ihnen lagen samt Blumenerde auf dem Rasen, die Kübel leisteten ihnen zerbrochene Gesellschaft.
Dies war ein trostloser Ort.
Als mein Großvater den Schlüssel im Schloss drehte und die Tür öffnete, schlug mir ein fauliger Geruch mit solcher Unbarmherzigkeit ins Gesicht, dass ich würgen musste.
Es stank. Gott, es stank so sehr, dass ich mich ernsthaft fragte, ob Nathaniel jemanden in diesem Haus verwesen ließ. Doch als er den Lichtschalter betätigte und mein Blick über die Berge dreckigen Geschirrs wanderte, über die fest gewordene Kruste alten Kartoffelbreis und die weißgrüne Schimmelschicht auf den Resten eines Eintopfs, verwarf ich den Gedanken einer verdorrten Leiche.
Nathaniel Iversen lebte schlicht und einfach dreckig.
Mein Großvater mied meinen Blick. Für einen Moment betrachtete ich ihn, versuchte, in seinen Zügen Ähnlichkeiten zu mir zu entdecken, doch traf auf Fremdheit.
Er warf ein paar alte Zeitungen und Joghurtbecher von einer Truhe und stellte meinen Koffer darauf ab. »Hast du Hunger?«
»Nein, danke.«
Meine erste Lüge in Silent Creek. Sollte ich anfangen, sie zu zählen? Vermutlich nicht.
Nathaniel quittierte das Geräusch meines knurrenden Magens mit einem grimmigen Blick. »Setzen. Es gibt Frühstück.«
Fragte ich mich im ersten Moment noch, wo er Platz zum Kochen finden wollte, betete ich im zweiten, bloß dem Schimmeleintopf entkommen zu können. Ein Knarren begleitete mich, als meine Füße mich über die rustikalen Holzdielen durch den Raum trugen. Ich setzte mich an den runden Esstisch und beobachtete, wie er altes Essen von zwei Tellern kratzte und sie mit einer Spülbürste schrubbte. Aus einem Topf schöpfte er Essen hinein. Mein Magen zog sich zusammen.
Nathaniel kam zurück, setzte sich mir gegenüber und schob mir meinen Teller über den Tisch. Toast und Baked Beans. Ohne Schimmelschicht, Gott sei Dank.
Was für eine merkwürdige Situation! Dieser Mensch war mein Großvater, aber ich hatte ihn bis auf vergilbten, rissigen Bildern nie gesehen. Und plötzlich wohnte ich hier. Es war verrückt, etwas, das meine Eltern niemals erlaubt hätten. Aber sie hatten keine Möglichkeit, es mir zu verbieten. Sie waren tot. Alle beide.
Mit der Gabel deutete ich auf den antiken Herd, dessen Abzugshaube von einem Holzvorsprung verdeckt wurde. Pfannen und Töpfe baumelten an dessen Balken. »Antik, aber stilvoll. Hast du die Kücheninsel selbst gebaut?«
Seine grauen Augen blickten zu dem grob geschliffenen Möbelstück. Die quadratische Arbeitsfläche war zugemüllt, dennoch konnte ich die eingearbeiteten Kerben erkennen.
»Ja«, sagte er.
Ich ignorierte meinen Magen, der beim Anblick der Müllhalde um mich herum heftig protestierte. Mit angehaltener Luft tunkte ich den Toast in die Tomatensoße der Baked Beans. Schweigen hüllte uns ein, nur das Geräusch des Bestecks war zu hören, wenn es gegen das Keramik klirrte. Nach einer Weile hielt ich es nicht mehr aus. Das Schweigen. Den Gestank. Meine kreisenden Gedanken über mein neues Zuhause.
»Danke für das Frühstück.« Meine Stimme klang nasal, weil ich mich darauf konzentrierte, nicht durch die Nase zu atmen. »Wenn es in Ordnung ist, würde ich jetzt meinen Koffer auspacken, bevor ich zum College muss.«
Nathaniel wirkte erleichtert. Er erhob seinen dürren Körper, um die Teller abzuräumen. Die Stuhlbeine kratzten über den Holzboden.
»Und du bist sicher, dass du heute schon zum College willst? Du könntest auch morgen gehen.«
»Ich will nichts verpassen.«
Er presste die Lippen zusammen. »Warum bist du nicht schon letzte Woche angereist, wie wir es geplant hatten?« Mein Großvater kehrte mir den Rücken zu, während er vor den Geschirrbergen innehielt und zu überlegen schien, welcher Gipfel noch nicht zu hoch war, um zwei weitere Teller bei sich aufzunehmen. »Keine Nachricht, kein Wort, und auf einmal dein Anruf gestern Abend, dass du auf dem Weg seist.«
Ich zupfte an der Nagelhaut meines Daumens, weiterhin darauf bedacht, durch den Mund zu atmen. »Es gab Dinge zu klären.«
Ging man nicht gerade davon aus, dass es sich bei diesen »Dingen« um die Entscheidung drehte, die Minibar im Hotel zu plündern oder lieber etwas vom Chinesen aufs Zimmer zu bestellen, war dies eine glatte Lüge. Schon die zweite.
Nathaniel brauchte nicht zu wissen, dass ich es nicht über mich gebracht hatte, die ursprüngliche Fähre eine Woche zuvor zu nehmen. Er brauchte nicht zu wissen, dass es mich am ganzen Körper geschüttelt hatte, als ich mit meinem Überseekoffer am Hafen Amsterdams gestanden und das Wasser beobachtet hatte, das sich gnadenlos gegen den Fähranleger geworfen hatte. Und vor allem brauchte er nicht zu wissen, dass mein kleiner Körper von etwas über anderthalb Metern vor nackter Angst, den einzigen Ort zu verlassen, der mich mit meinen Eltern verband, geradezu zerrissen worden war.
Aber schließlich hatte ich es tun müssen. Wenn ich herausfinden wollte, weshalb meine Mutter Silent Creek hinter sich gelassen hatte, weshalb sie geflüchtet war und die schottische Küste niemals wieder hatte betreten wollen, konnte ich nicht weiterleben wie bisher. Wenn ich herausfinden wollte, wer sie gewesen war, musste ich diese Herausforderung annehmen. Zurück hätte ich sowieso nicht gekonnt. Mein Elternhaus hatte ich verkauft.
Und jetzt war ich hier, mit dem Vater meiner Mutter, in einer winzigen, düsteren Stadt; mein neues Zuhause war eine Müllhalde, alles schien von Wasser umgeben, und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Ich fühlte mich verlorener denn je.
Mit den Händen strich ich mir über die Seiten meiner Skinny Jeans, beobachtete, wie Nathaniel sich bewegte, wie das graue, schüttere Haar platt an seinem Hinterkopf lag und wie gleichgültig ihm dieser Dreckstall war, wie gleichgültig ich ihm war. Ich erhob mich, er nahm meinen Koffer und schritt voran die Treppe hinauf. Ich folgte ihm. Die Stufen knarrten. Als ich die obere Etage erreichte, kam mein Großvater aus dem Zimmer am Ende des Flurs. In einer unsicheren Geste wischte er mit den Handflächen über die Seiten seines Pullunders.
»Dein Koffer liegt auf dem Bett. Für den Fall, dass du … dass er den Boden immer noch nicht berühren soll.«
»Danke«, murmelte ich.
Er nickte. »Deine Collegeuniform hängt im Schrank.«
Langsam trat ich vor, legte die Handfläche ans Holz der angelehnten Tür und öffnete sie. Was auch immer ich erwartet hatte – nach der Unordnung im Rest des Hauses war es nicht das.
In diesem Zimmer herrschte penible Sauberkeit. Es war klein, sodass das schmale Einzelbett seitlich zum Fenster platziert worden war. Ich spürte es sofort. Schon im Bruchteil der ersten Sekunde, als ich den Raum betrat, überkam mich Gewissheit. Dieses Zimmer hatte meiner Mutter gehört. Es war ihr Stil. Alles schien mit Blumenmustern verziert. Die meerblauen Wände, der Matratzenüberwurf, die Pastellgemälde. Sogar die Zimmerdecke.
Meine Mutter hatte immer gemalt. Am allerliebsten Naturelemente. Wenn ich an sie dachte, erschienen Farbkleckse vor meinem inneren Auge. Sie sprenkelten ihr Gesicht. Dad hatte sie die Blüte seines Herzens, der Leben eingehaucht worden war, genannt. Bis es ihr genommen worden war.
Vorsichtig setzte ich mich. In meinem Hals bildete sich ein Kloß, während meine Hände über den Blumenstoff des Überwurfs strichen. Ich registrierte kaum, wie ich mich wie ein Fuchs neben meinem Koffer einrollte, eines der Zierkissen zwischen die Hände nahm und meine Nase darin vergrub. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Den Rosenduft meiner Mutter?
Wie dumm, Helena. Wie dumm. Sie war tot. Das wusste ich nur zu genau.
Trotzdem spürte ich die Eiseskälte, die brennende Enttäuschung, die mich flutete, als das Einzige, das ich roch, der schwache Lavendelduft des Weichspülers war. Ein raues Schluchzen brach aus mir hervor. Ich grub die Finger in das Kissen, während die aufkommenden Tränen meinen Körper schüttelten. Ihr Salz brannte sich in meine Wangen, doch nichts auf der Welt hätte sie in dieser Sekunde aufhalten können.
Erinnerungen packten mich, zwangen sich mir auf, und ich sah ihr Lächeln, ihre weißblonden Haare, ihre feine Himmelfahrtsnase, die meiner so ähnlich war. Ich sah die Sorge in ihrem Gesicht, wenn ich stolperte oder mir wehtat, schmeckte das Erdbeereis, das wir regelmäßig im Garten geschleckt hatten. Die Erinnerung ihrer sanften Stimme brach über mich herein. Ich hatte vor Augen, wie sie mich abends in den Schlaf wiegte, ein zarter Singsang, während ihre Finger meine Kopfhaut kraulten. Fast war es, als spürte ich diese Berührung.
Jahrelang hatte ich meinen Vater angefleht, nach Silent Creek zu gehen. Ich hatte gebettelt, ihr Zuhause sehen zu dürfen, zu sehen, wo sie aufgewachsen war, wie sie aufgewachsen war. Ich hatte meiner Mutter nah sein wollen, näher, als ich es in Gedanken hatte sein können. An dem Ort, der sie zu dem selbstlosen, liebevollen Menschen hatte werden lassen.
Dad hatte sich geweigert. Doch jetzt war ich hier. Jetzt lag ich auf dem Bett, in dem meine Mutter die Sterne beobachtet hatte, die nachts durch das hohe weiße Fenster hereinschienen. Ich konnte nicht zählen, wie oft sie mir von ihnen erzählt hatte. Von der Magie des Himmels über Silent Creek und dem lebendigen, prickelnden Gefühl, das das Leben an der schottischen, rauen Küste in ihr entfacht hatte. Ich war der Meinung gewesen, wenn ich herkäme, ginge es mir genauso. Ich hatte angenommen, dieser Ort hielte Antworten bereit, nach denen ich immer gesucht hatte. So sicher war ich mir gewesen, dass ich ihn hier spüren würde – diesen Zauber des Lebens.
Jetzt war ich in Silent Creek. Und alles, was ich fühlte, war nichts.
TYRAEL
Eine Nacht zuvor
Der Wind schlug mir unbarmherzig ins Gesicht. Es war eine raue Herbstnacht. Unter mir gab Exodia ein zufriedenes Grölen von sich, jedes Mal, wenn eine Böe sie aus der Bahn warf. Wenigstens sie hatte ihren Spaß.
Ich suchte die Verbindung zu meiner Macht, ertastete sie wie zarte Finger, die sich sachte auf den weißen Tasten eines Flügels niederließen, und wurde Herrscher meines eigenen Nervensystems. Stumm gab ich den Muskeln meiner Hand zu verstehen, dass sie sich lockern mussten – ansonsten würde die Kälte der Nacht verhindern, dass ich weiterhin in der Lage war, mich auf meiner Heralchiro zu halten. Meine Lust, meterweit in die Tiefe zu stürzen, hielt sich in Grenzen.
»Nieder!«
Mein Fledermausdrache reagierte sofort. Ich spannte die Muskeln meines Körpers an, als sie den hinteren Teil mitsamt ihrem Stachelschwanz in die Höhe stob, um zu einem Sinkflug anzusetzen. Während meiner ersten Flugstunden war es oft passiert, dass der Schwung mich über Exodias Kopf geworfen hatte – doch das war Jahre her. Inzwischen waren sie und ich eine eingeschworene Einheit.
Die Haare stoben mir aus dem Gesicht und meine Wangen schmerzten unter dem Druck des schnellen Fahrtwinds, ehe mein Flugwesen die Füße streckte. Als sie die grün bewachsene Fläche streiften, rissen ihre Krallen lange Abdrücke in die Erde. Die Wucht ihrer Landung ließ Exodia einige Meter vorwärtsstolpern. Ich übte einen routinierten Druck an ihrem Unsichtbarkeitshalsband aus, woraufhin sie gehorsam innehielt und sich auf ihrem Hintern niederließ.
»Braves Mädchen«, murmelte ich, gab ihr einen belohnenden Klaps auf die nackte graue Lederhaut und rutschte von ihrem Rücken.
Exodia hatte bereits den Kopf gesenkt und rupfte mit akribischer Präzision jeden noch so kleinen Grashalm aus dem saftigen Boden, doch ihre übergroßen Fledermausohren waren gespitzt. Meine treue Begleiterin achtete auf jeden Laut, bereit, uns vor Gefahren zu schützen. Auch die Pupillen bewegten sich rasch in ihren Kugelaugen. Bis auf ihr gieriges Schmatzen herrschte eine angenehme Stille. In der Ferne vernahm ich das seichte Schwappen der Wellen, die gegen das Festland brandeten. Gedankenverloren leckte ich mir über die Lippen. Ein feiner Salzfilm lag auf meiner Haut.
»Warte hier«, sagte ich, kehrte meinem Flugwesen den Rücken zu und schlenderte dem großen Hügel entgegen. Er war von einem kreisförmigen Graben umgeben. Je näher ich dem neolithischen Grabhügel kam, desto mehr überkam mich das unangenehme Gefühl von kalten Berührungen, die über meine Haut streiften – obwohl ich meine Jagdmontur trug. Es war unbestreitbar, was die Seelen mir sagten: Du bist ein Eindringling und gehörst hier nicht her.
Ich erreichte den Eingang. Kies knirschte unter meinen Füßen, ehe ich das stockdustere Innere betrat. Unter dem großen Grashügel verbarg sich Maeshowe – eine Grabstätte, erbaut aus tonnenschweren und meterlangen Sandsteinquadern. Nicht wenige von ihnen besaßen die Größe eines Autos. Steinpfeiler stützten das uralte Dach der Kammer. Ich entzündete ein Streichholz und ließ die Flamme auf meine mitgebrachte Fackel übergehen. Sekunden später füllte dämmriges Licht den hohen Raum.
Ich näherte mich dem Teil der Wand, an dem die täglichen Touristen in den Stein geritzte Hieroglyphen bewunderten. Der Sage nach hatten ausruhende Nordmänner vor Jahrhunderten an dieser Wand zotige Sprüche über Frauen hinterlassen oder mit ihren Besitztümern geprahlt, um ihre Langeweile zu vertreiben. Doch ich wusste es besser: Diese Runen entstammten der azlatekschen Sprache. Sie beinhalteten einen düsteren Zauber, der für unsereins verboten war. Kaum einer des Lichten Volkes würde die Oberen auf diese Weise hintergehen, denn keiner hatte Interesse daran, dem Ergebnis der schwarzen Magie zu begegnen. Schließlich kämpften wir jede Nacht aufs Neue gegen unsere Düsteren Brüder und Schwestern. Mein Volk wäre enttäuscht, wüssten sie, was ich hier regelmäßig tat. Aber ich hatte keine Wahl.
Die Flamme der Fackel knisterte. Sie warf den Schatten meines Gesichts auf das helle Gestein der Wand, während ich mit dem Zeigefinger über einzelne Runen fuhr.
»Quoda suma, hoc sumare. Hoc suma, quod eris«, murmelte ich, während ich nach meiner Fähigkeit tastete und mein Kraftfeld zwang, die dunkle Materie zu erreichen. Mein Inneres sträubte sich. Ich war nicht trainiert für diese Form von Magie, und dies war der einzige dunkle Zauber, zu dem ich in der Lage war. Es hatte mich Jahre meiner Zeit gekostet, ihn zu lernen.
»Quoda suma, hoc sumare«, wiederholte ich. Was wir sind, werdet ihr sein. »Hoc suma, quod eris.« Was ihr seid, waren wir einst. »Tib ossa terra abiit.« Mögen deine Gebeine die Erde berühren. »Hic est Lachlan Tsibea.« Hier ist Lachlan Tsibea.
Hitze flutete meinen Körper, zwang mich in die Knie. Meine Hand rutschte von der Wand. Ich presste die Zähne aufeinander, rief mir in Gedanken zu, dass ich nicht verbrennen würde, dass es aufhören würde. Ein paar Sekunden hielt sich die Qual, ehe sie ersetzt wurde durch eine Eiseskälte. Es war, als erfrören meine Nerven. In mir protestierte mein Chaos, wand sich wie ein leidendes Tier. Es war ein Schmerz, der mir bis ins Mark ging.
Ein Keuchen entrang sich mir, während ich benommen wahrnahm, wie sich einzelne Partikel in der Luft vor meinen Augen materialisierten. Die Pein der schwarzen Magie verebbte, während die entstellte Person vollendete Gestalt annahm.
Vor mir stand Lachlan Tsibea, Zugehöriger des Düsteren Volks und einer der letzten verbliebenen Nekromanten. Sein blutrotes Haar stand wie eine Krone von seiner gräulichen Haut ab. Etliche Krater entstellten sein Gesicht wie tiefe Narben. Ein säuerlicher Geruch ging von ihm aus und verteilte sich in der Grabkammer. Die Gesichter unserer Düsteren Brüder und Schwestern wirkten wie die von Würmern und Maden zerfressene Haut einer Leiche mit den Konturen eines Totenschädels. Auch ihre Körper waren spindeldürr. Das Düstere Volk bestand beinahe nur aus papierner Haut und Knochen, denn die Anderwelt zehrte an ihnen.
»Tyrael Burnett«, sagte Lachlan und grinste. Seine Zähne waren spitz wie mörderische Dolche. »Was für eine unerwartete Freude.«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Bedauerlich«, murmelte Lachlan und begann, in der runden Stätte auf und ab zu schreiten. »Gerade wollte ich mich von der anstrengenden Jagd erholen und mich einem Schlummerstündchen hingeben.«
»Der aufgebaute Schutzwall lässt nach. Ich kann es spüren. Der Fluch zehrt an mir.«
Lachlan hielt in der Bewegung inne und gab ein tiefes Seufzen von sich. »Warum hast du bloß mich dazu auserkoren, mich dieser lästigen Angelegenheit anzunehmen?«
»Du weißt mehr über diese Art von Zauber als irgendwer sonst. Und du bist nicht wie sie.«
»Wie wer?«
»Der Rest des Düsteren Volkes.«
Lachlan grinste. »Oh, Junge. Ich bin ganz genau wie sie.«
»Nein.«
Lachlans tiefschwarze Augen bohrten sich in meine. Es konnte bedrohlich wirken, und manch anderer wäre vermutlich zurückgewichen, doch ich fürchtete mich nicht. In diesem Leben hatte ich nichts mehr zu verlieren.
»Und was geleitet dich zu dieser Annahme, Burnett?«
»Du bist hier«, sagte ich. »Du könntest die Magie abwehren, doch jedes Mal beantwortest du sie mit deinem Kommen.«
»Weil du mir wertvolle Stunden außerhalb der Anderwelt schenkst. Nach Mitternacht auf der Erde verweilen – so lange, bis die nächste Dämmerung anbricht und die Jagd vorüber ist. Wer wäre ich, dieses Privileg zu verwerfen?«
»Möglich. Aber ich denke, da ist noch etwas anderes.«
»Und das wäre?«
»Eine Eigenschaft der Azlata, die längst verloren zu sein scheint und weit über separierte Völker hinausgeht.«
»Sprich Klartext, Junge.«
Ich sah ihm tief in die Augen. »Loyalität gegenüber deinen Brüdern und Schwestern.«
Lachlan verbarg seinen Herzschlag vor mir. Er wusste, dass ich ihn beobachtete, und er wusste, dass ich gründlich war. Tyrael Burnett würde eine Situation niemals dem Zufall überlassen. Natürlich versuchte ich, eine Verbindung zu seinem Muskelsystem aufzubauen. Ganz egal, was ich über ihn dachte: Ich musste gewappnet sein. Aber Lachlans Macht war meiner nicht unähnlich. Bevor jemand wie er zuließ, dass ich seine Stimmung anhand des Pulses ausmachen konnte, verbarg er seine Organe mit gewissenhafter Genauigkeit.
»Ich hasse dich, Burnett.«
»Ich weiß.«
»Deine Familie ist Abschaum.«
»Nur mein Bruder.«
Er knurrte. »Dein Vater ganz besonders.«
»Weil er dich letzte Woche bis auf die Isle of Harris gejagt hat?« Ich lachte. »Das ist sein Job.«
»Ich habe keinen Menschen angegriffen!«, rief er. »Verrate mir, Burnett: In welcher Welt ist es gerecht, Unschuldige für die Fehler anderer zu bestrafen?«
»In dieser.«
»Du denkst, es wäre richtig?«
»Ich sagte, in dieser Welt ist es gerecht, aber ich würde nie behaupten, Freund dieser subjektiven Gerechtigkeit zu sein, Lachlan.« Er musterte mich argwöhnisch. Ich bewegte mich keinen Millimeter. »Gerechtigkeit ohne Gnade ist bloß Unmenschlichkeit.«
Lachlan spuckte auf den Boden. »Eure Oberen heucheln friedvolle Absichten, doch es ist ein perfekt inszeniertes Theater! Sie halten eure Fäden in der Hand und manipulieren euch wie Puppen.«
»Niemand manipuliert mich und niemand hält mich in der Hand.«
»Denkst du.«
»Weiß ich.« In einer schnellen Bewegung entledigte ich mich meiner Monturjacke und dem darunterliegenden Pullover. Der flackernde Schein der Fackel warf ein dämmriges Licht auf meinen muskulösen Torso. Ich deutete auf die tiefen Löcher in meiner Haut. »Mein Körper ist ein Schlachtfeld, Lachlan. Nichts weiter als eine zerstörte Ebene mit verlassenen Kratern längst explodierter Minen.« Ich funkelte ihn an. »Keiner wird jemals wieder die Kontrolle über mich haben. Ich gehöre mir.«
Die Sekunden verstrichen. Es war unmöglich zu sagen, ob Lachlan meine Narben musterte oder mein Gesicht. Seine pechschwarzen Augen ließen keine Bewegungseinschätzung zu.
»Leg dich hin«, sagte er plötzlich.
Ich lehnte die Fackel an einen Stein und tat es. Der feste Untergrund drückte kühl gegen meinen Rücken. Lachlan bewegte seinen langen Zeigefinger. Einen Augenaufschlag später grub sich eine kreisrunde Kerbe um meinen Körper herum in den Boden. Kurz glühte der schmale Graben grell auf, ehe knöchelhohe schwarze Flammen mich umgaben.
Der mächtige Nekromant schlich wie ein Raubtier um mich herum. Mein Körper wurde abwechselnd in Licht und Schatten gehüllt, jedes Mal, wenn die Flammen der Fackel aufzüngelten und wieder sanken. Fremde Worte verließen Lachlans Mund. Sie klangen wie ein eiskaltes Wispern in dunkler Nacht. Mit seinen Krallen zeichnete er die Kontur meines Körpers nach. In der Luft entstand eine teerartige Silhouette meiner selbst, und zwischen den einzelnen Schwaden erkannte ich giftgrüne Schlieren, die sich durch den Nebel fraßen. Sie trugen das Geräusch von kindlichem Gelächter mit sich.
Lachlan verzog das Gesicht. Mit der anderen Hand wirbelte er durch die Luft, malte glühende Runen in den verschleierten Dunst. Schwarze Adern traten in seinem Totenschädelgesicht hervor, je mehr er sich anstrengte. Sein Körper zitterte, doch er hörte nicht auf.
Hitze flutete meinen Körper. Binnen Sekunden war ich schweißgebadet. Der Düstere führte eine letzte Rune aus, murmelte Beschwörungsformeln und stieß plötzlich ins Leere, als schlüge er jemanden. Die glühende Zeichenfolge wisperte, wirbelte durcheinander und schoss auf mich zu. Sie grub sich in meinen Körper.
Ich unterdrückte einen Schrei, beugte den Rücken durch, presste die Zähne aufeinander. Es war, als würde jemand all meine Organe packen, zudrücken und sie mir entreißen. Doch Lachlan hatte mir erklärt, was er tat, bevor ich mich zum ersten Mal auf diesen Boden gelegt hatte: Er schuf einen künstlichen Schutz, der sich wie eine Festung in meinem Inneren aufbaute. Der Fluch wurde ausgeschlossen. Ihm fehlte die Macht, den Wall zu durchbrechen, doch ich spürte, wie er kämpfte. Und er würde nicht damit aufhören.
Lachlan ließ seine Hand sinken. Die schwarzen Flammen erloschen. Schwer atmend lag ich auf dem Boden, während die Welt um mich herum wankte. Es dauerte einen Moment, bis ich mich erheben konnte. Meine Beine waren zittrig.
»Das sollte eine Weile vorhalten«, sagte Lachlan.
Ich lehnte eine Hand gegen den Sandstein. »Wie lange?«
»Eine Weile«, wiederholte er.
»Die Abstände werden kürzer.« Es war eine Tatsache, die ich nicht länger leugnen konnte. Ich bückte mich, zog Pullover und Monturjacke über und wischte mir mit dem Ärmel den Schweiß aus dem Gesicht. »Der Fluch wird stärker.«
»Ich habe dir gesagt, dass es so kommen würde.« Lachlan wirkte unbekümmert, als sprächen wir über ein belangloses Thema, über das wir uns uneinig waren. »Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Energien machen sich deine Kräfte zu eigen.«
»Was kann ich tun?« Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich einen Hauch von Verzweiflung zwischen meinen Worten wahr. »Es muss eine Möglichkeit geben. Du musst mich heilen, Lachlan.«
»Das steht nicht mehr in meiner Macht. Aber es gäbe einen Weg.«
»Nenn ihn mir. Ich würde alles tun.«
»Alles?«
»Alles.«
»Nun …« Lachlan hob die Fackel vom Boden auf und betrachtete die züngelnden Flammen. Seine papierne Haut schien so dünn, dass ich mir einbildete, der Lichtschein würde ihn durchleuchten. »Du brauchst die Unendliche Macht.«
Eine Sekunde verging, in der ich ihn perplex musterte. Dann brach schallendes Gelächter aus mir heraus. Der freudlose Klang erfüllte die uralte Grabstätte. »Mir war nicht bewusst, dass du heute zu Scherzen aufgelegt bist.«
»Oh, ich scherze nicht.« Seine schwarzen Augen fokussierten mich. »Es ist mein Ernst. Sofern du überleben willst, Burnett.«
Mein Lächeln erstarb. »Die Unendliche Macht ist seit Jahrhunderten verschwunden. Sogar die mächtigsten Azlata aller Zeiten waren nicht in der Lage, sie aufzuspüren. Natürlich nicht. Die Götter persönlich haben die drei Insignien versteckt, Lachlan. Niemand wird jemals im Besitz dieses Artefakts sein.«
»Du vergisst Syphrah Iversen, Junge.«
»Ich glaube kein Wort dieses lächerlichen Ammenmärchens«, zischte ich. »Die Iversens sind und waren seit jeher nichts als ein betrügerischer, wichtigtuerischer Clan ohne Sinn und Verstand. Stell mir eine Reihe Düsterer neben eine einzige Iversen – ich würde zu töten sie wählen.«
Lachlan grinste. »Dann wird es dich freuen zu hören, dass Helena zum Morgengrauen den Hafen erreichen wird.«
Ich verzog das Gesicht. Er lachte. Es klang kälter als der Tod.
»Was auch immer du von den Iversens hältst: Dein sogenanntes Ammenmärchen ist der einzige Anhaltspunkt, den du hast. Nutze ihn, wenn dein Leben dir etwas wert ist. Suche Major Thomas Weir und nimm ihm die Macht.«
»Niemand könnte je dazu fähig sein.«
Lachlans Miene wurde ernst. »Wenn es einer könnte, dann du, Burnett.« Er schnipste mit den Fingern und verschwand.
Ich blieb zurück mit meinen stürmischen Gedanken und der Flamme der Fackel, die zurückhaltend brannte, als schuldete sie der Situation eine ehrfürchtige Darbietung. Nichts ließ darauf schließen, dass ein Nekromant des Düsteren Volkes soeben ein mächtiges Ritual an mir vollzogen hatte. Hätte das Regiment auch nur den Hauch einer Vermutung gehabt, hätte ich mich mit meinem nächsten Atemzug bereits ins Exil verabschieden können. Ich ging eine Menge Risiken mit diesen heimlichen Treffen ein, doch Lachlan war mein einziger Hoffnungsschimmer in einer immer tristeren Welt. Und so lächerlich seine Worte auch geklungen hatten … Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte.
Wie eine trübe Sicht, die sich langsam klärte, dämmerte mir, dass ich keine andere Wahl hatte. Ob ich nun scheiterte oder nicht: Diese lebensmüde, hirnrissige Mission war mein letzter verbliebener Anker. Und das bedeutete, ich musste mich gegen die oberste Regel meines Volkes stellen. Käme dies ans Licht, machte ich mich des Hochverrats schuldig. Die Oberen würden mich hinrichten. Gnadenlos. Aber täte ich es nicht, wartete am Ende des Gehorsams ebenfalls die Totengöttin, um mich nach Tír na nÓg zu begleiten.
Meine Entscheidung stand fest. Ich würde das oberste Gesetz brechen. Von jetzt an zählten bloß Major Thomas Weir und die Unendliche Macht uralter keltischer Gottheiten.
Als ich nach draußen trat, spürte ich neue Hoffnung. Die kühle Luft kitzelte meine Wangen. Ich schwang mich auf Exodia und trieb sie in den Himmel. Dieser Flug unterschied sich von unserer Anreise. Zuvor hatte eine trübe Aura mich und meine Heralchiro begleitet. Sie hatte ständige Klagelaute von sich gegeben, die im schneidenden Wind verloren gegangen waren. Exodia hatte gespürt, dass etwas in mir aufgeben wollte.
Die heutige Nacht verabschiedete sich mit klarem Himmel. Das erste Mal seit langer Zeit fiel kein Tropfen Regen.
HELENA
Das Gesicht meines Großvaters war hinter einer Zeitung verschwunden, als ich die Treppe herunterkam. Er hörte meine Schritte und ließ sie sinken. Ausdruckslos musterte er die Collegeuniform, bestehend aus einem rot karierten Faltenrock und einer weißen Bluse mit Puffärmeln.
Sie war scheußlich. Weiße Wollkniestrümpfe reichten bis über meine Knie. Die auf den Stoff des Rocks abgestimmte Fliege war am obersten Knopf zwischen den Seiten des Hemdkragens angebracht und gab mir das Gefühl, jemand hätte mich mit kitschigem Geschenkband verpackt. Ich blickte auf die klobigen schwarzen Schnürschuhe, die wirkten, als entstammten sie dem neunzehnten Jahrhundert. Schon jetzt vermisste ich meine gemütlichen Doc Martens. Das Outfit schien eine aus der Mode gekommene Version des Dark-Academia-Looks zu sein.
»Dein Blazer.« Nathaniels Blick huschte zu dem Kleidungsstück, dessen Kragen ich zwischen den Fingern hielt. Sein Saum wischte die staubigen Stufen der Treppe. »Warum trägst du ihn nicht?«
Ich erreichte das Ende der Treppe und zuckte die Achseln. »Heute soll es warm werden. Die App hat eine volle Sonne gezeigt.«
»App?«
»Auf meinem Handy.«
»Aha.« Er runzelte die Stirn. »Du musst deinen Blazer tragen.«
Ich lehnte mich mit dem Rücken gegen die massive Vitrine, auf deren Regalkante Bücher und Müll und Gläser und Müll und Kerzen und – Überraschung! – Müll sich gegenseitig den Platz stahlen.
»Es ist nur …« Resigniert blickte ich auf den Blazer, ehe ich wieder aufsah. »Mit dem Ding sehe ich aus, als würde ich einer Marschkapelle angehören.«
»Das ist absurd«, sagte er. »Was ist verkehrt an Manschetten?«
»Nichts, aber …« Ich seufzte. »Ich würde bloß gern meine eigenen Sachen tragen.«
Nathaniel legte die Zeitung beiseite und erhob sich. Er lief in die Küche, kehrte mir den Rücken zu und kam mit einer Kaffeetasse in der Hand zurück. »Das Creek’s College hat Prinzipien, Helena.«
Ich verdrehte die Augen. »Das ist absurd. Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert.« Mit den Händen strich ich über meine Uniform. »Wo bleibt die Selbstbestimmung?«
Sein Blick ruhte weiterhin auf mir, ausdruckslos und unbeeindruckt. Noch einmal nippte er an seinem Kaffee. »Am besten, du versuchst dich anzupassen. Es wäre nicht von Vorteil, den Bewohnern einen Grund zu geben, über dich zu reden.«
Resigniert ließ ich die Schultern sinken. »Adieu, Anonymität.«
Nathaniel starrte in seine Plörre. »Silent Creek ist anders. Aber du wirst dich daran gewöhnen.«
»Sicher.« Es fühlte sich an, als könnte ich niemals mit diesem Ort warm werden. Aber ja, vielleicht brauchte es Zeit. Ich schob den Gurt meines Jutebeutels höher auf die Schulter und wandte mich ab. »Bis heute Abend.«
»Sei vor Sonnenuntergang wieder zurück.«
Ich hielt in der Bewegung inne. »Weshalb?«
Mein Großvater fuhr mit der Fingerkuppe den Rand seiner Tasse nach. Das schwache Licht einer Gaslaterne warf einen unheimlichen Schatten auf ihn. »Zum Abendessen.« Er blickte auf seinen Fingernagel. »Das sind … meine Prinzipien. Abendessen um sieben. Halt dich dran.«
»Okay.« Einen Moment verharrte ich vor der Haustür. Meine Finger ruhten auf dem Türknauf, während ich meinen Großvater ansah. Doch er machte keine Anstalten, den Kopf zu heben. »Soll ich … ich meine, ich könnte das Haus aufräumen. Heute Abend. Es würde mich freuen, wenn ich dir dabei helfen –«
»Nein.« Sein barscher Ton ließ mich zusammenzucken. Die Tasse in seiner Hand zitterte. Kaffee schwappte über, bedeckte seine Finger und sprenkelte den Holzboden. Ich bezweifelte, dass er es aufwischen würde. »Ich mache das.«
»Ich könnte –«
»Ich mache das, Helena.« Er sah mich nicht an. »Nun geh. Du kommst zu spät.«
Ich reagierte nicht sofort. Doch als Nathaniel sich abwandte und träge in die Küche schlurfte, verließ ich das Haus. Gierig schnappte ich nach der salzigen Frühlingsluft. Für den Osten Schottlands waren die Sonnenstrahlen heute ungewöhnlich großzügig. Ich schob die Ärmel der grässlichen Bluse über die Ellbogen und durchquerte den verkümmerten Vorgarten. Mir war schleierhaft, wie mein Großvater in diesem Haus leben konnte.
Hier oben umgab die Klippen keine Begrenzung. Rauer Wind zerrte an mir, stob meine Strähnen durcheinander. Ponyfransen wehten mir ins Gesicht. Ich musste mir einen Pferdeschwanz binden und verabschiedete mich gleichermaßen von den Korkenziehern, die ich mir mit dem Glätteisen gemacht hatte. Ich genoss die berauschenden Kleinigkeiten der wilden Natur, auch das sanfte Schwappen der Gischt gegen die Klippenwand, solange ich das Meer nicht sah.
Aufmerksam nahm ich jedes Detail der rauen Umgebung in mich auf, bis mein Blick an einem kleinen Mädchen hängen blieb. Sie kniete nicht weit entfernt von mir an den Klippen. Ihre Knie ragten ein paar Millimeter über den Abgrund hinaus. Die Spitzen ihres feuerroten Haars streiften ihr Kinn. Sie beugte sich vor, um mit den Fingern eine Stelle losen Gerölls zu erkunden, und lachte, sobald die Steine in die Tiefe fielen. Ich jedoch sah mich panisch um. Gehört dieses Kind zu niemandem?
Ein weiteres Mal beugte sie sich vor – aber diesmal verlor sie das Gleichgewicht. Mein Herz überschlug sich. Ich rannte, so schnell ich konnte, sah, wie sie strauchelte, wollte brüllen, schreien, irgendetwas, aber das würde ihr nicht helfen, also rannte ich bloß noch schneller, betete, hoffte, bangte.
Nur noch drei Meter, dachte ich. Drei, jetzt zwei, halt durch, Kleine, halt durch …
Sie riss die Augen auf. Ihr Mund formte ein schreckgeweitetes, großes O. Abrupt blieb ich stehen. Schock flutete mein Herz. Es war zu spät.
Das Mädchen fiel in die Tiefe.
HELENA
Der Schrei, den ich ausstieß, war markerschütternd. Er verlor sich über dem Meer, das nur Sekunden zuvor ein unschuldiges Kind verschlungen hatte. Atemlos stand ich da, Arme und Hände von mir gestreckt, als könnte ich sie fangen, als könnte ich noch verhindern, was gerade geschehen war. Trotz der Sonnenstrahlen hüllte mich eine unbarmherzige Kälte ein. Ihre eisigen Klauen lähmten mich. Es gelang mir nicht, über den Abgrund zu blicken.
Nur vage drang das Geräusch einer zuschnappenden Haustür durch meinen Nebel. Ich wandte den Kopf und entdeckte einen jungen Mann in schwarzem Rollkragenpullover. Sein strohblondes Haar stand ihm wild und ungezähmt vom Kopf – so wild wie sein Blick, der sich in meinen bohrte.
»Das Kind«, rief ich. »Es ist …«
Er ließ mich meinen Satz nicht beenden. Innerhalb von Sekunden befand er sich am Klippenabgrund. Zwischen uns beiden gefror die Zeit. Ich beobachtete ihn, beobachtete seine Züge und wartete mit angehaltenem Atem auf den Moment, der mir verraten würde, dass es endgültig war. Ich wusste nicht, mit was für einer Reaktion ich gerechnet hatte. Vielleicht mit loderndem Schmerz in seinen warmbraunen Augen. Was ich mit Sicherheit nicht erwartet hatte, war das amüsierte Grinsen, das sich in dieser Sekunde auf das hochattraktive Gesicht des Fremden stahl.
»Dein Drang nach Nervenkitzel wird mir inzwischen lästig.« Seine langen Finger umfassten den Klippenrand. Eine leichte Böe strich ihm die Haarspitzen aus dem Gesicht, ehe sie sich wieder über sein linkes Auge legten. »Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Aleen Woodward.«
»Mit wem sprichst du?«, fragte ich irritiert.
»Mit meiner Tochter.«
»Wie bitte?«
Statt einer Antwort streckte er die Arme aus. Unter dem Stoff des Pullovers erkannte ich trainierte Muskelstränge. Eine erneute Welle der Panik überrollte mich, denn ich dachte, er wäre der Nächste, der in die Tiefe stürzte. Doch plötzlich kam ein roter Haarschopf hinter der Geröllwand zum Vorschein, auf dem kindlichen Gesicht ein breites Grinsen, während der Mann das Mädchen über die Klippen hob. Was zum …
Ungläubig starrte ich sie an. Ihr kleines Köpfchen lehnte an der Schulter ihres Vaters, und als sie meinen Blick bemerkte, verbarg sie das Gesicht an seinem Arm. Sie war jung. Ich schätzte sie auf nicht älter als fünf. Er hingegen schien in meinem Alter, aber seine Haltung, seine Gesichtszüge, alles an ihm wirkte so selbstbewusst, so graziös, dass ich mich ihm meilenweit unterlegen fühlte.
»Entschuldige.« Er klang, als ginge es hierbei um den letzten Kaffee, den er mir gestohlen hatte. »Aleens Verhalten kann beängstigend sein, wenn man sie nicht kennt.«
»Beängstigend?« Ich blinzelte. »Das war nicht nur beängstigend. Ich war … ich konnte nicht …« Wild gestikulierte ich mit den Armen. »Sie ist von der Klippe gestürzt!«
Er musterte mich nüchtern. »Aleen weiß, was sie tut.«
Wut baute sich in mir auf, flatterte im Inneren meiner Brust wie eine aufgebrachte Schwalbe. »Sie ist ein Kind! Wieso lässt du sie allein an diesem Abgrund spielen?«
Er verzog keine Miene. Sein nichtssagendes Grinsen lag nach wie vor auf seinen Lippen. Eine spannungsgeladene Stille erhob sich, in der ich mich auf seine Antwort vorbereitete, mir Worte zurechtlegte, mit denen ich ihn konfrontieren konnte.
Dieses Kind hätte tot sein können!
»Aleen weiß, was sie tut«, wiederholte er. Bevor ich etwas entgegnen, bevor ich überhaupt Luft holen konnte, kehrte er mir in beinahe Furcht einflößender Eleganz den Rücken zu und verschwand mit seiner Tochter im Haus.
Fassungslos sah ich ihnen hinterher, ehe mir erst der klägliche Zustand seiner Steinhütte bewusst wurde. Das Gebäude wirkte wie ein traditionelles Cottage längst vergessener Tage. Die weiße Trockensteinwand war verwittert, die Fenster klein und asymmetrisch. Stroh ersetzte ein herkömmliches Dach. Dieses Haus musste bereits wesentlich länger hier stehen, als Silent Creek existierte.
Meine nicht verrauchte Wut bewirkte, dass ich einen zittrigen Atemzug ausstieß. Er verlor sich im Wind. Mit vorsichtigen Schritten näherte ich mich dem Abgrund der Klippe. Beim Anblick der schwindelerregenden Höhe protestierten meine Beine. Mir entfuhr ein unterdrücktes Keuchen, doch sosehr es mich auch ängstigte … es war unmöglich, mich wieder abzuwenden.
Mit zarten Berührungen verteilte die weiß schäumende Gischt melancholische Küsse auf der Gesteinswand. Die ungefilterte Schönheit der Natur hypnotisierte mich. Ich fragte mich, wie etwas so Schönes gleichzeitig so beängstigend sein konnte, und war beunruhigt. Mein Blick suchte das Gestein ab und blieb an einem Vorsprung hängen, der aus der flachen Klippenwand herausragte. Es wirkte unnatürlich. Bizarr.
In meinem Kopf stürmten wirre Gedanken. Die Panik von gerade hielt sich in meinen Gliedern und schwächte nur langsam ab. Ich zog mich zurück, doch die Situation flimmerte weiterhin vor meinem inneren Auge. Das schockgeweitete Gesicht des Mädchens, als es gefallen war. Das Grinsen, als ihr Vater sie wieder über die Klippen gehoben hatte. Wie konnte es sein, dass die glatte Klippenwand nur diesen einzigen Vorsprung besaß – genau an dieser Stelle?
Ich zwang mich zur Ruhe. Mein Kopf überdramatisierte das Ganze. Das Kind lebte hier. Es kannte diesen Ort. Und trotzdem …
Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus. Plötzlich wollte ich nichts sehnlicher als fort von diesen Klippen. Ich nahm den Pfad hinunter zum Stadtzentrum und verlor mich in den schmalen Gassen zwischen den Häusern, bis ich den Hafen erreichte. Der Geruch von Fisch und Seetang schlug mir entgegen und ein kühler Windzug ließ meine Oberschenkel frösteln. Eine Weile lief ich über die unsauber verlegten Pflastersteine des Kais, bis ein Gespräch zweier Seemänner zu mir herüberwehte. Sie unterhielten sich über ihre Boote hinweg. Beide trugen Fischerhüte und Angelwesten.
»Heute Abend ein kühles Blondes im Queen’s Cliff, Ruphus?«
»Ich weiß nicht …«
»Komm schon, alter Sack. Morgen muss ich nach Stonehaven.«