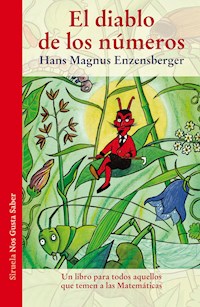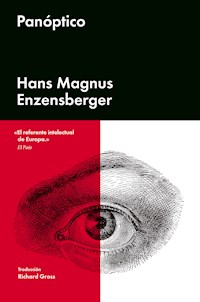10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Wie konnte in tausend Tagen so viel passieren? Wer sich nach einem halben Jahrhundert wiederbegegnet, muss auf Überraschungen gefasst sein. Hans Magnus Enzensberger hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen: Ein zufälliger Kellerfund gab den Anlass für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. 1963 führt den Autor eine erste Reise nach Russland, und unverhofft wird er zum Gast auf Chruschtschows Datscha in Gagra. Das Ergebnis ist ein genaues Porträt des Mannes und der sowjetischen »Tauwetter«-Politik dieser Zeit. Drei Jahre später durchreist Enzensberger die UdSSR vom äußersten Süden bis nach Sibirien. Auf diesem Parforceritt nehmen die Verwicklungen des »russische Romans«, der konfliktreichen Beziehung zu seiner zweiten, russischen Frau, ihren Anfang. 1968/1969 gerät der Dichter dann in eine Phase des politischen und privaten Tumults. Mitten im Vietnamkrieg folgt er einer Einladung an die Wesleyan University, aber schon nach wenigen Monaten lockt das Kuba der Revolution. Doch sind die Fraktionskämpfe der außerparlamentarischen Opposition in Berlin nicht so weit entfernt, als dass der Dichter nicht auch auf diesem Schauplatz zum Akteur würde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Wer sich nach einem halben Jahrhundert wiederbegegnet, muß auf Überraschungen gefaßt sein. Hans Magnus Enzensberger hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen. Ein zufälliger Kellerfund gab den Anlaß für eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Entstanden ist ein autobiographischer Rückblick auf ein Jahrzehnt des Tumults.
1963 führt den Autor eine erste Reise nach Rußland, und unverhofft wird er zum Gast auf Chruschtschows Datscha in Gagra. Drei Jahre später durchstreift Enzensberger die UdSSR vom äußersten Süden bis nach Sibirien. Auf diesem Parforceritt nimmt die Beziehung zu seiner zweiten, russischen Frau ihren Anfang, die als »russischer Roman« das Buch wie ein roter Faden durchzieht. In den Jahren 1968-69 gerät der Dichter in eine Phase des politischen und privaten Tumults. Mitten im Vietnamkrieg verschlägt es ihn in die USA, dann in die Turbulenzen der cubanischen Revolution. Doch sind die Fraktionskämpfe der außerparlamentarischen Opposition in Berlin nicht so weit entfernt, als daß der Dichter nicht auch auf diesem Schauplatz zum Akteur würde …
Wie aber sieht mit dem zeitlichen Abstand von 50 Jahren der alte Enzensberger den jungen? Die Antwort auf diese Frage gibt ein lebhaftes Streitgespräch, in dem beide sich ihrer Haut zu wehren wissen. In einem Schlußkapitel mit der lapidaren Überschrift »Danach« nimmt der Autor Abschied von den »politischen und privaten Obsessionen der 60er Jahre«. Es ist der Zeitpunkt, auch der Verlierer zu gedenken – und derer, die ihm nahestanden. Gewidmet ist das Buch »Den Verschwundenen«.
»Eines Tages war alles vorbei. Es überkommt mich, ich weiß nicht, warum, eine große Ruhe. Als ich diese zwei Zeilen hinschrieb, war die Zeit der Normalisierung angebrochen. War die Vernunft zurückgekehrt? Nein. Doch der Tumult war nicht umsonst gewesen.«
Hans Magnus Enzensberger, geboren am 11. November 1929 in Kaufbeuren. Als Lyriker, Essayist, Biograph, Herausgeber und Übersetzer einer der einflußreichsten und weltweit bekanntesten deutschen Intellektuellen. Mit seinem neuen, autobiographischen Buch bietet er einen Rückblick auf ein umstrittenes Jahrzehnt: die sechziger Jahre.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER
TUMULT
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Buchausgabe
Erste Auflage 2014
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlagfoto: Wilfried Bauer/Agentur Focus
eISBN 978-3-518-73862-7
www.suhrkamp.de
Den Verschwundenen
7Inhalt
1963Aufzeichnungen von einer ersten Begegnung mit Rußland
1966Gekritzelte Tagebuchnotizen von einer Reise durch die Sowjetunion und ihren Folgen
2015Prämissen
1967-1970Erinnerungen an einen Tumult
1970ff.Danach
Personenregister
9Aufzeichnungen von einer ersten Begegnung mit Rußland (1963)
Die Adresse war nicht ganz korrekt, aber dennoch landete der Brief in meinem Kasten: Budal Gar, Tome, Norwegen. Die Italiener haben immer Schwierigkeiten mit Buchstaben, die in ihrem Alphabet fehlen. Den Absender auf dem Kuvert konnte ich nicht auf Anhieb entziffern. Er bestand aus einer Abkürzung: Comes. »Caro amico«, las ich; der Mann, der mir so freundlich schrieb, hieß Giancarlo Vigorelli und unterzeichnete als Generalsekretär und Herausgeber der römischen Zeitschrift L’Europa Letteraria. Erst da fiel mir ein, daß ich ihn vor Jahr und Tag kennengelernt hatte. In Italien ist ein Talent wie das seine nicht allzu selten. Ehrgeiz, Geschicklichkeit und gute, parteiübergreifende Beziehungen verhalfen ihm zu Geldern, deren Herkunft undeutlich blieb. Er nutzte sie zur Gründung einer Organisation, die sich Comunità Europea degli Scrittori nannte. Böse Zungen verglichen ihn mit einem Impresario oder einem Zirkusdirektor. Aber das war ungerecht, denn seine Initiativen waren verdienstvoll. Weit und breit gab es, mitten im Kalten Krieg, niemanden, der sich mit so viel Eifer und Bonhomie darum bemühte, die Gräben zwischen den verfeindeten Blöcken wenigstens auf dem Terrain der Kultur zu überbrücken. Auf diese Weise hatte er bereits das eine oder andere Treffen zwischen »westlichen« und »östlichen« Schriftstellern zustande gebracht.
Nun hielt ich seine Einladung zu einer Begegnung in der Hand, die in Leningrad stattfinden sollte. Wie ich auf Vigorel10lis Liste geraten bin, war mir nicht klar. Denn auf ihr standen, wie er mir zu verstehen gab, Autoren aus vielen Ländern, darunter auch einige von großem Kaliber. Es war durchaus nicht selbstverständlich, daß Vigorelli auch an die Westdeutschen gedacht hatte. Leningrad war für unsereinen ein mythischer, um nicht zu sagen verbotener Ort, der nicht im nahen, sondern im fernen Osten lag; zum einen, weil ein deutsches Heer Leningrad vor zwanzig Jahren eingeschlossen, belagert und ausgehungert hatte, und zum andern, weil Jalta diese Stadt hinter einem Vorhang verschwinden ließ, der schwer zu öffnen war. Die Stimmung auf beiden Seiten der Berliner Mauer war militant, vergiftet von der Angst vor Eskalationen an der Naht der beiden Imperien.
Deutschland, das waren zwei Protektorate, auf der einen Seite die laue Bundesrepublik, auf der anderen die »Zone«, über die ich wenig Illusionen hegte, geimpft wie ich war durch den Augenschein und durch frühe Lektüre: Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, Orwells Homage to Catalonia und Verführtes Denken von Czesław Miłosz. Auch eine Dosis von marxistischen Grundkenntnissen hatte ich mir mit Hilfe eines Freiburger Jesuiten verschafft. Das war Gustav Wetter, der in zwei Bänden den Dialektischen Materialismus so sorgfältig präpariert hatte wie ein Kannibale den Säugling, den er verspeisen möchte. Er durfte das, mitten im Kalten Krieg, und vieles, was bei dieser Vivisektion zum Vorschein kam, hat mir eingeleuchtet. Aber was mir fehlte, und was Bücher nicht leisten können, war die Autopsie. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wie es auf der anderen Seite zuging, und zwar nicht nur in den Satellitenprovinzen, sondern in Rußland, das seit langem nur noch hieß: CCCP, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
11So kam es also, daß ich an einem Nachmittag im August – ich weiß noch, daß es ein Samstag war – mit einer russischen Maschine in Leningrad gelandet bin. Dort waren Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Angus Wilson, William Golding, Giuseppe Ungaretti und Hans Werner Richter angereist, und auf der östlichen Seite traten Michail Scholochow, Ilja Ehrenburg, Konstantin Fedin, Alexander Twardowski, Jewgeni Jewtuschenko, Jerzy Putrament aus Polen und Tibor Déry aus Ungarn auf. Auch aus der DDR hatte sich jemand eingefunden, ein gewisser Hans Koch, von dem nur zu hören war, daß er dem ostdeutschen Schriftstellerverband als Sekretär diente. Ingeborg Bachmann, die eingeladen war, hatte in letzter Minute abgesagt, und Uwe Johnson wollten die ostdeutschen und die russischen Offiziellen auf keinen Fall dabeihaben.
Dennoch brauchte man wohl den einen oder anderen Deutschen aus der Bundesrepublik; denn die Außenwelt hatte unsere politische Quarantäne allmählich aufgehoben. Aber welchen Deutschen? Max Frisch wäre besser gewesen, aber er war Schweizer. Doch gab es da nicht den wohlbekannten Hans Werner Richter? Die Saga von der Gruppe 47 hatte sich bis nach Moskau herumgesprochen. Das offizielle Debattenthema war unverfänglich: »Probleme des zeitgenössischen Romans«. Aber warum ich, der nie einen Roman geschrieben hatte? Zu meinen Gunsten fiel, glaube ich, vor allem mein Geburtsdatum ins Gewicht. Man konnte sicher sein, daß mit keinen unangenehmen Details aus der Nazizeit zu rechnen war; außerdem galt ich in einem vagen Sinn als »links«, was immer das bedeuten mochte.
12Ich war nie zuvor in Rußland gewesen. Mit den Sitten und Gebräuchen, die dort herrschten, war ich nicht vertraut. Da der sowjetische Schriftstellerverband die Regie übernommen hatte, galten wir als Delegation, um nicht zu sagen als Staatsgäste. Untergebracht wurden wir im besten Hotel der Stadt, der Europejska, gleich am Newski-Prospekt. Im Foyer lagen echte Teppiche aus dem Kaukasus, aus Buchara und aus Persien. Riesige Wannen auf gußeisernen Löwenfüßen standen in den überheizten Badezimmern. Es gab auch einen Wintergarten mit Palmen. Mit seiner etwas abgeschabten Pracht, seinen Kronleuchtern und schweren Schreibtischen stand das große Haus längst nicht mehr Herren wie Turgenjew und Tschaikowski oder später einem Gorki oder einem Majakowski zur Verfügung, sondern einer neuen Klasse von Gästen.
Ein kleiner Kiosk bot Zeitungen in vielerlei Sprachen feil, aber ich mußte mich mit dem Neuen Deutschland, der Unità und der Humanité begnügen. Von anderen Blättern konnte ich nicht einmal den Titel entziffern. War das Mongolisch, Armenisch oder Tadschikisch? Da hielte ich mich lieber an die Prawda, denn selbst mein miserables Russisch reichte aus, um die Schlagzeilen zu verstehen, weil dort stets zu erraten war, was sie verkündeten: Erfolgsmeldungen aus der Produktion und schlechte Nachrichten aus der kapitalistischen Welt. Auf kein Verständnis stieß mein Verlangen nach einem Stadtplan. Überhaupt schien sich niemand für Landkarten zu interessieren. Schon die Frage nach ihnen rief Erstaunen hervor. Nur Spione trachten nach derartigen Staatsgeheimnissen.
Dafür standen für unsere »Delegation«, die nur aus ihrem Leiter Hans Werner Richter und mir bestand, gleich zwei Begleiter bereit, die sich bald als unverdiente Glücksfälle er13wiesen. Zwar dienen solche Bärenführer vor allem als Dolmetscher, um stammelnden Ausländern auszuhelfen, aber sie haben auch noch andere Aufgaben; sie müssen nicht nur den Gast, sondern auch den Staat vor Ungelegenheiten schützen. Höhere Stellen erwarten von ihnen Berichte darüber, wie sich der Fremde benimmt und was er denkt. Lew Ginzburg war der eine, ein Gemütsmensch, hochqualifizierter Germanist und Übersetzer, der wohl nur aushilfsweise mit dieser Aufgabe betraut war. Auch dem anderen, Konstantin Bogatyrjow, so hieß er, schien wenig an offiziellen Pflichten zu liegen; ideologische Phrasen verscheuchte er wie lästige Fliegen. Ja, er äußerte sich schon bald derart abschätzig über die herrschende Partei und ihre Führung, daß ich überlegte, ob man nicht einen Provokateur auf uns angesetzt hatte. Bei der Allgegenwart der Überwachung lag dieser Gedanke nahe. Aber bald sah ich ein, daß mein Argwohn fehl am Platz war.
Kostja, wie er sich nannte, war ein schmächtiger, beinah unterernährter Mann von dreißig oder fünfunddreißig Jahren, dem man ansah, daß er schwere Jahre überlebt hatte. Er kannte den Apparat in- und auswendig und wußte, mit welchen Abstrafungen und mit welchen Privilegien man hier zu rechnen hatte, welche Läden es für die Bevorzugten gab und auf welche Abstufungen es dabei ankam. Als ich ihn fragte, woher sein beschädigtes Gebiß käme, sagte er kaltblütig, das sei ein Souvenir aus der Lagerhaft. Nach und nach erzählte er mir, als wäre das nichts Besonderes, von den Sträflingen, unter denen er dort, weit hinter dem Ural, ein paar Jahre zugebracht hatte. Mit Dentisten kannte er sich seitdem aus. Das erwies sich als hilfreich, weil Hans Werner über Nacht von Zahnschmerzen heimgesucht wurde, die ihn zwei Tage lang außer Gefecht setzten.
14Kostjas wahre Leidenschaft galt nie der Politik, sondern der Poesie. Vielleicht war sie ihm zum Verhängnis geworden, vielleicht hatte er verbotene Verse abgeschrieben und weitergegeben; dafür sprach, daß er Gedichte von Ossip Mandelstam auswendig zitieren konnte, ebenso wie Rilkes Duineser Elegien – und die sogar auf deutsch.
So etwas hat es in der russischen Intelligenzija immer gegeben. Kostja verkörperte das Ethos von Menschen, denen die Dichtung über alles ging, ein Kult, der bei uns schon lange nicht mehr existiert.
Soviel wußte sogar ich, daß Sankt Petersburg, Petro- oder Leningrad, diese vernachlässigte Schönheit, an jeder zweiten Straßenecke von literarischen Geistern heimgesucht wird. Doch von Puschkin, Gogol, Dostojewski, von den Serapionsbrüdern, von Dichtern wie Chlebnikow und Charms war nicht die Rede in den Debatten, die der Kongreß auf die Tagesordnung gesetzt hatte.
Konstantin Fedin, ein einflußreicher Mann, Vorsitzender des beinahe allmächtigen Autorenverbandes, schimpfte auf Joyce, Proust und Kafka, die Franzosen verteidigten den nouveau roman, und die Funktionäre priesen den sozialistischen Realismus. Das war alles recht langweilig. Nur Ilja Ehrenburg, der zwar nicht nominell, aber geistig wie der Chef der sowjetischen Delegierten auftrat, brachte ein wenig Leben in die Bude. Kein Wunder, denn er war schon 1954 mit seiner Erzählung Tauwetter zum Taufpaten einer ersten, schüchternen Periode der Kritik am Stalinismus geworden. Den Veteranen des Verbandes ging er damit ziemlich auf die Nerven. »Unsere Schriftsteller«, sagte er, »schreiben nicht deshalb schlechte Romane, weil sie für den Sozialismus eintreten, sondern weil der liebe Gott sie nicht mit Talenten gesegnet 15hat. Weit und breit ist in der Sowjetunion kein Tolstoi, kein Dostojewski, kein Tschechow in Sicht. Aber untalentierte Autoren haben wir genug.« Zwar müsse es Schriftsteller geben, die Millionen ansprächen, aber auch andere brauche die russische Literatur, die nur für fünftausend Leser schrieben. Er persönlich könne zwar mit dem nouveau roman, der hier hoch gelobt werde, nichts anfangen. Doch das Recht auf Experimente sollten wir alle respektieren. Das war der Höhepunkt der Auseinandersetzung.
Niemand kam auf seine Argumente zurück, auch er nicht. Wie ein Weltmann zog er es vor, sich mit Hans Werner Richter über Deutschland zu unterhalten; sogar für mich nahm er sich Zeit, obwohl ich in Rußland ein gänzlich Unbekannter war.
Aber ein Kongreß ist schließlich nur ein Kongreß. Deshalb unternahmen wir, Kostja und ich, wo es nur anging, den einen oder anderen Fluchtversuch. Die Zeit dafür war knapp bemessen. Wir sahen uns den Panzerkreuzer Aurora an, der schon 1904/05 im Russisch-Japanischen Krieg gedient hatte. Die rote Flagge hing müde vom Mast. Das Schiff kam mir ziemlich klein und schrottreif vor. Dann noch ein kurzer Blick auf den Winterpalast, den Ort, vor dem es im November 1917 zum Aufstand oder meinetwegen zum Putsch der Bolschewiki gekommen war, und auf die goldene Nadel der Admiralität. Mehr war uns nicht vergönnt.
Es muß aber irgendwann, vielleicht am zweiten Tag, ein großes Bankett gegeben haben. Ich erinnere mich, daß ich neben einem Riesen saß, der die prachtvolle Uniform eines Admirals der Roten Flotte und einen großen Ring mit einer weißen Kamee trug. Auf meine Frage erklärte er mit dröhnendem Lachen, daß sie ein Porträt des Zaren darstelle; 16Nikolaus II. sei es, den er verehre. Inzwischen hatte das Essen mit zahlreichen Trinksprüchen begonnen. Ohne bis an den Rand gefüllte Wodkagläser ging es dabei nicht ab. Sartre, der den Ehrenplatz einnahm, schien dem Kampf mit dem Alkohol nicht gewachsen. Mitten in der ausgedehnten Speisenfolge mußte er sich geschlagen geben. Ein diskreter Leibwächter brachte ihn in Sicherheit. Später hieß es, ein Notarzt sei gerufen worden, aber man muß nicht alles glauben, was einem auf dem Korridor zugeflüstert wird.
Am letzten Abend ging es lockerer zu. Dafür hat, glaube ich, Jewgeni Jewtuschenko gesorgt, der, drei Jahre jünger als ich, ganz genau wußte, wo in den Leningrader Nächten etwas zu erleben war. Der Ort, zu dem er uns schleppte, war eine aufgegebene Fabriketage, eine Art Loft. Dort gab es eine Band, die nicht nur Dreher und Swing-Melodien aufspielte, sondern sich auch auf die neueste Mode aus dem Westen verstand. Die stiljagi stellten stolz ihre Lederjacken und ihre echten oder gefälschten Blue jeans zur Schau. Während die Älteren sich still, aber nachdrücklich besoffen, gab sich die Jugendszene bis in die Morgenstunden dem Twist hin. Erst später habe ich begriffen, wie diese Buben sich auf dem laufenden hielten: Es waren Sender wie Radio Liberation oder der Russian Service der BBC, denen sie ihre Kenntnis der Songs von Elvis Presley und der Beatles verdankten. Sie wußten ganz genau, wie man auf dem Kurzwellenband die sowjetischen Störsender austricksen konnte.
Am folgenden Abend ging es dann mit dem berühmten Roten Pfeil nach Moskau. Dieser Schlafwagenzug verdankte seinen Ruf nicht zuletzt heimatlosen Liebespaaren, die in ihren beengten Wohnungen kaum Glückschancen fanden. Die 17Zweibettabteile waren nämlich, wegen der großen Spurweite, nicht nur komfortabel und gemütlich, sondern auch sturmfrei, weil sie ohne Rücksicht auf den Familienstand vergeben wurden. Daß die Reise zehn Stunden in Anspruch nahm, beklagte niemand.
Auch in Moskau wurden die »Delegierten«, die niemand delegiert hatte, sogleich an die Hand genommen. Untergebracht hatte man uns im Hotel Moskwa gleich am Roten Platz, dem Kreml gegenüber. Die Gäste betraten das kastenförmige Hochhaus durch eine riesige, schlecht beleuchtete Halle, in der ausladende Klubsessel herumstanden. In den Ecken des Saales hingen Lautsprecher, aus denen Tag und Nacht getragene Chöre zu hören waren. Ächzende, chronisch überlastete Aufzüge brachten die Hotelgäste in den neunten Stock, wo eine beleibte Wächterin über sie Buch führte und darauf achtete, daß niemand das falsche Zimmer betrat.
Zum Programm gehörte auch eine »Internationale Dichterlesung« in einem Gewerkschaftshaus. Sie verlief derart vielsprachig, daß das Publikum wenig verstand. Amüsanter war eine private Einladung Ilja Ehrenburgs. Seine Wohnung an der Gorki-Straße war so großzügig, daß ich mich an Empfänge bei Leuten aus der Park Avenue oder der Rue de Varenne erinnert fühlte. Kunst der klassischen Moderne schmückte die Wände: hier ein Matisse und dort ein Braque oder ein Vlaminck. Der Champagner wurde von Zofen mit weißen Häubchen, schwarzen Blusen und bestickten Spitzenschürzchen serviert. Canapés und Petits fours wurden herumgereicht. Der Versuch, längst vergangene bürgerliche Zeiten heraufzubeschwören, war dem Gastgeber täuschend echt gelungen. Ich fragte ihn auf französisch nach seiner bewegten Pariser Zeit, als er mit Picasso, Modigliani, Apollinaire auf 18dem Montparnasse und mit Diego de Rivera in der Rotonde zusammengesessen war, und nach seinen Abenteuern im Spanischen Bürgerkrieg. Er war ja ein Mann, der vieles überstanden hatte und immer auf die Füße gefallen war. Ich muß sagen, daß er mir sehr gefiel, besser als Konstantin Simonow, der auch unter den Gästen war. Er sah aus wie der Besitzer einer schwäbischen Maschinenfabrik, sehr selbstbewußt und sehr reserviert. Nebenbei erfuhr ich, daß er am Wochenende mit einer Privatmaschine auf sein Jagdrevier in Sibirien geflogen war. Dagegen wirkte Ehrenburg überlegen, denn er hatte interessante Hintergedanken und verfolgte ganz bestimmte politische Ziele.
Die Delegation hatte keine Chance, von Moskau mehr zu sehen als das Hotel, das Lenin-Mausoleum vor dem Kreml oder einen »Volkspark der Errungenschaften«; denn schon stand uns eine Schiffahrt auf der Moskwa bevor, die uns bis zur Mündung der Oka brachte und fast einen ganzen Tag lang dauerte. Wir mußten eine Art Schiffsbahnhof passieren, ein imposantes, mehrstöckiges Gebäude, das von einem leuchtenden Sowjetstern gekrönt war, um an die Landungsbrücke und zum Schiff zu gelangen. Es war sehr warm. Weil ich keine Landkarte besaß, verstand ich nicht, wohin es ging. Offenbar war von hier aus die Hauptstadt mit weitentfernten Meeren verbunden; denn nicht nur Ausflugsdampfer ankerten am Kai, sondern auch Frachter, die ihre Ladung an die Ostsee oder ans Kaspische Meer brachten. Das komplizierte Kanalsystem der Moskwa und der Wolga führte uns durch große Stauseen und gewaltige, mit Säulen geschmückte Schleusen, die sich wie von Geisterhand automatisch öffneten und schlossen. Auf dem Deck saß man unter weißen Sonnensegeln und ließ es sich gutgehen. Nicht nur der georgische 19Wein, auch der Wodka floß in Strömen. Ich staunte darüber, wie tapfer Hans Werner am Tisch der russischen Dichter mithielt.
Indessen hatte sich die eigentliche Sensation des Tages rasch herumgesprochen. Nikita Chruschtschow, der Gebieter des Riesenlandes, hatte den Wunsch geäußert, mit den Schriftstellern zu sprechen, die hier versammelt waren, möglicherweise sogar in seinem eigenen Haus. Sogleich wurde darüber getuschelt, wer wohl mit von der Partie sein würde.
Wie immer war ich nicht trinkfest genug, und mein Russisch war zu hinfällig, als daß ich mich an diesen Spekulationen hätte beteiligen können. Ich stand an der Reling, als mich ein etwa vierzigjähriger Mann auf englisch ansprach. Er schien sich dafür zu interessieren, wie ich als Außenseiter und Neuling die politische Situation im Lande sah. Ich erwähnte das berühmte Tauwetter und meinte, daß es damit seit Jahren nach dem Motto Stop and go zuginge. Der Chef habe sich vorgenommen, das Reich aus seiner Erstarrung zu lösen, seine Fixierungen aufzubrechen, aber das gehe gewissermaßen peristaltisch zu, in einzelnen Schüben, von einem schwerverdaulichen Bissen zum andern. Deshalb wisse niemand genau, wo das enden werde. Das führe zu einem Wechselbad von Hoffnung und Angst, nicht nur bei der Intelligenzija, sondern vermutlich auch bei allen anderen. Er hörte mir zu, amüsiert, wie es schien, und bemerkte, das sei gar nicht so falsch.
Später flüsterte mir der treue Kostja zu, mein Gesprächspartner sei Alexei Adschubei gewesen. Ahnungslos wie ich war, sagte mir dieser Name nichts. Ich war ziemlich erschrocken, als ich erfuhr, daß ich mit dem Schwiegersohn Chruschtschows und dem Herausgeber der Regierungszeitung Iswestija so offen geredet hatte.
20Auf dem Programm stand dann auch noch ein Tagesausflug im Bus zu einer heiligen Stätte: dem Haus Tolstois in Jasnaja Poljana, bloße zweihundert Kilometer südlich von Moskau, und das heißt, nach russischen Maßstäben, ganz in der Nähe. Alles sieht dort genauso aus, als hätte der Hausherr sein Arbeitszimmer eben verlassen. Die Hausschuhe stehen bereit, das Tintenfaß auf dem Schreibtisch ist gefüllt. Ich sah dort eine Zeitung aus dem Jahr 1910 und ein paar Briefe liegen, die der Adressat vermutlich nicht mehr gelesen hatte. Man bewegt sich in diesem sorgfältig restaurierten Museum wie auf einer Zeitreise. Die Inszenierung ist so perfekt, daß man sich die Wahrheit kaum einzugestehen wagt: denn natürlich hat man es mit einer rührenden Fälschung zu tun.
Am 13. August war es dann soweit. Unter den geladenen Schriftstellern fand auch ich mich frühmorgens am Flughafen ein, um mit einer Sondermaschine nach Sotschi zu reisen. Wer auf der geheimnisvollen Gästeliste stand, war nun klar. Neben den Matadoren Scholochow, Twardowski und Fedin, Sartre, Beauvoir und Ungaretti war der unvermeidliche Anstifter Vigorelli dabei. Aus dem Inland gab es zwar ein paar verdiente Skribenten aus dem Großen Vaterländischen Krieg, aber ansonsten waren die namhaften Schriftsteller eher dünn gesät; dafür gab es allerhand Vorsitzende und Funktionäre von Verbänden aus Rußland, Bulgarien und Rumänien. Wer fehlte und warum? Wo waren Ehrenburg und Jewtuschenko geblieben? Ich zuckte zusammen, als ich Alexei Adschubei wiedersah, den Schwiegersohn, mit dem ich mich auf der Flußfahrt so unvorsichtig unterhalten hatte. Und was war aus Hans Werner Richter geworden? Warum war er verschwunden? Ich fürchtete, daß er sich einbildete, ich hätte die Hand 21im Spiel gehabt. Aber nichts lag mir ferner; denn ich hätte mich gern hinter ihm versteckt.
Dann fuhren wir nach Gagra, zu Chruschtschows Villa. Ich habe mir notiert, was sich dort am 13. und 14. August 1963 abspielte.
Der Hausherr kommt aus der Tür, langsam, mit kleinen Schritten, mit den Armen rudernd, ein alter Mann, dem sein Leib bereits zu schaffen macht. Seine Ruhe drückt eher Geduld als Vorfreude aus. Kaum bleibt er stehen, folgt ein Zeremoniell von Vorstellungen, Händedrücken, Umarmungen, das ein wenig wie ein Amateurtheater wirkt. Die Regie ist improvisiert, das Lächeln frei von Routine. Die Gesten haben etwas Unbeholfenes. Fremd sind die Namen und die Sprachen der Gäste, noch fremder ist ihr Habitus. Es sind Intellektuelle, Leute voller Hintergedanken. Ironie ist ihnen zuzutrauen. Der Respekt, den sie an den Tag legen, verbirgt Reserve, Hochmut, vielleicht Feindseligkeit. Der Besuch ist lästig. Das sind Plagegeister.
Er begegnet ihnen nicht ohne Würde. Die bäurische Eleganz beschränkt sich nicht auf das bestickte Hemd. Sie hilft über manches hinweg. Dem heimlichen Spott ist beizukommen, indem man ihn listig übersieht. Auch Haus, Park und Umgebung sind eine Hilfe. Diese Weltleute betrachten alles mit raschen Seitenblicken, nicken der modernen Architektur zu, blicken neidisch auf die duftenden Bäume und auf den weiten, menschenleeren Strand. Ein kleiner Stolz kommt im Hausherrn auf. Er führt die Glaswand vor, die sich, von einem verborgenen Motor getrieben, entfaltet.
Er kommt fast ohne Leibwächter aus. Die Besucher werden nicht durchsucht. Dieser Mut ist sympathisch, weil er kein 22Aufhebens macht. Die Räume sind zu groß für den Mann, der sie bewohnt. Der Instinkt für den Reichtum fehlt ihm. Kleine Gegenstände, die kein Architekt vorgesehen hatte, fallen aus dem Rahmen: eine kleine schäbige Wanduhr, ein deplazierter rosa Aschbecher. Auch ist das Haus zu gut aufgeräumt; es würde den Bewohner nicht vermissen und böte sich jedem Nachfolger an. Der Gastgeber hat keine besonderen Wünsche geäußert, das Holz nicht selbst ausgesucht. Die Möbel sind aus der teuersten Serie der Kombinate. Man findet sie in den Hotelhallen der Hauptstadt wieder, in den gleichen Farben.
In einem kleinen Konferenzsaal wird Platz genommen. Der Gastgeber gibt kein Programm vor, er hat sich nicht eigens präpariert. Stühle werden gerückt. Ein paar Sekunden der Ratlosigkeit, dann nehmen die Gäste das Wort. Sie sind nicht sicherer als ihr Zuhörer. Man hat sie gewarnt, hat ihnen unter vier Augen angedeutet, daß man es nicht mit einem gebildeten Gesprächspartner zu tun habe. Darauf möge man sich einstellen: keine Fremdwörter, einfache Redeweise, Vorsicht wegen der Reizbarkeit des großen kleinwüchsigen Mannes.
Je drei Minuten sprechen allerlei Vorsitzende. Ihr Dank, ihre rühmenden Worte, ihre Beteuerungen sind eine Spur zu blumig, zu rückhaltlos. Der Adressat glaubt ihnen nicht. Er hat ein genaues Gehör. Sartre geht mit seinen dreißig Worten kein Risiko ein, er verhält sich abwartend, um nicht zu sagen lammfromm, ganz im Gegensatz zu seiner Haltung in Frankreich, wo er der Macht gegenüber gerne gefahrlose Mutproben ablegt. Der einzige, der eine Spur von Courage zeigt, ist der Pole Jerzy Putrament. Er verlangt mehr Bewegungsspielraum für die sowjetischen Autoren.
23Schon bei dieser Szene habe ich den Eindruck, daß der Gastgeber den Gästen überlegen ist. Hatten nicht schon im Autobus die meisten, seltsam erregt, an ihren Krawatten gerückt, Hemden gewechselt, protokollarische Details hin und her gewendet? Der Hausherr hat nichts dergleichen nötig. Er ist sich über seinen Vorteil im klaren.
Das zeigt sich, sobald die versöhnlichen Sonntagsreden der Schriftsteller zu Ende sind. Wieder ein Moment der Unschlüssigkeit. Dann erhebt sich der Erste Sekretär des Zentralkomitees zögernd und setzt zum Sprechen an. Dolmetscher rücken mit den Stühlen. Er wolle nur ein paar Worte sagen, meint er fast entschuldigend. Er wirkt zunächst unsicher. Ich stelle mir vor, daß er mit seinen eigenen Leuten ganz anders umgeht, daß man dort mehr trinkt und sich auch einmal anbrüllt.
Es folgt eine Rede von fünfzig Minuten, die jeden logischen, diskursiven Zusammenhang vermissen läßt. Er fängt ruhig, etwas stockend an, gerät in Eifer, schleppt Beispiele und Anekdoten herbei, spricht schneller, langt bei einer unvorhergesehenen Wendung an und hält dann plötzlich inne. Er scheint selber überrascht über das, was er gesagt hat. Er möchte es nicht zurücknehmen, will es aber auch keineswegs einfach so stehenlassen. Er weiß noch nicht weiter, aber es wird ihm schon etwas einfallen. Nur Geduld! Geduld hat er. Er wartet, verschränkt die Hände. Nervös sind die anderen; sie fürchten, der Redner sei steckengeblieben. Dreißig Sekunden. Dann ist ein neuer Satz da. Er kommt aus dem Blauen, setzt an einem Punkt an, an den niemand gedacht hatte. Der Zusammenhang ist erst hinterher zu erraten oder gar nicht, die Assoziationen schlagen Haken. Entwaffnende, bodenlose Naivität? Nur bei den dümmeren Zuhörern macht sich ein 24Gefühl breit, als wüßten sie es besser. Sie irren, denn kaum eine der scheinbar so schlichten Äußerungen ist abwegig; fast immer ist etwas Richtiges, zuweilen sogar Hintergründiges daran. Chruschtschows Rede reißt nicht mit; was an ihr zu denken gibt, sind sein common sense und seine Schlauheit, seine Courage und seine Witterung für das Mögliche. Sprachlich neigt er zur Reduktion des Unbekannten auf das Bekannte. Gleichmäßige Stimme, kleiner Wortschatz, minimale Syntax. Rhetorische Ansätze bleiben in der Kehle stecken und wirken unglaubwürdig, was der Redner sofort bemerkt. Auch seine Empörung wirkt nicht frisch, sie äußert sich, als käme sie ihm zum hundertsten Mal in den Sinn. Er sieht nicht ein, warum es nötig sein sollte, so klare Dinge immer aufs neue zu wiederholen. Seine Einsichten sind nicht zahlreich, aber er ist sich ihrer sicher. Zweifel kommen selten auf, aber gerade deshalb sind sie für den Zweifler bedrohlich.
Das tritt zutage, als der Gastgeber scheinbar unmotiviert auf Ungarn zu sprechen kommt. Niemand vor ihm hat den ungarischen Aufstand von 1956 erwähnt. Aber immerhin sitzt Sartre am Tisch, der den Begrüßungsansprachen der anderen nichts hinzugefügt hat als einen knappen, nichtssagenden Satz. Was wir nun zu hören bekommen, ist der Versuch einer Rechtfertigung. Sie wird breit und ungeschickt vorgetragen. »Wenn unser Eingreifen ein Fehler war, so bin ich der Hauptschuldige. Aber heute, sieben Jahre später, kann jeder sehen: Es war kein Fehler.«
Er packt den Stier bei den Hörnern, macht Differenzen sichtbar, statt sie zu überspielen. Ich habe den Eindruck, daß er den Gästen ihre Vorsicht, ihren Anpassungseifer übelnimmt. Gewiß, die Anwesenden wollen etwas von ihm, Spielraum für die sowjetischen Autoren, Auslandsreisen, Ausstel25lungen, Publikationsmöglichkeiten. Und vielleicht will auch er etwas von uns: publizistische Unterstützung für seine Definition der friedlichen Koexistenz und für seine Abrüstungsinitiativen. Dennoch zögert er nicht, uns mit dem finstersten Kapitel seiner Herrschaft zu konfrontieren. Die Wunde Ungarn hat sich nicht geschlossen. Er zieht ans Licht, worüber kein Gras wachsen will. Nicht allein uns, sondern sich selber sucht er zu überzeugen. Er macht nicht, wie Vigorelli, Ungaretti und Surkow, »gut Wetter«. Das heißt wohl, daß er mehr Achtung vor uns hat als wir vor ihm.
Im übrigen ist diese Passage die einzige, der man seine innere Beteiligung anmerkt. Nach einer Pause überläßt er sich wieder seinen mäandernden Assoziationen, spricht über Gott und die Welt, beinahe wirr und geschwätzig. Später versichern mir ein paar höhere Chargen, daß ihnen seine Redseligkeit große Sorgen bereitet. Der Chef sei unfähig, ein Geheimnis für sich zu behalten, besonders wenn es um wirkliche oder vermeintliche Erfolge gehe.
Stichworte aus dem Gesagten: »Wir haben die Diktatur des Proletariats abgeschafft. Nach fünfundvierzig Jahren haben wir sie nicht mehr nötig. Die Sowjetunion ist ein Volksstaat. Wir sind heute schon eine Demokratie. Nur wer Angst hat, braucht eine Diktatur.« Er verteidigt die Prosperität gegen die Argumente der Chinesen. »Je reicher ihr werdet, desto bürgerlicher denkt ihr, hat mir einer ihrer Delegierten gesagt. Aber wenn ein Mann sich eine zweite Hose anschafft, wird er dadurch ein schlechterer Marxist? Ich habe ihn gefragt, ob er meint, die besten Kommunisten liefen ohne Hosen herum.« Manchmal bramarbasiert er, pocht auf die Kräfte seines Landes. »Nicht weil die Kapitalisten klüger, sondern weil wir stärker geworden sind, ist das Moskauer Abkommen über das 26Ende der Atomwaffenversuche zustande gekommen. Ohne die karibische Krise hätten wir heute vielleicht keinen Vertrag in der Tasche.« Er spricht von weiterreichenden Abmachungen, mit denen Dean Rusk, der amerikanische Außenminister, gekommen sei, Angeboten, die über das öffentlich Erörterte weit hinausgingen. (In Moskau kursieren Gerüchte, denen zufolge die Vereinigten Staaten dem Ostblock eine umfassende Hilfe im Geist des Marshall-Plans in Aussicht gestellt hätten.)
Dazwischen immer wieder Belehrungen über die Übel des Kapitalismus. Wie er einem Mann wie Sartre den Sozialismus erklärt, ist schon entwaffnend. Er lese öfter in westlichen Zeitungen von Selbstmorden. Das sei doch keine Privatsache! »In unserem Land kommt so etwas sehr selten vor. Wir gehen jedem Fall auf den Grund, wir fahnden nach den Schuldigen und versuchen, die Verhältnisse zu bessern.« Sartre hört sich solche Analysen mit steinerner Miene an.
Bezeichnend ist die einzige literarische Reminiszenz in Chruschtschows Rede. Er erinnert sich einer Geschichte, die er 1910 oder 1911 in einer liberalen Zeitschrift gelesen hat. Den Namen des Verfassers habe er vergessen. (Er könnte Christoph von Schmid heißen.) Ein Gutsbesitzer wird auf der Straße von einem Bettler angesprochen und um eine Kopeke gebeten. Er sucht in seinen Taschen, findet aber nur ein Zwanzig-Kopeken-Stück, das er dem Armen zusteckt. Dieser, außer sich vor Freude, bedankt sich kniefällig. »Wie wenig«, so der Gutsbesitzer, »braucht dieser Mensch, um glücklich zu sein! Bei mir dagegen bräuchte es wenigstens zwanzigtausend Rubel, um mich in eine derartige Hochstimmung zu versetzen.« Der Redner zeigt sich heute noch entrüstet über den Unterschied zwischen den Protagonisten dieser Ge27schichte, die ihm so bedeutsam vorkommt, daß er sie zitiert. Oder er fragt, für wen der Arbeiter im Kapitalismus arbeite. Ein Beispiel könne das lehren. Ein Mann verdinge sich zum Bau einer Mauer, aber er habe kein Recht, zu erfahren, wozu sie diene. Am Ende ist es vielleicht eine Gefängnismauer, hinter der er selber eines Tages sitzen wird … Die erbauliche Wirkung dieser Parabel will sich nicht einstellen, und zu spät erkennt der Redner, daß von Mauern zu reden angesichts des Berliner »Schutzwalls« nicht ohne Risiko ist.
Am wohlsten fühlt er sich mit Fabeln aus dem Bilderbuch. Zum Thema des Personenkults fällt ihm der Elefant ein. Wenn der in seiner Kindheit das Dorf besuchte, wollte ihn jeder sehen. So viele Leute wären herbeigelaufen und hätten sich um ihn geschart, daß er als kleiner Junge das Tier am Ende gar nicht zu Gesicht bekommen habe. So ähnlich verhalte es sich auch mit dem Personenkult. Bei Stalins Begräbnis seien auf dem Roten Platz 106 Menschen ums Leben gekommen. Seine eigene Tochter habe sich nur retten können, indem sie unter ein Auto gekrochen sei. Heute dagegen, da stoße einer den andern an, wenn er durch Moskau gehe, und sage: Schau, da kommt gerade Chruschtschow vorbei! Der andere erwidere achselzuckend: Den kenne ich schon. Manchmal habe er sogar einen ausspucken sehen.
Was ihn aber stört und ärgert, sind ganz einfache Dinge. Zum Beispiel das Privatvermögen Kennedys. Warum stimmen die Arbeiter für einen derart reichen Mann? Er überlegt einen Augenblick lang. Dann kommt ihm eine Erleuchtung: Die Kapitalisten gewinnen die Wahlen, weil ihr ihnen helft. Das sagt er zu den Gästen gewandt. Einige unter den Schriftstellern zucken zusammen, andere sind verblüfft. Doch der Redner beruhigt sie sogleich, indem er hinzufügt, die An28wesenden seien selbstverständlich nicht gemeint. Aber die Verantwortung, die sie trügen, wiege doch schwer. Das war übrigens der einzige Passus, der sich auf die Arbeit der Gäste bezog; über Literatur und Ästhetik verlor er, zu meiner Erleichterung, kein einziges Wort.
Vielleicht überschätzt er den Einfluß der schreibenden Zunft. Vielleicht denkt er auch daran, wie verführbar und wie bestechlich sie sein kann, obwohl das dem Sowjetstaat oft ganz gelegen war. Aber was er sagt, unterläuft auch traditionelle marxistische Thesen und läuft letzten Endes auf die Umkehrung des Satzes hinaus, daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimmt. Wenn seine Behauptung in der Prawda erschiene, wäre das eine kleine Sensation. Hier klingt sie nur wie die Anerkennung einer politischen Realität, ausgesprochen von einem Mann, der vom Marxismus nur im Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU (B) gehört hat.
Dann hört die Rede einfach auf, weil der Sprecher das Gefühl hat, nun sei es genug, unbekümmert um einen Schlußeffekt, der durch ein paar mühelos angeklebte Phrasen über Frieden, Zukunft und Fortschritt leicht zu erzielen wäre. Der Beifall ist höflich, aber spärlich. Man erhebt sich und geht spazieren.
Es ist sehr heiß, die Gäste leiden unter ihren dunklen Anzügen. Der Hausherr lädt zu einem Bad ein. Er möchte selbst ins Wasser steigen. Die Besucher sind ohne Badeanzüge angereist. Protokollarische Bestürzung, Ratlosigkeit, auch Unlust. Kann man nackt baden, wie das Staatsoberhaupt es anheimstellt, noch dazu vor den Augen der Verfasserin des Anderen Geschlechts? Lieber läßt man sich auf den Stufen nieder, vorsichtig plaudernd, während der Gastgeber in einer der beiden Strandhütten verschwindet. Nur Vigorelli, ein unbekannter 29Autor und ich möchten baden. Wir richten uns in der zweiten Hütte ein und finden dort, für den Hausherrn bereitgelegt und ihm angemessen, drei Badehosen von eigentümlicher Schäbigkeit vor. Sie reichen uns bis ans Knie. Die meinige muß ich mit beiden Händen festhalten. Die zehn Minuten im Schwarzen Meer waren womöglich die einzig behaglichen des Tages, für den Gastgeber und für uns. Nur dem Leibwächter in seinem Kahn, stets bereit, seinen Gebieter zu retten, war die Sorge um unser Wohl anzumerken.
Das Abendessen, das zwei Stunden dauert, wird auf der Terrasse serviert. Zuvor dürfen wir das Wohnhaus besichtigen. Es erinnert an eine Filmdekoration aus Ufa-Zeiten: rosa Überzüge im Schlafzimmer, die Sessel im Café-Kranzler-Geschmack. Die wenigen Tischreden sind lustlos und platt, aber die Küche ist vorzüglich. Es wird fast nur Russisch gesprochen. Mein Tischnachbar, Konstantin Fedin, zeigt wenig Lust, dem Gastgeber, schräg gegenüber, zu übersetzen, was die Ausländer vorbringen. Nur small talk wird weitergereicht. Ich, der Jüngste an der Tafel, hätte ohnehin kaum etwas zu sagen.
Von Deutschland ist nur einmal die Rede, ganz am Rand: Von hier aus, sagt der Gastgeber unvermittelt, könne er nach Preußen sehen. Auf der anderen Seite der Bucht habe Ulbricht sein Sommerhaus. Das ist alles, von Politik kein Wort mehr.
Der Hausherr ißt und trinkt sehr wenig. Ich habe den Eindruck, daß er sich langweilt, doch bietet er aufmerksam und eifrig Getränke an, georgischen Wein und ein Mineralwasser, aus dem ein leichter Schwefelgeruch in die Nase steigt. Es ist wie eine Einladung beim Landrat. Wir sitzen da wie die Apotheker und Schulräte und schlucken, was es Gutes gibt. Die 30Zungen lockern sich nicht, keine Weinseligkeit, keine Scherze kommen auf. Der Gastgeber sieht plötzlich müde aus, die Augen sind halb geschlossen, nur ein kleines Mißtrauen ist noch wach, und hört mit halbem Ohr zu.
Nach dem Kaffee landet der russische Dichter Alexander Twardowski seinen großen, wohlvorbereiteten Coup. Er hatte eine lange Karriere hinter sich. Berühmt wurde er im Zweiten Weltkrieg mit einem Poem über den Soldaten Wassili Tjorkin, das nicht nur populär war, sondern auch mit einem Stalinpreis belohnt wurde. Unter Chruschtschow wurde ihm die Herausgeberschaft der Zeitschrift Novyi Mir anvertraut; damals sorgte er dafür, daß dort Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch erschien, das Werk eines völlig unbekannten Autors namens Alexander Solschenizyn.
Ein Schwergewicht also in dieser Runde.
Er liest eine Fortsetzung seines epischen Gedichts aus den vierziger Jahren vor: Die denkwürdigen Abenteuer des Soldaten Tjorkin im Jenseits. Unter der Herrschaft Stalins war an eine Veröffentlichung dieses Textes nicht zu denken, und selbst nach dem »Tauwetter« hielten es die Zensoren für zu riskant, ihn zu drucken. Sie schlugen ihm eine »Bearbeitung« vor, auf die der Verfasser lieber verzichtet hat.
Die Fassung, die er mitbrachte, zeigte, woran das lag. Denn der brave Soldat, der an Schweijk erinnert, trifft im Jenseits genau dieselben Verhältnisse an wie in der Sowjetunion. Vergebens sucht er nach einem Ort, wo er sich ausruhen kann. Als er sich beschweren will, heißt es, das sei zwecklos, weil hier alle zufrieden und glücklich lebten; dafür sorge schon die Geheimpolizei. Wer sich vorbildlich benehme, dem winke ein ganz besonderes Privileg: ein Urlaub in der bürgerlichen Hölle.
31Satirische Versepen dieser Art sind in der russischen Literatur ein traditionelles Genre. Sie erinnern im Strophenbau und in der Phrasierung an Heine. Auch die Wirkung ist ganz ähnlich. Ich konnte sie an meinem Gegenüber beobachten. »Lyrische« und witzige Strophen wechseln miteinander ab, und die Pointen sind zielsicher gesetzt.
Natürlich verstanden die Ausländer nicht, worum es ging. Aber der Herr des Hauses hörte genau zu und ließ sich die Vorlesung fünfzig Minuten lang gefallen. Zuweilen wirkte er bekümmert, einige Male schien er dem Unmut nah, die »poetischen Stellen« langweilten ihn, aber den Witzen konnte er nicht widerstehen, lachte ein paarmal schallend, schwieg nach dem Ende der Lesung ziemlich lange und sagte dann trocken: »Choroscho.«
Für die sowjetischen Schriftsteller war dies das entscheidende Resultat des Besuchs, ein sinnreich eingefädeltes, siegreiches Manöver. Der Abschied bot dasselbe Bild wie die Begrüßung: ungeschickte Umarmungen, geistesabwesende Händedrücke, heimliche Erleichterung auf beiden Seiten. Nur die als Schriftsteller getarnten Funktionäre aus den sozialistischen Ländern, darunter ein besonders wäßriger Mann aus Ostberlin, trugen weihevolle Mienen zur Schau.
Undeutlich an Chruschtschow bleibt nach dieser Begegnung nicht viel. Durch ein Plebiszit oder durch parlamentarische Wahlen wäre dieser Mann nie in den Besitz der Macht gelangt. Er ist unscheinbar. Das hat ihn vermutlich gerettet. Seine Stärke ist die eines Menschen, der zu überleben vorhat. So hat er den Stalinismus und die Machtkämpfe nach dem Tod des Georgiers überstanden. An seiner Umsicht und an seinem Stehvermögen ist nicht zu zweifeln. Er hat mehr Sinn dafür, Situationen zu meistern, als sie zu schaffen. Kein Mann 32großer Entwürfe, schwer zu überzeugen, theoretischen Argumenten unzugänglich, belehrbar allein durch trial and error.
Seine Vorzüge lassen sich am besten negativ bestimmen. Er ist ziemlich frei vom Größen- und Verfolgungswahn seiner Vorgänger. Seine Grundüberzeugungen sind so schlicht, daß sie sein Verhalten nicht programmieren, sondern umgekehrt: das Verhalten interpretiert sie von Fall zu Fall. In den Grenzen seiner Gemeinplätze ist er unsicher, also belehrbar. Von seiner größten politischen Leistung ahnt er nichts. Sie liegt in der Entzauberung der Macht. Ein Mann ohne Geheimnis an der Spitze des Staates: das ist in der Welt selten; in Rußland ist es unerhört. An »Ausstrahlung« fehlt es ihm ganz und gar. Ihm gegenüber stellt sich eher Langeweile ein, nie und nimmer jene Faszination, der ein Mann wie de Gaulle seine Wirkung verdankt. Den Personenkult dementiert er nicht allein ideologisch, was wenig zu bedeuten hätte, sondern durch seine Person. Wer sich davon enttäuscht zeigt, hat nicht verstanden, worum es geht. Jeder Napoleon, dem die Massen zujubeln, könnte im atomaren Zeitalter den kollektiven Selbstmord riskieren. Der Schuh, mit dem Chruschtschow in New York auf sein Rednerpult eingeschlagen haben soll, ist im Vergleich dazu harmlos. Am Tisch dieses Menschen mag man gähnen, aber man fühlt sich nicht bedroht.
Ein kurzer Flug brachte alle, die dabei waren, nach Moskau zurück. Niemand hatte Lust, zu kommentieren, was wir erlebt hatten. Die wichtigen ausländischen Gäste beeilten sich, ihre nächsten Anschlüsse nach Paris, Rom oder Warschau zu finden. Der treue Kostja holte mich vom Hotel ab und spendierte mir noch einen langen Abend mit ein paar unentwegten Freunden in seiner kleinen Wohnung an der ersten Aeroportowskaja, einem Haus, das wie ein Bienenstock die 33weniger prominenten Angehörigen der schreibenden Zunft beherbergte. Es gab zu viel Wodka, als daß ich mich daran erinnern könnte, worüber gesprochen, geklagt und gelacht wurde.
Am andern Vormittag, es war der 15. August, lehnte ich mich erleichtert zurück in meinen Sitzplatz in der SAS-Maschine nach Oslo. Mein erster Ausflug in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hatte sich gelohnt.