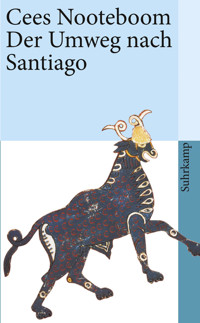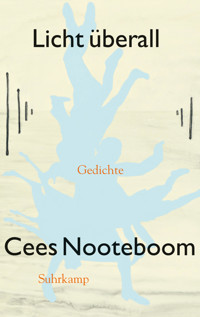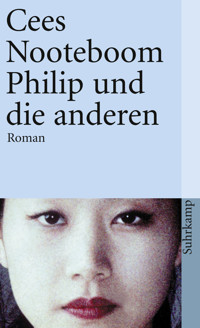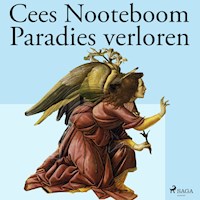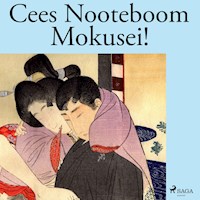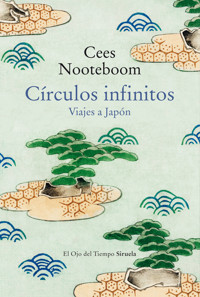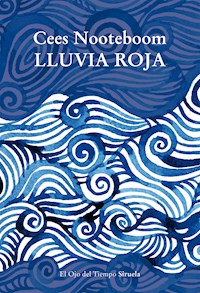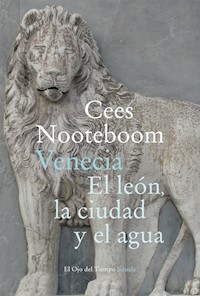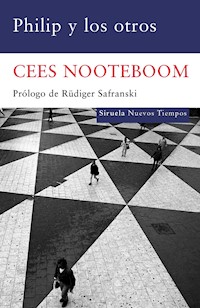13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das erste Mal, 1964, in Gesellschaft einer jungen Frau. Dann, 1982, mit dem Orientexpress. Erst beim zehnten Mal das Wagnis: eine Gondelfahrt. Und schließlich, 2018, kappt ein heftiger Sturm die einzige Landverbindung zwischen der Stadt und dem Rest der Welt und sorgt dafür, dass der Gast länger bleibt als geplant.
Cees Nootebooms Liebe zu Venedig dauert nun schon über 50 Jahre an. Viele Male hat er die Stadt besucht, wohnt in prachtvollen Hotels und düsteren Apartments, huldigt den Malern und Schriftstellern, die hier lebten und arbeiteten, beobachtet den drohenden Ausverkauf Venedigs ebenso wie das Verhalten der Bewohner und Besucher: klug und selbstironisch, fast zärtlich.
Der große niederländische Autor und Reisende Cees Nooteboom stellt sich die Frage: »Weshalb liebe ich diesen Ort mehr als andere Orte?« In seinen Texten aus drei Jahrzehnten gibt er die Antwort – und setzt Venedig, La Serenissima, ein Denkmal von ungeheurer Strahlkraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cees Nooteboom
Venedig
Der Löwe, die Stadt und das Wasser
Mit Fotografien von Simone Sassen
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Suhrkamp
Inhalt
Das erste Mal
Langsame Ankunft
Ein Traum von Macht und Geld
Das zerstückelte Labyrinth
Schaukel
Drei Miniaturen
Zwei Gedichte
Das verschwundene Abendmahl
Stimmen, Orgel, Regen
Fluide Stadt
Kafkas Hotel
Namen
Papst gegen Mönch. Eine venezianische Geschichte
Auf der Spur der Maler
Der Garten der Teresa
Giacomo und Teresa: Eine Geschichte aus zwei Welten
Spiel ohne Karten
Unter Löwen
Der Tod und Venedig
Der jüdische Friedhof
Postumer Alpinismus
Erzählte Bilder
Unvollendeter Abschied
Letzter Tag
Textnachweise
Bibliographie
Das erste Mal
Ein erstes Mal, immer gibt es ein erstes Mal. Wir schreiben das Jahr 1964, ein alter, klappriger Zug aus dem kommunistischen Jugoslawien, Endstation Venedig. Neben mir eine junge Frau, Amerikanerin. Die lange Reise ist uns anzusehen. Alles ist neu. Wir nehmen die Stadt so, wie sie sich uns zeigt. Erwartungen haben wir nicht, ausgenommen die mit dem Namen der Stadt verbundenen, und dann erfüllt sich alles. Im geheimen Gewebe des Gedächtnisses wird alles gespeichert. Der Zug, die Stadt, der Name der jungen Frau. Wir werden einander verlieren, werden unterschiedliche Leben führen, einander viel später auf der anderen Seite des Globus wiederfinden, vom eigenen Leben erzählen.
Mehr als vierzig Jahre später wird jener erste Tag aus dem Jahr 1964 in einer Erzählung landen, die den Titel Gondeln trägt. Die Stadt und alles, was in der Zwischenzeit verschwunden war, wird zur Kulisse für diese Geschichte.
1982, eine andere Stadt, ein anderer Zug. Eine Freundin hat mich zur Victoria Station gebracht, in London. Ich werde den Orientexpress nach Venedig nehmen.
Doch dieser Zug ist nicht da. Etwas ist defekt, wir fahren nicht unter dem Meer hindurch, sondern fliegen über Land. Zwei Tage später geht der Zug dann doch, von Paris aus, ein Nachtzug. Ich erinnere mich an die nächtlichen Bahnhöfe, Stimmen in der Dunkelheit, den zu Zügen gehörenden Rhythmus, die unsichtbaren Trommler, die irgendwo unter den Wagen hausen, Lautsprecher, die etwas verkünden in anderen Sprachen.
Im Zug habe ich die Leute erkannt, die in London mit mir auf dem leeren Bahnsteig standen, aber es sind keine Spione darunter, keine großen Lieben, niemand, der sich für einen Roman eignen würde. Die Notizen von dieser Reise stehen in einem anderen Buch, so dass ich sie nicht mehr mit herumtragen muss. Die rosa Schirmlampe aus dem Luxuszug, die in jenem Buch geblieben ist, habe ich zusammen mit den Leuten in Abendkleidung, den umfangreichen Speisekarten, dem Französisch der Kellner und ihren Uniformen schon vor Jahren weggeräumt, ebenso wie die himmelblaue Uniform des Mannes, der über unseren Zugteil waltete und inzwischen in den Kellern der Erinnerung umherirrt. Ich kann ihn jetzt auch nicht mehr bewahren, es ist zwar noch dasselbe Leben, aber ich habe andere Dinge zu tun, ich bin auf dem Weg, zum zweiten Mal. Diesmal werde ich die Wasserstadt mit niemandem teilen. Es ist 1982 in meinem jetzigen Damals, die Gegenwart meiner Sätze ist in eine fortwährende Wiederholung eingebettet, von jetzt an werde ich hier ankommen und zurückkehren, die Stadt wird mich anziehen und von sich stoßen, ich werde an immer wieder neuen Adressen wohnen, werde weiterhin darüber schreiben und lesen, die Stadt wird zu einem Teil meines Lebens werden, wie ich nie ein Teil ihres Lebens sein werde, wie ein Staubkorn werde ich durch ihre Geschichte flirren, sie wird mich fressen, wie sie alle ihre Geliebten und Bewunderer stets verschlungen hat, die im Laufe der Jahrhunderte zu ihren Füßen gelegen haben, als wären sie selbst, unsichtbar, zu Marmor geworden, ein Teil der Luft, des Wassers oder des Bürgersteigs, etwas, über das man geht, den Blick auf den immerwährenden Glanz von Palästen und Kirchen gerichtet, für kurze Zeit Schicksalsgefährte in der Geschichte vom Löwen, der Stadt und dem Wasser.
Langsame Ankunft
Im Jetzt von damals ist es neblig in der Po-Ebene. Ich habe keine Lust zu lesen und sehe mir die mobilen Gemälde draußen an: eine uneigentliche Palme, einen kahlgestutzten Apfelsinenbaum, in dem die albern wirkenden Früchte wie ein Vorwurf hängen – nur: an wen? Trauerweiden entlang einem verschmutzten braunen Fluss, beschnittene Zypressen, ein Friedhof mit riesigen Grabhäusern, als wohnten prahlerische Tote darin, eine Wäscheleine mit rosafarbenen Laken, ein umgefallenes Schiff mit verrottendem Kiel, und dann fahre ich über Wasser, die weißliche, spiegelnde, umnebelte Fläche der Lagune. Ich drücke den Kopf an die kalte Scheibe und sehe in der Ferne die graue Andeutung von etwas, das eine Stadt sein soll und jetzt erst als Steigerung des Nichts sichtbar ist, Venedig.
Bereits in der Bahnhofshalle ist der Zug von mir abgefallen, braun und lackiert bleibt er am herbstlichen Bahnsteig zurück, ich bin wieder ein ganz normaler Reisender, jemand, der aus Verona eintrifft, eine Person mit einem Koffer, die zum Vaporetto eilt. »Über die düsteren Kanäle wölbten sich die hohen Brücken, und da war ein dunkler Geruch von Feuchtigkeit, Moos und grüner Fäulnis, und da war die Atmosphäre einer jahrhundertealten Geheimnisvergangenheit, einer Vergangenheit der Intrigen und Verbrechen; dunkle Gestalten schlichen über die Brücken, an Kaimauern entlang, in Umhänge gehüllt, maskiert; die Leiche einer weißen Frau schienen zwei bravi dort von einem Balkon … ins schweigende Wasser gleiten lassen zu wollen! Doch es waren lediglich Schemen, es waren lediglich Spukerscheinungen aus unserer eigenen Phantasie.«
Das bin nicht ich, das war Couperus[1]. Mir gegenüber sitzt kein Schemen, sondern eine Nonne. Sie hat ein weißes Gesicht, lang und schmal, und liest ein Buch über educazione linguistica. Das Wasser ist schwarzgrau, ölig, es glänzt keine Sonne darin. Wir fahren an geschlossenen Mauern entlang, die angegriffen sind, bewachsen mit Moos und Schimmel. Auch für mich gehen dunkle Gestalten über die Brücken. Es ist kühl auf dem Wasser, eine durchdringend feuchte Kälte, die vom Meer heraufzieht. In einem Palazzo sehe ich jemanden zwei Kerzen an einem Leuchter anzünden. Alle anderen Fenster sind hinter abgeblätterten Läden geschlossen, und jetzt schließt sich auch noch der letzte Laden – eine Frau tritt vor und macht die Bewegung, die sich nicht anders machen lässt: Mit weit ausgebreiteten Armen geht sie auf die Läden zu, ihre Gestalt zeichnet sich gegen das schwache Licht ab, so verdunkelt sie sich selbst bis zur Unsichtbarkeit. Mein Hotel liegt gleich hinter der Piazza San Marco, von meinem Zimmer im ersten Stock sehe ich ein paar Gondolieri, die zu so später Stunde noch auf Touristen warten, ihre schwarzen Gondeln wiegen sich im Wasser. Auf dem Platz suche ich nach der Stelle, von der aus ich zum ersten Mal den Campanile und San Marco gesehen habe. Das ist lange her, doch der Augenblick bleibt unvergesslich. Die Sonne knallte auf die Piazza, auf all die runden, weiblichen Formen von Torbögen und Kuppeln, die Welt machte einen Sprung, und mir schwindelte. Hier hatten Menschen etwas getan, was unmöglich war, auf diesen paar sumpfigen Stücken Land hatten sie sich ein Gegengift ausgedacht, einen Zauber gegen alles, was hässlich war auf der Welt. Hundertmal hatte ich diese Abbildungen gesehen, und trotzdem war ich nicht darauf vorbereitet, weil es vollkommen war. Dieses Glücksgefühl ist nie vergangen, und ich erinnere mich, dass ich den Platz betrat, als wäre es nicht erlaubt, aus den engen, dunklen Gassen hinaus auf das große, ungeschützte, sonnenbeschienene Rechteck, und an seinem Ende dieses Ding, dieses unglaubliche Gespinst aus Stein. Oft genug bin ich danach noch in Venedig gewesen, und selbst wenn sich dieser Pfeilschuss des ersten Mals nicht wiederholt hat, erlebe ich doch nach wie vor diese Mischung aus Entzücken und Verwirrung, auch jetzt bei Nebel und angebrachten Schutzbrettern gegen die Flut. Wie viel wohl alle Augen zusammen wiegen, die diesen Platz gesehen haben?
Ich spaziere an der Riva degli Schiavoni entlang. Ginge ich nach links, müsste ich mich im Labyrinth verirren, aber ich will nicht nach links, ich will auf dieser bereits halb verhüllten Grenze zwischen Land und Wasser entlangspazieren, bis zum Partisanendenkmal, der großen, gefallenen Gestalt einer toten Frau, die von den kleinen Wellen des Bacino di San Marco umspült wird. Grausam und traurig ist dieses Denkmal. Die Dunkelheit verdüstert den großen finsteren Körper, der sich sacht hin und her zu bewegen scheint, die Wellen und der Nebel täuschen mich, es ist, als würde ihr Haar durch die Bewegung des Wassers auseinandergefächert, als wäre jetzt Krieg und nicht damals. Sie ist so groß, weil sie bei unserer Erinnerung etwas bewirken will, eine viel zu große Frau, die erschossen wurde und dort im Meer liegt, bis sie, wie alle Denkmäler, aus einer bitteren Erinnerung an diesen einen Krieg und diesen einen Widerstand zu einem Zeichen wird, das immer für Krieg und Widerstand steht. Und dennoch – wie leicht verliert ein Krieg all sein Blut, sofern er sich nur vor hinreichend langer Zeit zugetragen hat. In dem Buch, das ich bei mir habe, The Imperial Age of Venice, 1380-1580, sind die Schlachten, das Blut und die Reiche zu Schraffuren, Pfeilen und hin und her springenden Grenzen auf der Karte von Italien, Nordafrika, der Türkei, Zypern sowie dessen abstrahiert, was heute der Libanon und der Staat Israel ist, die Pfeile reichten bis Tana und Trapezunt am Schwarzen Meer, bis nach Alexandria und Tripoli, und auf den Routen dieser Pfeile kehrten die Schiffe beladen mit Kriegsbeute und Handelswaren zurück, die aus der Stadt am Wasser eine byzantinische Schatzkammer machten.
Ich nehme ein Boot zur Giudecca. Dort habe ich nichts zu suchen. Die von Palladio erbauten Kirchen stehen wie hermetische Marmorfestungen da, die Passanten gehen umher wie Geister. Man ist daheim – hinter geschlossenen Fenstern ist das erstickte Geräusch der Fernseher zu hören. Ich gehe wahllos in Straßen hinein und hinaus, will zur anderen Seite hinüber, was mir aber nicht gelingt. Die Lichter der Stadt kann ich jetzt fast nicht mehr erkennen. So dürfte die Vorhölle für mich gern aussehen, Gassen ohne Ausweg, plötzlich auftauchende Brücken, Ecken, verlassene Häuser, Geräusche, die zu nichts gehören, das Rufen eines Nebelhorns, Schritte, die sich entfernen, Passanten ohne Gesicht, die Köpfe in schwarze Tücher gehüllt, eine Stadt voller Schemen und voller Erinnerung an Schemen, Monteverdi, Proust, Wagner, Mann, Couperus, die in der allgegenwärtigen Nähe dieses schwarzen, mit Tod bestrichenen, wie ein marmorner Grabstein geschliffenen Wassers umhergeistern.
Am nächsten Tag besuche ich die Accademia. Ich bin des so weltlichen Abendmahls von Veronese wegen gekommen, doch das wird gerade restauriert, der Saal ist durch einen Vorhang geschlossen. Die beiden Restauratoren, ein Mann und eine Frau, sitzen nebeneinander auf einer niedrigen Bank und beschäftigen sich mit den Steinplatten unter der rosafarbenen und der grünen Person, wie ich sie der Einfachheit halber nennen will. Mit einem Stock, an dem ein weißer Ball befestigt ist, reiben sie über eine äußerst kleine Fläche. Dort wird es heller. Die Frau trägt ein Rot, das zu einer der Figuren passt. Von Zeit zu Zeit lassen sie ihre chemischen Stöcke sinken und diskutieren über eine Farbe oder eine Richtung, mit Gesten so theatralisch wie die Veroneses. Ich weiß nicht mehr, ob es Baudelaire war, der Museen mit Bordellen verglichen hat, jedenfalls steht fest, dass es immer viel mehr Gemälde gibt, die etwas von dir wollen, als umgekehrt. Das macht die Atmosphäre in den meisten Museen so niederdrückend, all diese mit einer Absicht gemalten Quadratmeter, die so werbend dahängen und einem nichts zu sagen haben, die nur dahängen, um eine Periode zu illustrieren, Namen zu repräsentieren, Reputationen zu bestätigen. Heute jedoch, während ich enttäuscht vom verborgenen Veronese weggehe, habe ich Glück.
Irgend etwas an einem Gemälde, an dem ich schon vorbei bin, ruft mich zurück, mein Hirn ist an etwas hängengeblieben. Von dem Maler, Bonifacio de’ Pitati, habe ich noch nie gehört. Das Bild heißt Die Erscheinung des Ewigen (Apparizione dell’Eterno) und sieht auch so aus. Über dem Campanile – der tatsächlich im Jahr 1902 einstürzte, doch das konnte der Jahrhunderte zuvor gestorbene Maler nicht wissen – hängt drohend eine düstere Wolke. Die Spitze ist unsichtbar, die Wolke selbst mehrschichtig, und mit weit ausgebreiteten Armen fliegt in seinem eigenen, noch düstereren und ebenfalls wolkenartigen Umhang ein Greis vorbei, umgeben von Köpfen und Teilen – der Andeutung eines Händchens, einer aufwärts fliegenden molligen Armpartie – jener reizlosen Engelart, die man putti nennt. Aus der Düsternis des Umhangs und des geringeren Übels, der Wolke, rettet sich eine Taube, die ein seltsam durchdringendes Licht verströmt.
Ich bin durch meine Erziehung von früher her perfekt konditioniert, diese Art von Bildern zu deuten. Dies sind der Vater und der Heilige Geist, und sie sausen, ohne Begleitung des Sohns, mit großer Geschwindigkeit über die Lagune. San Marco ist fein gepinselt, alles andere etwas verschwommen, es kostet Mühe, mir klarzumachen, dass diese so viel früher gemalte Kirche in Wirklichkeit ganz in meiner Nähe steht. Auf dem großen Platz verkehren mit leichten Strichen angedeutete menschliche Wesen. Einige von ihnen haben zarte, fliegenflügelartige Arme erhoben, doch massenhaften Schrecken, wie bei einer Schießerei, ruft diese Darstellung der Ewigkeit nun auch wieder nicht hervor. Einige Segel von Schiffen werden vom Taubenlicht erfasst, doch niemand der Anwesenden auf dem Platz wird nonym, sie haben keine Gesichter und damit keine Namen, keine Charaktere, stellen lediglich eine Menschenmenge dar. Mit Mühe löst sich die Andeutung eines Hundes aus dem gemalten Pflaster, ein Fleck, der einen Hund verkörpert, zwischen anderen, ebenfalls materiellen Flecken, die nichts verkörpern, keine Substantive, lediglich die Nuancen von Farbe und Stein, Beiwerk. Jemand trägt eine Tonne oder ein schweres Holzbündel und geht folglich gebeugt, viele scharen sich um einen, doch warum, wird nicht klar, Handelsgegenstände hängen am Vordach einer Bude, längliche Hasen, Tücher, Lavendelbüschel, nur der Maler wusste es. Die Erscheinung schiebt ihre winzigen Schatten in Flugrichtung voraus, die Kuppeln von San Marco sind verengt, aufgebläht, sind beim Glasblasen nicht gut geraten, zu hoch und zu dünn.
Noch einmal starre ich, als könnte ich selbst dabeistehen, auf diese seltsamen Reihen menschlicher Wesen, frühere Venezianer. Sie sind aufgestellt wie an einer englischen Bushaltestelle, allerdings ohne Haltestelle, das Warten, das von ihnen verlangt wird, beginnt offenbar an einem geheimnisvollen Ort des Nichts, es ist die Stelle, die ich nachher auf diesem Platz gern wiederfinden würde, markiert durch eine Formel, die nur ich lesen könnte, so dass ich, und niemand sonst, die Ewigkeit sähe, die dort, und nur dort, vermummt als alter Mann, der einer Taube nachjagt, vorbeifliegen würde, als könnte sie Ikarus einholen.
Ein Traum von Macht und Geld
Ein anderes Damals, ein anderes Jetzt. Zeit wiegt hier nichts. Heute beschäftige ich mich mit dem Wasser. Alles ist eine Wiederholungsübung, die Stadt muss stets aufs Neue erobert werden. Palude del Monte, Bacino di Chioggia, Canale di Malamocco, Valle Palezza, wie herrlich wäre es, sich Venedig noch einmal zum ersten Mal zu nähern, nun aber schleichend: auf das Labyrinth zufahrend durch jenes andere Labyrinth der Sümpfe, zwischen Wassertieren, im morgendlichen Frühnebel an einem Januartag wie diesem, ringsum nichts als das Geräusch der Vögel und das Plätschern der Ruder, das brackige Wasser still und glänzend, die Vision in der Ferne noch verschleiert, die Stadt in ihr eigenes Geheimnis gehüllt. Palude della Rosa, Coa della Latte, Canale Carbonera, auf der großen Karte der Lagune wirken die Wasserwege wie fächelnde Algen, wie Pflanzen mit gewundenen, beweglichen Fangarmen, doch es sind Wasserwege im Wasser, Wege, die man kennen muss, wie ein Fisch seinen Weg kennt, Fahrrinnen im Wasser, das bei Ebbe wieder zu Land wird, nassem Land aus saugendem Schlamm, Jagdrevier des Dunklen Wasserläufers, des Rotschenkels, des Strandläufers auf ihrer ewigen Suche nach Würmern und kleinen Muscheln in deren Behausung aus Wasser und Sand. Sie waren die ersten Bewohner, und vielleicht, wenn die Stadt dereinst wie eine unendlich verlangsamte Titanic wieder im weichen Boden versinkt, auf dem sie jetzt noch zu schwimmen scheint, werden sie auch die letzten sein, als habe die Welt zwischen diesen beiden Augenblicken etwas geträumt, etwas Unmögliches, einen Traum von Palästen und Kirchen, von Macht und Geld, von Herrschaft und Niedergang, ein Paradies der Schönheit, das aus sich selbst vertrieben worden ist, weil die Erde ein so großes Wunder nicht ertragen konnte.
Die Ewigkeit können wir uns bekanntlich nicht wirklich vorstellen. Womit sie für meinen Menschenverstand noch am ehesten Ähnlichkeit hat, ist die Zahl Tausend, wahrscheinlich wegen der runden Leere dieser drei Nullen. Eine Stadt, die schon länger als tausend Jahre existiert, ist eine greifbare Form der Ewigkeit. Ich denke, das wird der Grund dafür sein, dass die meisten Menschen sich hier ein wenig fremd bewegen, verirrt zwischen all den Schichten der Vergangenheit, die in dieser Stadt gleichzeitig alle zur Gegenwart gehören. Anachronismus ist in Venedig das Wesen der Dinge selbst, in einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert betrachtet man ein Grab aus dem 15. und einen Altar aus dem 18. Jahrhundert, was die Augen sehen, ist, was die jetzt nicht mehr existierenden Augen Millionen anderer gesehen haben, und das ist hier durchaus nicht tragisch, denn während man schaut, reden sie weiter, man befindet sich fortwährend in der Gesellschaft Lebender und Toter, man nimmt teil an einer seit Jahrhunderten geführten Konversation. Proust, Ruskin, Rilke, Byron, Pound, Goethe, McCarthy, Morand, Brodsky, Montaigne, Casanova, Goldoni, da Ponte, James, Montale, wie das Wasser in den Kanälen umfließen einen ihre Worte, und wie das Sonnenlicht die Wellen hinter den Gondeln in tausend kleine Glitzerlichter zersplittern lässt, so echot und leuchtet in all diesen Gesprächen, Briefen, Skizzen, Gedichten das Wort »Venedig« auf, immer gleich, immer anders. Nicht von ungefähr nannte Paul Morand sein Buch über diese Stadt Venises (»Venedige«), und eigentlich ist selbst das noch nicht genug. Nur für diese Insel müsste es eine Steigerungsstufe des Plurals geben.
Ich kam nicht auf dem Wasser, ich kam aus der Luft, von der einen Wasserstadt in die andere. Ein Mensch, der sich verhält wie ein Vogel – das kann nicht gutgehen. Dann mit einem Taxi über die Brücke, die es nie hätte geben dürfen, mit einem Fahrer, der es entsetzlich eilig hat, ein Mensch, der sich verhält wie ein Jagdhund, ich spüre, dass es nicht richtig ist, nicht hier. Doch ich habe mich gewappnet, ich bin gepanzert mit Vergangenheit. In meinem Gepäck befinden sich der Baedeker von 1906 und der Führer des Touring Club Italiano von 1954. Der Bahnhof liegt noch immer dort, wo er hingehört, ich werde mich nicht fragen, wie viele Menschen hier seit 1906 mit dem Zug angekommen sind. »Gondeln mit einem Ruderer 1-2 fr., nachts 30 c. mehr, mit zwei Ruderern das doppelte, Gepäck jedes kleinere Stück 5 c. Gondeln sind stets ausreichend vorhanden, außerdem bis gegen Mitternacht die Stadtdampfer (Koffer und Fahrräder nicht zugelassen, Handgepäck frei). Bahnhof S. Marco 25 min. Fahrpreis 10 c. Pensionen, Riva degli Schiavoni 4133, deutsch, Zimmer von 21 / 2 fr. an. Möblierte Zimmer (auch für kurze Zeit), Frau Schmütz-Monti, Sottoportico Calle dei Preti 1263. Hotel: H. Royal Danieli, nahe dem Dogenpalast, mit Aufzug, 220 Z. von 5 fr. an mit Zentralheizung.« 1954 kostet eine Gondelfahrt von der Stazione Ferroviaria zum Albergho del centro für zwei Personen mit höchstens vier Koffern bereits 1500 Lire, danach haben sich die Beträge den astronomischen Zahlen der Raumfahrt angepasst. Louis Couperus reiste zu Beginn unseres Jahrhunderts noch mit zehn Koffern und umgeben von einer Wolke von Gepäckträgern nach Venedig, doch der Fortschritt hat uns zu unseren eigenen Dienern gemacht, und so schleppe ich meine beiden störrischen Koffer zwischen den Beinen der Menge hindurch zum Vaporetto und zahle einen Betrag, von dem zu Rilkes und Manns Zeiten eine Familie eine Woche lang hier hätte leben können. Eine halbe Stunde später wohne ich auf einem vier Marmortreppen hohen Alpengipfel in einer Gasse, in der man seine Ellbogen besser nicht spreizt, doch aus sechs schmalen Fenstern habe ich Aussicht auf eine Kreuzung zweier Kanäle, die ich als Amsterdamer Grachten nennen würde. In dem Augenblick, da ich eines dieser Fenster öffne, fährt eine Gondel vorbei mit acht durchfrorenen japanischen Mädchen und einem Gondoliere, der O sole mio singt. Ich bin in Venedig.
Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, die bronzenen Stimmen der Zeit, die man in anderen Städten nicht mehr hört, hier überfallen sie einen in Gassen und auf Brücken, als wäre es die Zeit persönlich, die einen verfolgt, um mitzuteilen, welches Stück nun wieder von ihr abgeschlagen worden ist. Du hast dich im Labyrinth verirrt, suchst die Santa Maria dei Miracoli, die Ezra Pound als jewelbox bezeichnet hat, du weißt, dass du ganz in ihrer Nähe bist, der Name der Gasse, in der du stehst, ist nicht auf der sonst so ausführlichen Karte angegeben, eine Uhr schlägt, und dann schlägt eine andere und noch eine andere, und die spricht nicht mehr von der Zeit, sie ruft etwas vom Tod, düstere, schwarze Schläge, oder von einer Hochzeit oder einem Hochamt, und dann galoppieren die Uhren gegeneinander, als machten sie ein Wettrennen. Um zwölf Uhr mittags wird das Angelus geläutet, dessen lateinische Worte ich noch aus der Schulzeit kenne: Angelus Domini nunciavit Mariae, der Engel des Herrn hat Maria verkündigt, und gleichzeitig siehst du sie vor dir, all die Verkündigungen, die byzantinischen wie gotischen, die von Lorenzo Veneziano und den Bellinis gemalten, in der Accademia, in der Ca d’Oro, in den Kirchen: immer wieder der Flügelmann und die Jungfrau, du siehst sie so oft, dass du dich nicht mehr darüber wunderst, dass ein Mann Flügel hat, genausowenig wie du dich über die anderen Traumfiguren wunderst, gekrönte Löwen, Einhörner, durch die Luft fliegende Menschen, Greife, Drachen, sie wohnen hier, du bist es, der sich in das Hoheitsgebiet des Traumes, der Fabel, des Märchens verirrt hat, und wenn du klug bist, lässt du es auch zu. Du hast etwas gesucht, einen Palast, das Haus eines Dichters, aber du verläufst dich, biegst in eine Gasse ein, die an einer Mauer endet oder an einem Ufer ohne Brücke, und mit einem Mal wird dir bewusst, dass es genau darum geht, dass du erst dann die Dinge siehst, die du sonst nie sehen würdest. Du bleibst stehen, und was du hörst, sind Schritte, das vergessene Geräusch, das zu einer Zeit ohne Autos gehört und hier seit Jahrhunderten ununterbrochen ertönt. Schlurfende, stürmische, eilige, träge, schlendernde Schritte, ein Orchester mit Instrumenten aus Leder, Gummi, Holz, Sandalen, Stöckelschuhe, Stiefel, Freizeittreter, doch stets das menschliche Maß, das in den Stunden des Lichts anschwillt und, wenn es dunkel wird, allmählich abnimmt, bis man nur noch Soli hört und schließlich die einsame Arie der eigenen Füße, die in der dunklen, schmalen Gasse, auf den Marmorstufen widerhallen, und dann nur noch Stille, bis die Stadt zum letzten Mal etwas sagen will: dass es auch in Fabeln Mitternacht wird. Von meinen hohen Fenstern aus höre ich in der allumfassenden Stille die Marangona, die große Glocke des Campanile, die noch einmal geläutet wird, umflorte, schwere, befehlende Schläge. Die Stadt am Wasser wird geschlossen, dies ist das Ende aller Geschichten, geh schlafen. Keine Bewegung mehr auf dem reglosen Wasser dort unten, keine Stimmen, keine Schritte. Der Doge schläft, Tintoretto schläft, Monteverdi schläft, Rilke schläft, Goethe schläft, die Löwen, Drachen, Basilisken, die Standbilder von Heiligen und Helden, alle schlafen sie, bis die ersten Schiffe mit Fisch und frischem Gemüse eintreffen und die Sinfonie der hunderttausend Füße von Neuem beginnt.
Zinkfarbenes Licht, der Maler weiß noch nicht, was er mit diesem Tag anfangen soll, so lassen, mehr Kupfer, grünlich verfärbt, hineingeben, das Grau stärker betonen oder aber mehr Licht über alles fließen lassen. Fledermauswetter, und als es zu regnen beginnt, spannt jeder seinen Regenschirm auf, verwandelt sich in seine eigene Fledermaus. Fünf Minuten später scheint die Sonne wieder, der Wind bläst über die Riva degli Schiavoni, das Wasser ist erregt wie eine nervöse Schauspielerin, ich rieche das Meer zu meinen Füßen, denn ich habe mich auf eine kleine Holztreppe gesetzt, die ein Stück weit ins Wasser hinausragt. Hier hat Petrarca gewohnt, habe ich hinter mir gelesen, l’illustre messer Francesco Petrarca essendogli compagno nell’incantevole soggiorno l’amico Giovanni Boccaccio, und jetzt möchte ich sehen, was sie sahen, wenn sie vor dem Haus standen, die beiden Meister mit ihren beobachtenden Augen. Die Spitze am Ende des Sestiere Dorsoduro, wo jetzt zwei Atlanten die goldene Weltkugel auf dem Turm der Dogana stützen müssen, aber die gab es damals noch nicht. Punta del Sale hieß die Spitze früher wegen der vielen Salzspeicher an der Zattere. Und genau gegenüber, auf der kleinen Insel, auf der jetzt die klassizistische Gewalt der San Giorgio Maggiore steht, befand sich eine Benediktinerabtei, die, wenn die beiden jetzt neben mir stünden, auf rätselhafte Weise verschwunden wäre. Wie sollte ich ihnen das erklären, Palladio? Das Heimweh nach den reinen Linien des vorchristlichen Roms, das diese riesigen triumphalen Tempel über ihre bescheidene, wahrscheinlich präromanische, wahrscheinlich im Jahr 982 aus Backstein errichtete Abtei gebaut hatte, genauso wie das gleiche heidnische Heimweh auch die ebenso stolze Kirche Il Redentore ein paar hundert Meter weiter auf La Giudecca gebaut hatte sowie die Santa Maria della Salute gleich jenseits der Dogana am Canal Grande. Nur die San Marco würden sie, zumindest der Form nach, wiedererkennen, der Rest wäre eine Vision, etwas, das auf geheimnisvolle Weise wie eine vorstellbare Vergangenheit und gleichzeitig wie eine undenkbare Zukunft aussah. Doch dies sind schon wieder die Träume des Anachronismus, und diesmal sind es verbotene Träume, denn während ich hier sitze und über sie nachsinne, sehe ich, wie ein kleines Polizeiboot um mich herumfährt, umdreht, zurückkommt, manövriert, wie es nur die auf dem Wasser geborenen Venezianer fertigbringen. Der Carabiniere streckt den Kopf heraus und sagt, dass ich da nicht sitzen darf: Ich befinde mich auf meiner Kokosmatte vier Meter zu weit von der Küste entfernt, dies ist Zona militar! Gehorsam erhebe ich mich, ich kann ja schlecht erklären, dass ich mich gerade mit Petrarca und Boccaccio unterhalte, und mit den Seestreitkräften der Serenissima ist nicht zu spaßen, da braucht man nur an allen Küsten dieses Meeres zu fragen!
Es geschieht unweigerlich. Man ist den ganzen Tag in der Accademia umhergewandert, hat einen Quadratkilometer bemalte Leinwand gesehen, es ist der vierte, sechste oder achte Tag, und man hat das Gefühl, dass man gegen einen mächtigen Strom von Göttern, Königen, Propheten, Märtyrern, Mönchen, Jungfrauen, Ungeheuern geschwommen ist, die ganze Zeit mit Ovid, Hesiod, dem Alten und dem Neuen Testament unterwegs gewesen ist, dass einen die Viten der Heiligen, die christliche und die heidnische Ikonographie verfolgen, das Rad der Katharina, die Pfeile des Sebastian, die geflügelten Fersen des Hermes, der Helm des Mars und sämtliche Stein-, Gold-, Porphyr-, Marmor-, Elfenbeinlöwen es auf einen abgesehen haben. Fresken, Tapisserien, Grabmale, alles ist mit Bedeutung befrachtet, verweist auf tatsächliche oder ersonnene Geschehnisse, Heerscharen von Meeresgöttern, Putten, Päpsten, Sultanen, Condottieri, Admiralen, die alle beachtet sein wollen. Sie sausen an den Decken entlang, blicken dich mit ihren gemalten, gewirkten, gezeichneten, gebildhauerten Augen an. Manchmal sieht man dieselben Heiligen mehrmals an einem Tag, in gotischer, byzantinischer, barocker oder klassischer Vermummung, denn Mythen sind mächtig, und die Helden passen sich an, ob Renaissance oder Rokoko, ist ihnen egal, sofern man nur schaut, sofern nur ihr Wesen intakt bleibt. Einst waren sie damit betraut, die Macht ihrer Herren zum Ausdruck zu bringen in einer Zeit, in der jeder wusste, was sie verkörperten, Tugend, Tod oder Morgengrauen, Krieg, Offenbarung, Freiheit, sie spielten ihre Rolle in den Allegorien, die ihnen gewidmet waren, sie erinnerten an Bekenner und Kirchenväter, Feldherren und Bankiers; jetzt ziehen andere Heerscharen an ihnen vorbei, die der Touristen, die ihre Bildsprache nicht mehr verstehen, die nicht mehr wissen, was sie bedeuten oder bedeutet haben, nur ihre Schönheit ist geblieben, das Genie des Meisters, der sie erschaffen hat, und so stehen sie da, ein Volk steinerner Gäste, winken von Kirchenfassaden, beugen sich vor aus den Trompe-l’œils der Palazzi, die Kinder von Tiepolo und Fumiani sausen durch die Luft, und wieder wird der heilige Julian enthauptet, wieder wiegt die Madonna ihr Kind, wieder kämpft Perseus mit der Medusa, spricht Alexander mit Diogenes. Der Reisende weicht zurück vor all dieser Gewalt, will kurzzeitig nichts mehr, nur auf einer Steinbank am Ufer sitzen, zuschauen, wie ein Ohrentaucher im grünlichen Brackwasser nach Beute sucht, auf die Bewegung des Wassers blicken, sich in den Arm kneifen, um sicher zu sein, dass er selbst nicht gebildhauert oder gemalt ist. Könnte es sein, denkt er, dass es in Venedig mehr Madonnen gibt als lebende Frauen? Ob jemand weiß, wie viele gemalte, gebildhauerte, in Elfenbein geschnittene, in Silber ziselierte Venezianer es eigentlich gibt? Und angenommen, denkt er, aber das kommt nur daher, weil er so müde ist, sie erhöben sich einmal alle zur gleichen Zeit, verließen ihre Rahmen, Nischen, Predellen, Sockel, Teppiche, Dachgesimse, um die Japaner, Amerikaner, Deutschen aus ihren Gondeln zu jagen, die Restaurants zu besetzen und mit ihren Schwertern und Schilden, ihren Purpurumhängen und Kronen, Dreizacken und Flügeln endlich den Lohn für zehn Jahrhunderte treuer Dienste einzufordern?
Ein Tag kleiner Dinge. Trotz Kälte und Wind auf dem Vordeck des Vaporetto sitzen, vom Regen gegeißelt, von der Anlegestelle aufs Deck springen und vom Deck auf die Anlegestelle, wünschen, man würde jeden Tag so befördert, stets das sich bewegende Element Wasser um sich herum, die Verheißung des Reisens. Einst, im Jahr 1177, hatten die mächtigen Venezianer Barbarossa gezwungen, hier in der Vorhalle der San Marco Papst Alexander den Fuß zu küssen und Seiner Heiligkeit danach draußen auf der Piazza in den Steigbügel des päpstlichen Maulesels zu helfen. Zum Dank dafür hatte der Papst dem Dogen einen Ring geschenkt, mit dem er sich jedes Jahr am Himmelfahrtstag mit dem Meer vermählen konnte: »Wir vermählen uns dir, Meer, zum Zeichen der wahren und dauernden Herrschaft.« Die See hat ihren jeweils neuen, aber immergleichen Gemahl danach vielfach betrogen, doch in einer Hinsicht ist sie treu geblieben: Immer noch liegt jeden Morgen ein Silberschatz auf den Steintischen des Fischmarkts, orata und spigola, capone und sostiola, und all die anderen Farben, die Sepia, die mit Tinte beschmiert ist, als hätte der Schriftsteller lange herumprobiert, die noch lebende, sich windende anguilla, rot von Blut durch die Kerben des Hackmessers, die Krabbe, die mit ihren acht Beinen noch immer nach dem Leben sucht, die lebenden Steine der Austern, Mies- und Herzmuscheln – jeder Mensch des Mittelalters würde sie wiedererkennen, wie er auch die Pescheria wiedererkennen würde, die hier schon mehr als tausend Jahre am Canal Grande nahe der Rialtobrücke liegt, neben der ältesten Kirche Venedigs, der San Giacometto. Ich bin unter der viel zu großen Uhr mit dem einen Zeiger und den vierundzwanzig mächtigen römischen Ziffern hineingegangen, vorbei an den fünf schlanken Säulen mit ihren korinthischen Kapitellen, die schon seit dem Jahr 900 auf Fisch und Gemüse herabblicken. Wenn ich meine Reiseführer richtig verstanden habe, wurde hier drinnen alles gründlich umgebaut, doch dies ist nicht der Moment, mich mit Kunstgeschichte zu befassen. Ein alter Priester im grünen Messgewand erteilt seinen Gemeindemitgliedern den Segen und schickt sich an, noch etwas zu sagen. Die kleine Kirche ist voll, gleicht einem Wohnzimmer, in dem die Bewohner ihre Mäntel anbehalten haben. Sie sind unter sich, sie kennen einander, es scheint, als wüssten sie, dass an diesem Ort schon seit fünfzehnhundert Jahren gebetet wird, als hätten sie selbst noch am Sterbelager der römischen Götter gestanden und hätten von draußen das eigenartige Getöse der Reformation, der Französischen Revolution, das Rasseln eines eisernen Vorhangs und das Geschrei aus dem Sportpalast gehört. Hier drinnen hatte sich währenddessen nichts geändert. Jemand, der später in Turin einen Esel umarmt hatte, soll behauptet haben, Gott sei tot, doch sie hatten sich weiter mit denselben Worten an ihn gewandt, mit denen sie das schon immer getan hatten, und jetzt schlurfte der alte Mann zum Altar des heiligen Antonius, hielt eine Reliquie des Heiligen in die Höhe, ein Knöchelchen oder ein Stückchen Kutte hinter Glas, das konnte ich nicht richtig erkennen. Der Priester bittet den großen Wüstenheiligen, uns in unserer debolezza beizustehen. Als ich dieses Wort später sicherheitshalber nachschlage, sehe ich, dass es Schwäche bedeutet, eine nicht unangemessene Beschreibung. Hinterher unterhalten sich die Männer noch eine Weile unter den sechs Ewigen Lichtern, in denen hinter roten Scheiben ein brennendes Ölflämmchen glüht. Der Priester geht, gehüllt in eine viel zu dünne Plastikjacke über der Soutane, jeder gibt jedem die Hand. Ich werfe noch schnell einen Blick auf den Beichtstuhl. Es hängt nur ein dürftiges violettes Gardinchen davor, der Beichtende hat keine Chance, sich zu verstecken, wer hier seine Sünden flüstert, kann sie genausogut ausrufen lassen. Die Mauern wispern noch Neuigkeiten über die Zunft der Ölumfüller (travasadori d’olio), der Getreidesiebmacher und der Lastenträger, über den Dogen, der jahrhundertelang an jedem Gründonnerstag hierherkam, um den Heiligen zu ehren, doch ich bin jetzt mit dem größten aller venezianischen Maler in der Scuola di San Giorgio degli Schiavoni verabredet: Vittore Carpaccio. In der Accademia hat er einen eigenen Saal, wo man in seinem Universum gefangen wird, wenn er an allen vier Wänden die Legende der heiligen Ursula erzählt, ein Gemäldezyklus, über den man ein Buch schreiben müsste. Hier in der Scuola ist die Pracht nicht geringer, doch heute bin ich in diesen kleinen intimen Raum zurückgekehrt, um ein einziges Gemälde zu sehen, die Vision des größten Heiligen unter den Schriftstellern und des größten Schriftstellers unter den Heiligen: Augustinus von Hippo. Vielleicht, weil auf diesem Bild das Arbeitszimmer eines Schriftstellers abgebildet ist, in das ich am liebsten sofort einziehen würde. Gut, die Mitra auf dem Altar, den Stab, die Christusfigur mit Kreuz und Fahne darf ich mir nicht anmaßen, doch das perfekte Licht, die aufgeschlagenen Bücher, die Partitur, die Muschel, dem Anschein nach ein Mitglied aus der Familie der Cypraeidae, die prachtvoll gebundenen Mappen an der linken Wand, die möglicherweise Manuskripte bergen, der drehbare Bücherständer, der die Neugier erregende Brief, der irgendwo mitten auf dem Fußboden liegt, und das flauschige weiße Hündchen mit den vorgestreckten Vorderbeinen, der hochgereckten Nase und den beiden kirschschwarzen klaren Augen, nein, wer hier nicht schreiben kann, braucht es gar nicht erst irgendwo sonst zu versuchen. Der Heilige selbst ist im geheimnisvollsten aller Momente ertappt worden, dem der Inspiration. Er hat die Feder erhoben, Licht strömt herein, er hört, wie die Wörter sich formieren, und weiß schon fast, wie er sie niederschreiben wird; eine Sekunde später, wenn Carpaccio weg ist, taucht er seine Feder in die Tinte des Tintenfischs und schreibt den Satz, der jetzt in allen Bibliotheken der Welt in einem seiner Bücher bewahrt ist.
Ende. Ein letzter Tag, der in einem anderen Jahr wieder ein erster sein wird, denn zwischen Venedig und Venedig darf viel vergessen werden. Jetzt will ich die Toten aufsuchen. An den Fondamenta Nuove nehme ich das Vaporetto, das zur Toteninsel San Michele und dann weiter nach Murano fährt. In einer wunderbaren Novelle von Alejo Carpentier, Barockkonzert, kommt eine Szene vor, in der Händel und Vivaldi, der rote Priester, nach einer wilden karnevalesken Nacht voller Musik und Wein mit ein paar Leuten auf der Toteninsel frühstücken. Sie essen und trinken, »indes der Venezianer, an einer Scheibe in Essig, Thymian und rotem Pfeffer gebeiztem Wildschweinschinken kauend, ein paar Schritte ging und plötzlich stehen blieb vor einem Grab in der Nähe, das er schon seit einiger Zeit betrachtet hatte, weil darauf ein in dieser Gegend ungewöhnlicher Name prangte. ›Igor Strawinsky‹, sagte er buchstabierend. ›Stimmt‹, sagte der Deutsche, seinerseits buchstabierend. ›Er wollte in diesem Friedhof ruhen.‹ – ›Ein guter Musiker‹, sagte Antonio, ›aber manchmal sehr altmodisch in seinen Vorhaben. Er inspirierte sich an den altgewohnten Themen: Apollo, Orpheus, Persephone – wie lang noch?‹ – ›Ich kenne seinen Oedipus Rex‹, sagte der Deutsche. ›Manche behaupten, dass er am Schluss des ersten Aktes – Gloria, gloria, gloria Oedipus uxor! – an meine Musik anklingt.‹ – ›Aber … wie konnte er auf die seltsame Idee verfallen, eine weltliche Kantate auf einen lateinischen Text zu schreiben?‹, sagte Antonio. ›Auch sein Canticum Sacrum haben sie in San Marco gespielt‹, sagte Georg Friedrich. ›Darin kommen Melismen in einem mittelalterlichen Stil vor, den wir längst hinter uns gelassen haben.‹ – ›Das kommt daher, dass diese sogenannten avantgardistischen Musiker sich unglaublich anstrengen zu erfahren, was die Musiker der Vergangenheit machten, manchmal versuchen sie sogar, ihre Stile zu erneuern. Darin sind wir weit moderner. Mir ist es scheißegal, wie die Opern, die Konzerte vor hundert Jahren waren. Ich mache meine Musik nach bestem Können und Vermögen und punktum.‹ – ›Ich denke wie du‹, sagte der Deutsche, ›obwohl man auch nicht vergessen sollte, dass …‹ – ›Hören Sie doch auf mit dem blöden Zeug‹, sagte Filomeno und nahm einen ersten Schluck aus einer frisch entkorkten Flasche. Und die vier streckten wieder die Hände in die Körbe des Ospedale della Pietà, die wie mythologische Füllhörner sich nicht leeren wollten. Als aber die Stunde der Quittenkonfitüre und des Nonnenzwiebacks schlug, verflogen die letzten Morgenwolken, und die Sonne schien prall auf die Grabsteine, die weiß unter dem Dunkelgrün der Zypressen leuchteten. Als sei er durch das viele Licht größer geworden, war der russische Name deutlich zu lesen, der ihnen so nahe war.«
Die Öffnungszeit ist fast vorbei, als ich am Friedhof ankomme. Ich gehe am Pförtner vorbei, erhalte eine Landkarte des Todes mit den Wohnungen von Strawinsky, Diaghilew, Ezra Pound und dem frisch dazugetippten Joseph Brodsky. Ein ungelegener Moment, alle schlafen, und ich lege fast so etwas wie Eile an den Tag. Ich gehe an den Kindergräbern vorbei, Marmorgebäuden für Seelen, die nur einen einzigen Tag gelebt haben, und Jungenporträts, in deren Augen man noch den unsichtbaren Fußball sieht, über die Trennungslinie zwischen den Militari del Mare und jenen de la Terra, als ob diese Unterschiede dort, wo sie jetzt sind, noch zählten, und gelange so in den evangelischen Teil, stumpfe Säulen, bemooste Pyramiden, die dem 19