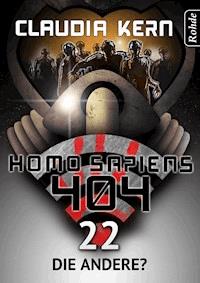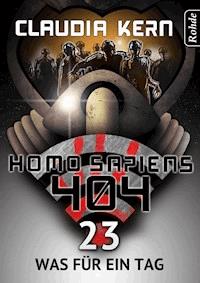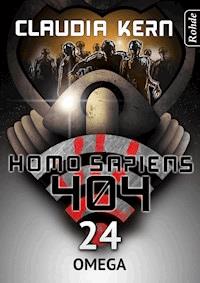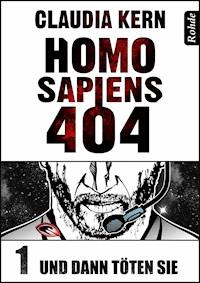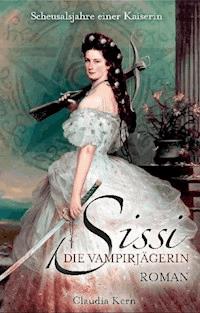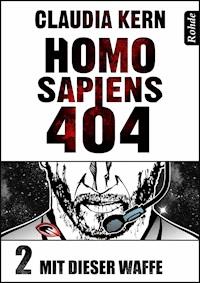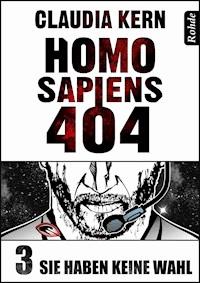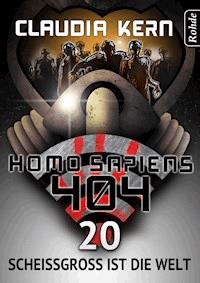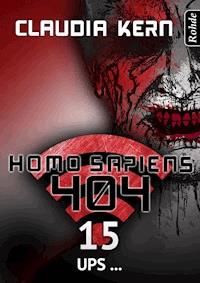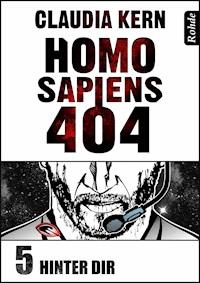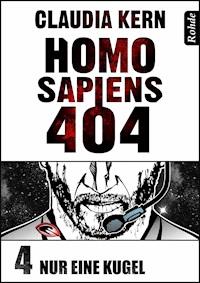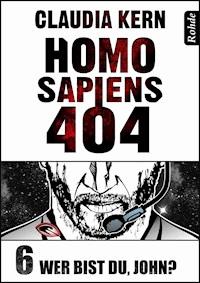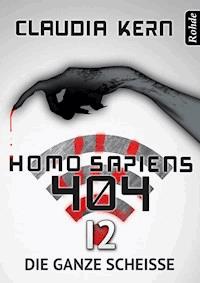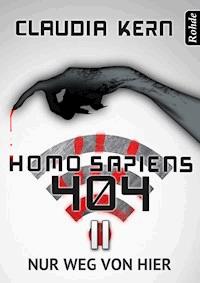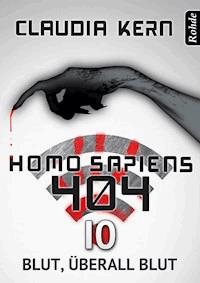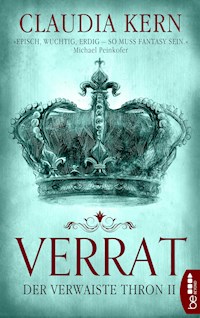
7,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der verwaiste Thron
- Sprache: Deutsch
Wenn Freunde zu Feinden werden.
Ana, die einzige Tochter des Fürsten von Somerstorm, befindet sich auf der Flucht vor den Nachtschatten. Die brutalen Wandler haben - so glaubt Ana - ihre gesamte Familie ermordet und so die Kontrolle über das Fürstentum an sich gerissen. Ihr einziger Verbündeter, Leibwächter Jonan, hat sie verlassen, und Ana ist vollkommen auf sich allein gestellt. In der Hoffnung auf Hilfe flieht sie nach Szranizar, fällt dort aber dem König ohne Land in die Hände. Dieser plant einen nie dagewesenen Eroberungsfeldzug, und auf seiner Seite steht eine unsterbliche Armee ...
Gerit steigt derweil in der Gunst der Nachtschatten immer höher. Seine Unterstützung im Kampf gegen Westfall erweist sich als entscheidender Faktor. Doch die Loyalität des jungen Mannes zu seiner Heimat ist noch lange nicht gebrochen. Gerit wartet nur auf den richtigen Augenblick.
Der zweite Band von Claudia Kerns packender Fantasy-Trilogie "Der verwaiste Thron".
Sturm - Der verwaiste Thron I.
Verrat - Der verwaiste Thron II.
Rache - Der verwaiste Thron III.
Claudia Kern hat als Autorin historische, Fantasy- und Science-Fiction-Romane verfasst. Sie ist außerdem als Übersetzerin tätig, schreibt Film- und Serienkritiken, Stories und Dialoge für Computerspiele und eine regelmäßige Kolumne im Science-Fiction-Magazin "Geek!". Als Kind entdeckte sie dank "Herr der Ringe" ihre Liebe zur Fantasy, der sie bis heute treu geblieben ist. Claudia Kern lebt und arbeitet in Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Im nächsten BandÜber dieses Buch
Wenn Freunde zu Feinden werden …
Ana, die einzige Tochter des Fürsten von Somerstorm, befindet sich auf der Flucht vor den Nachtschatten. Die brutalen Wandler haben – so glaubt Ana – ihre gesamte Familie ermordet und so die Kontrolle über das Fürstentum an sich gerissen. Ihr einziger Verbündeter, Leibwächter Jonan, hat sie verlassen, und Ana ist vollkommen auf sich allein gestellt. In der Hoffnung auf Hilfe flieht sie nach Szranizar, fällt dort aber dem König ohne Land in die Hände. Dieser plant einen nie dagewesenen Eroberungsfeldzug, und auf seiner Seite steht eine unsterbliche Armee …
Gerit steigt derweil in der Gunst der Nachtschatten immer höher. Seine Unterstützung im Kampf gegen Westfall erweist sich als entscheidender Faktor. Doch die Loyalität des jungen Mannes zu seiner Heimat ist noch lange nicht gebrochen. Gerit wartet nur auf den richtigen Augenblick.
Über die Autorin
Claudia Kern hat als Autorin historische, Fantasy- und Science-Fiction-Romane verfasst. Sie ist außerdem als Übersetzerin tätig, schreibt Film- und Serienkritiken, Stories und Dialoge für Computerspiele und eine regelmäßige Kolumne im Science-Fiction-Magazin »Geek!«. Als Kind entdeckte sie dank »Herr der Ringe« ihre Liebe zur Fantasy, der sie bis heute treu geblieben ist. Claudia Kern lebt und arbeitet in Berlin.
Claudia Kern
VERRAT
Der verwaiste Thron II
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt aufVermittlung der Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Originalausgabe VERRAT – DER VERWAISTE THRON erschien 2009 bei Blanvalet,einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Lektorat/Projektmanagement: Mirka Uhrmacher
Umschlaggestaltung: © Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deunter Verwendung von shutterstock: hayr pictures
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4368-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Zehn Jahre zuvor
Die Jagd war alles, was er hatte.
Schwarzklaue lebte im Norden, dort oben, wo das stumpfe Braunrot der Tundra in das strahlende Weiß des ewigen Eises überging. Er war im Eis geboren, lebte im Eis, und eines Tages, davon war er fest überzeugt, würde man ihn im Eis begraben, so wie es sich für den Anführer eines Clans gehörte.
Er hob die Nase in den Wind. Seit zwei Tagen folgten er und zwei junge Jäger namens Einohr und Fleckfell einer Schneebüffelherde. Es war eine große Herde mit mehr als zwanzig Tieren, zu vielen, um einen offenen Kampf zu wagen. Schwarzklaue trug die Narben einiger Schneebüffelkämpfe am Körper. Er wusste, was ihre Hörner und Hufe ausrichten konnten.
Wäre die Situation eine andere gewesen, hätte er Spaltnase, dem Schnellsten der Gruppe, befohlen, zum Lager zu laufen und mit den anderen Jägern zurückzukehren, doch die hatte Schwarzklaue ebenfalls auf die Suche nach Nahrung geschickt. Bis sie einander fanden, konnten zehn oder mehr Tage vergehen. Diese Zeit hatten sie nicht. Schwarzklaues Volk drohte zu verhungern.
Also folgten sie der Herde weiter über die Ebene, entlang dem Fuße eines Gebirges, dem niemand je einen Namen gegeben hatte. Der Wind stach in ihre Augen. Tränen vereisten in den Wimpern. Wenn Schwarzklaue blinzelte, fielen sie mit kaum wahrnehmbaren Klirren auseinander. Das Geräusch mischte sich in das Knirschen des Schnees unter seinen Krallen und das dumpfe Knarren, mit dem der Fluss tief unter dem Eis gegen das Dach seines Gefängnisses stieß.
Alles war in ständiger Bewegung – das Land, das Wasser und das Eis, das alles bedeckte. Die Wesen, die sich auf den Norden eingelassen hatten, mussten es ihm gleich- tun, mussten ständig in Bewegung bleiben, um nicht vom Land aufgerieben zu werden. Die Schneebüffel zogen im Winter zur Küste, um das harte Meeresgras zu fressen, und Schwarzklaues Volk folgte ihnen, um die zu fressen, die aus Schwäche von der Herde zurückgelassen wurden oder aus Dummheit auf ihren Schutz verzichteten. Und wenn Schwarzklaue und sein Volk weiterzogen, kamen die Ratten und die Koyoten, die fraßen, was übrig geblieben war, während über ihnen die Raubvögel kreisten.
Alles bewegte sich. Das war die einzige Lektion, die der Norden zu lehren hatte, und die einzige, die seine Bewohner benötigten.
Nur dieses eine Mal hatte Schwarzklaue sich nicht daran gehalten, hatte mit dem Abbruch der Lager gewartet, weil das Wetter zu schlecht gewesen war, und nun trennten nur noch wenige Tage die ersten seines Volkes vom Tod. Der Norden kannte keine Gnade mit denen, die seine Lehren ignorierten.
»Schwarzklaue.« Neben ihm hob Einohr die Nase in die Luft. Sein Atem stand als graue Wolke vor seinem Gesicht. »Sie sind stehen geblieben.«
Schwarzklaue hielt inne und richtete sich auf. Schneeverwehungen nahmen ihm die Sicht auf die Herde, aber er roch den süßen, schweren Geruch ihrer Körper. Sie waren nicht viel weiter als einen Speerwurf entfernt von ihm.
»Sie warten auf uns«, sagte Einohr. »Sie wollen, dass wir uns ihnen stellen.«
»Nein.« Schwarzklaue schüttelte den Kopf. »Sie sind Gejagte, keine Jäger. Gejagte kämpfen nur, wenn der Jäger ihnen keinen anderen Ausweg lässt. Etwas anderes muss geschehen sein.«
Er ließ sich auf alle viere sinken und lief zu einer Schneeverwehung. Tief sank er in den nassen, weichen Schnee ein. Die letzten Tage hatte es fast ununterbrochen geschneit. Die beiden anderen Jäger folgten ihm. Sie waren noch zu jung, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, hatten gerade mal elf und dreizehn Winter gesehen. Aber sie waren stark und schnell, deshalb hatte Schwarzklaue sich für sie entschieden.
Flach legte er sich auf den Bauch, dann schob er sich langsam über den Kamm der Schneeverwehung. Der Wind blies ihm ins Gesicht. Die Schneebüffel konnten ihn und die anderen Jäger nicht riechen.
Er sah die Herde am Rand der Ebene stehen, dort, wo das nördliche und das südliche Gebirge sich trafen. Der Weg, der zwischen den schneebedeckten Ausläufern hindurchführte, war breit genug für die Herde, trotzdem folgten sie ihm nicht.
»Warum gehen sie nicht weiter?«, fragte Fleckfell leise.
Schwarzklaues Blick glitt über die Umgebung der Herde, dann zeigte er mit ausgestrecktem Arm auf einen Punkt hoch über ihren Köpfen. »Da, das Schneebrett.«
Neben ihm runzelte Fleckfell die Stirn. Er war der Jüngere der beiden. »Was ist damit?«
»Siehst du den großen Bullen dort vorn? Er hat gehört, wie der Schnee über ihm knirscht, und hat die Herde gewarnt. Vielleicht hat er schon einmal eine Lawine erlebt, vielleicht ist er nur schlauer als die anderen.«
Er stand auf. Die beiden Jungen sahen sich überrascht an. Mit einer Geste befahl Schwarzklaue ihnen, sich ebenfalls zu erheben.
»Macht Lärm, so viel Lärm, wie ihr könnt.«
Er klatschte in die Hände und begann auf die Herde zuzugehen. Die beiden anderen Jäger folgtem ihm zögernd. Er roch ihre Nervosität, ihre Angst.
»Sie werden euch nicht angreifen«, sagte er. »Sie sind Gejagte. Solange sie einen Ausweg sehen, werden sie fliehen.«
Doch sein Blick ließ den großen weißen, zotteligen Bullen nicht los. Er hatte sich umgedreht, als er den Lärm hörte. Seine Ohren waren aufgerichtet, seine beinlangen Hörner streckten sich den Lauten furchtlos entgegen. Sein Schwanz peitschte von einer Seite zur anderen.
Er zögerte, so als wüsste er nicht, welchen Weg er einschlagen sollte: den Kampf oder die Flucht.
Die Kühe und Kälber sammelten sich hinter ihm, die anderen Bullen schnauften laut und warfen unsicher die Köpfe hoch. Laut krachend schlugen ihre Hörner gegeneinander.
Schwarzklaue rief ihnen Beschimpfungen entgegen. Mit beiden Händen warf er Schnee in die Luft, versuchte vor den Tieren zu verbergen, dass es nur drei Jäger waren, die sich ihnen näherten. Die Jungen folgten seinem Beispiel. Der jüngere lachte. Schwarzklaue wies ihn nicht zurecht. Solange er Lärm machte, war es egal, ob er verstand, dass sein Leben vom Instinkt eines Bullen abhing.
Der große Bulle warf den Kopf in den Nacken und röhrte so laut und tief, dass Schwarzklaue zusammenzuckte. Er greift an, dachte er, und tatsächlich begann der Bulle mit den Vorderhufen zu scharren und Schnee aufzuwerfen.
Es krachte. Unmittelbar vor der Herde schlug ein Teil des Schneebretts auf. Der große Bulle wich zurück, die anderen nahmen sein Signal auf und stoben auseinander. Chaos brach aus. Der Lärm der Schneebüffel vermischte sich mit dem der Jäger.
Es krachte erneut, so laut und durchdringend, dass Schwarzklaue das Geräusch wie einen Schlag im Magen spürte.
Schnee rutschte von den Bergen hinab, das Brett, das sich gebildet hatte, neigte sich nach unten und brach auseinander. Eiskristalle stoben empor wie Funken bei einer Feuersbrunst. Aufgewirbelter Schnee ballte sich zusammen wie Rauch, nur um in einer gewaltigen Explosion auf Schwarzklaue und die Jäger zuzurasen. Die Erde bebte.
»Zurück!«, schrie Schwarzklaue.
Er griff nach den Jungen. Den älteren bekam er am Arm zu fassen, seine Finger glitten jedoch an dem Lederkragen des jüngeren ab. Schnee hüllte ihn plötzlich ein, drang in Augen und Mund. Seine Beine wurden ihm unter dem Körper weggerissen. Eis, so scharf wie Messerspitzen, riss seine Haut auf. Er schützte Einohr mit seinem Körper, hoffte, dass der Junge nicht unter ihm erstickte.
Alles war grau, rauschte, krachte und klirrte. Schnee drückte ihn nieder und schob ihn vor sich her. Schwarzklaue konnte nicht mehr atmen. Er spürte, wie Einohr sich unter ihm wehrte, nach ihm schlug und trat. Trotzdem hielt er ihn fest.
Ein Huf bohrte sich neben ihm in den Schnee. Hörner schaufelten Eis und Steine beiseite. Schwarzklaue blinzelte in helles Tageslicht – und riss den Kopf zur Seite, als Hufe auf ihn zu schossen, doch sie trafen nur den Schnee. Der Bulle brüllte. Schwarzklaue knurrte. Er roch die saure Angst des Tiers. Sie stachelte ihn an, brachte ihn dazu, sich mit zwei kräftigen Schlägen aus dem Schnee nach oben zu wühlen, den Jungen immer noch im Arm haltend. Er hörte Einohr keuchen und ließ ihn los.
Der Bulle sank bis zu den Knien im Schnee ein. Mit ungeschickten Sprüngen entfernte er sich, bis er schließlich auf festen Boden stieß und zu laufen begann. Schwarzklaue brüllte vor Wut, als er selbst bis zum Bauch einsank. Die Angst des Bullen und der Geruch seines eigenen Bluts machten ihn beinahe wahnsinnig. Er grub seine Krallen in den Schnee, brüllte und knurrte. Erst die Erschöpfung ließ seinen Verstand zurückkehren. Er ließ die Arme sinken und atmete tief durch.
»Ich kann Fleckfell nicht finden«, sagte Einohr mit leiser Stimme.
Schwarzklaue drehte sich zu ihm um. Das Fell des Jungen war voller Schnee, einige Stellen glänzten rötlich. Er zitterte.
Schwarzklaues Blick glitt an ihm vorbei auf die neu entstandene wilde Landschaft. Die Lawine tobte nicht mehr. Hoch aufgetürmte Schneefelder ragten wie eingefrorene Wellen vor ihm auf. Felsen steckten darin, Hörner und aufgerissene, dampfende Tierleiber. Schwarzklaue stapfte durch den Schnee darauf zu, fuhr mit der Hand durch strohiges langes Fell und fühlte nach den Rippen unter dem Fleisch.
»Morgen wird unser Volk essen«, sagte er.
»Was ist mit Fleckfell?«, fragte Einohr.
»Er steht nicht hier neben uns, also ist er tot.« Schwarzklaue riss ein Stück Fleisch aus einem Kadaver und hielt es dem Jungen hin. »Iss, solange es warm ist. Du wirst deine Kraft brauchen.«
»Ja, Schwarzklaue.« Die Stimme des Jungen war so leise, dass er kaum zu verstehen war. Tränen schimmerten in seinen Augen, aber er nahm den Fleischbrocken und biss hinein, ohne zu weinen.
»Gut so«, sagte Schwarzklaue. Er riss ein zweites Stück Fleisch heraus und aß es, schmeckte es jedoch kaum. Er hatte einen Jäger verloren, doch wahrscheinlich sein ganzes Volk gerettet. Das war der Preis, den der Norden ihm abverlangte, und er musste damit leben. Er dachte an den weißen Bullen, der alles verloren hatte, sein Volk, seine Krieger, nur nicht sein Leben.
»Ich hätte ihn töten müssen.«
Erst als Einohr »Warum?« fragte, fiel ihm auf, dass er laut gesprochen hatte.
Schwarzklaue spuckte ein Stück Knorpel aus. »Weil er beim nächsten Mal nicht mehr davonlaufen wird.«
Sie bauten einen Schlitten aus Schneebüffelhörnern, Sehnen und Haut und verluden einen Teil des ersten Kadavers darauf. Schwarzklaue spannte sich vor den Schlitten, Einohr blieb zurück, um die Beute – auf den ersten Blick waren es mehr als ein Dutzend Tiere – vor Coyoten und Raubvögeln zu schützen. Dann machte sich Schwarzklaue auf den langen Weg zum Lager.
Er erreichte es am Nachmittag des zweiten Tages, als die untergehende Sonne den Schnee bereits orange färbte. Dungfeuer schickten dünne Rauchsäulen aus dem Tal empor, die zwischen den Bergen verwehten. Jäger liefen Schwarzklaue entgegen, klopften ihm auf den Rücken und beglückwünschten ihn zu seinem Jagdglück, obwohl er die Enttäuschung über die magere Beute in ihren Augen sah.
»Es gibt noch mehr, viel mehr!«, rief er, als er sich die Halteschlaufen des Schlittens von den Schultern zog. »Morgen werden wir aufbrechen, um die Beute zu holen. Niemand wird in diesem Winter mehr hungern müssen.«
Der Jubel, den er hörte, klang ebenso begeistert wie erleichtert. Männer, Frauen, Kinder und die zwei, drei Greise, die noch nicht den Mut gefunden hatten, hinaus in den Schnee zu ziehen und nie wiederzukommen, liefen auf ihn zu, um ihm zu danken. Er zwängte sich zwischen ihnen hindurch und ging an Schneehöhlen und kleinen gegerbten Zelten vorbei, um Fleckfells Mutter vom Tod ihres Sohnes zu unterrichten. Sie dankte ihm, dann weinte sie.
»Schwarzklaue«, sagte Wolkenauge, einer der älteren Jäger, als er den schweren Fellvorhang hinter sich zufallen ließ und das Schneeloch verließ. »Jemand ist zu uns gekommen, um mit dir zu sprechen. Er wartet in deinem Zelt.«
Schwarzklaue runzelte die Stirn. »Habe ich in letzter Zeit Kinder gezeugt?«
»Ich glaube nicht, dass es darum geht. Am besten redest du selbst mit ihm.«
Wolkenauge ließ ihn stehen. Schwarzklaue ging weiter. Es war nicht ungewöhnlich, dass sein Stamm Besuch von einem anderen bekam. Er führte das größte Volk des Nordens an und zeugte die meisten Nachkommen. Früher oder später kam jeder einmal zu ihm.
Schwarzklaue stutzte, als er die Pferde sah, die mit Fellen bedeckt neben seinem Zelt angebunden waren. Es waren zwei, ein Reittier und eines, das Vorräte trug, die neben ihm an der Wand lehnten. Kein Volk des Nordens ritt auf Pferden. Man brachte sie zwar manchmal als Trophäen aus den Menschenländern des Südens mit, aber außer als Nahrung hatte man für sie keine Verwendung.
Er schob die Felle, die vor seinem Eingang hingen, zur Seite und betrat das Zelt. Es lag im Halbdunkel. Dung glühte in einer offenen Feuerstelle, und ein Topf mit Shrakh’e – vergorener Walrossmilch – stand auf einem Metallgitter dicht darüber.
Wäre der Geruch nicht gewesen, hätte Schwarzklaue den Mann, der in einen dunklen Umhang gehüllt an der Feuerstelle hockte, für einen Menschen gehalten. Er hatte Arme und Beine wie ein Mensch. Sogar seine Haut war dort, wo kurzes Haar sie nicht bedeckte, weiß und weich.
»Wer bist du?«
Der Mann drehte sich um. Sein Umhang blähte sich, brachte den Geruch des Südens mit. »Bist du Schwarzklaue?«, fragte er. Seine Stimme betonte jedes Wort, so wie die Töne einer Melodie.
»Wer sonst?«
»Dann hat mich meine Reise ans Ziel geführt.« Er streckte die Hand aus, eine menschliche Geste, die Schwarzklaue nur vage vertraut war. »Mein Name ist Mortamer Korvellan, und ich bin hier, um dir in den Krieg zu folgen, in den du uns alle führen wirst.«
Schwarzklaue sah den Fremden einen Moment lang an. Dann legte er seine Klaue um die menschlich wirkende Hand und drückte zu, bis er Blut roch. Korvellan erwiderte seinen Blick starr und ohne Reaktion. Nur die schmalen Falten in seinen Mundwinkeln schienen tiefer zu werden.
Schwarzklaue ließ los. »Erzähl mir mehr.«
Kapitel 1
In Frakknor wird dem Reisenden auffallen, dass sich kaum ein Weg ans Ufer des Großen Flusses schmiegt und keine Straße seine Nähe sucht. Niemand weiß, warum das so ist.
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Zwölf Tage waren seit ihrer Trennung von Jonan vergangen. Die ersten drei war Ana nach Norden geritten, am Fluss entlang, auf der Suche nach einem Hafen oder einer Anlegestelle. Sie hatte Fischerboote gesehen und zwei kleine Dörfer – und Milizen, viel zu viele Milizen. In Gruppen von bis zu zehn Mann, größtenteils zu Fuß und mit Speeren und Schwertern bewaffnet, waren sie die Wege entlanggezogen. Sie hatte gesehen, wie vier von ihnen einen alten Mann gehäutet und gehängt hatten. Seine Schreie hatten sie bei ihrer panischen Flucht bis tief in den Wald verfolgt.
Ana hatte sich danach abseits der Wege gehalten, war lange durch Schlamm und Unterholz geritten und hatte sich erst nach einigen Tagen wieder zurück an den Fluss gewagt. Sie hatte ihren Plan, sich nach Westfall durchzuschlagen, nicht aufgegeben. Es gab keinen anderen Ort, zu dem sie gehen konnte. Somerstorm wurde von den Nachtschatten belagert, die meisten Menschen, die sie kannte, waren bei dem Überfall auf die Festung ihres Vaters ermordet worden, ihr selbst drohte als legitime Erbin des Fürstentums der Tod.
Niemand hat uns je gemocht, dachte Ana, als sie den Umhang, der ihr nachts als Decke diente, zusammenrollte und am Sattel festband. Sie haben uns geschmeichelt, weil wir reicher und mächtiger als sie waren, weil sie Schulden bei uns hatten, weil sie hofften, ihre Kinder mit meinem Bruder oder mir zu verheiraten. Sie haben uns gehasst und gefürchtet, und das werden sie wieder tun.
Ja, vor allem sollten sie sie wieder fürchten, und Rickard, ihr Verlobter und Sohn des Fürsten von Westfall, würde dafür sorgen, dass sie dieses Ziel erreichte. Das war Anas Plan. Der Gedanke an Rickard hielt sie aufrecht, wärmte sie in den kalten Nächten. Sie dachte an ihn, wenn sie einschlief, um die Alpträume zu vertreiben, und morgens, wenn sie aufwachte, um die Kraft zum Weiterreiten zu finden. Doch manchmal, wenn Ana die Augen schloss und an Rickard dachte, sah sie nur einen grauen Fleck. Ich habe nicht vergessen, wie er aussieht, sagte sie sich dann. Ich bin nur müde.
Sie aß das Nussbrot, das sie einem Bauern am Vortag abgekauft hatte, und trank mit Essig vermischtes Wasser. Wie jeden Morgen sah sie sich auf dem Weg und zwischen den Bäumen um, bevor sie auf ihr Pferd stieg und weiter nach Süden ritt. Seit sie Jonan verlassen hatte, fühlte sie sich beobachtet. Manchmal glaubte sie, einen Schatten hinter Farnen oder im Unterholz zu sehen, und an einem Abend hatte sie den Schatten sogar angesprochen – eigentlich eher angeschrien –, bis sie erkannt hatte, dass es sich um einen abgestorbenen Baum handelte.
Der Weg, dem sie nach Süden folgte, war schmal, mehr ein Trampelpfad als eine richtige Straße. Selbst vom Pferderücken aus konnte man den Großen Fluss über die Sträucher und Bäume hinweg nicht sehen, aber wenn der Wind richtig stand, roch Ana sein süßes, erdiges Wasser und das Salz seiner Algen.
Die Gerüche waren wie ein Seil, an dem sich ihre Gedanken zurück in die Kindheit hangelten. Sie dachte an ihre Eltern, an das große Haus in Yellera, an die Boote, die manchmal tagelang hatten warten müssen, bevor ein Anlegeplatz frei geworden war, und an die endlosen Reihen der Sklaven, deren Ketten wie ein Windspiel unter ihrem Fenster geklirrt hatten. Seit Jahren hatte sie nicht mehr an Yellera gedacht, doch der Große Fluss vergaß nichts und brachte alles irgendwann zurück. Das hatte ihr Vater immer gesagt.
Sie wünschte, der Fluss würde sie zurück in die Vergangenheit, zurück nach Somerstorm tragen. Erst in den letzten Tagen war ihr klar geworden, wie glücklich sie dort gewesen war.
Auch wenn alles eine Lüge war, dachte sie, als sie sich unter einem tief hängenden Ast duckte. So wie Jonan eine Lüge war.
Ana versuchte, so wenig wie möglich an ihn zu denken. Ihr Leibwächter, ihr Begleiter, ihr einziger Freund – für all das hatte sie Jonan gehalten. Doch er hatte sie hintergangen und belogen. Rückblickend fragte sich Ana, wie ihr hatte entgehen können, dass er seine wahre Gestalt vor ihr verbarg. Keine Nacht hatte er geschlafen, hatte behauptet, er müsse über sie wachen, wo er doch in Wirklichkeit über sich selbst wachte. Im Schlaf hätte er die Kontrolle über seinen Körper verloren und sein Geheimnis offenbart.
Sie hätte erkennen müssen, dass etwas nicht stimmte, doch sie war nicht daran gewohnt, auf die zu achten, die sich um ihr Wohl kümmerten. Zuhause in Somerstorm hatte sie nur wenige Diener mit Namen gekannt. Sie hatte sich nie darüber Gedanken gemacht, ob sie Familien hatten, wie sie lebten, ob sie glücklich waren oder wenigstens zufrieden. Es war unwichtig gewesen.
Jonans Verrat hatte Ana gezeigt, dass sie auch die letzte ihrer alten Gewohnheiten ablegen musste. In diesem neuen Leben, in das die Nachtschatten sie gezwungen hatten, war es wichtig, andere genau zu beobachten und die Gründe ihres Handelns zu hinterfragen. Sie würde sich nicht noch einmal täuschen lassen.
Unerwünschte Bilder tauchten in Anas Erinnerung auf. Jonan, der sich in einen Nachtschatten verwandelt hatte. Seine Klauen, die Bäuche aufschlitzten und Kehlen zerfetzten. Er hatte ihr Leben gerettet. Doch er war ein Ungeheuer.
Ich werde nicht mehr an ihn denken, hatte sie beschlossen. Trotzdem drehte sie sich jedes Mal um, wenn ein Ast knackte.
Gegen Mittag endete der Trampelpfad in einer staubigen Straße, die von Westen kam. Graue Wolken hingen tief über dem Wald. Es sah nach Regen aus. Weit entfernt rollte Donner über die Baumwipfel. Die Vögel flogen so tief, dass manche Ana mit ihren Flügeln streiften.
»Es kommt ein Gewitter.«
Jonan, dachte Ana, doch noch während sie sich nach der Stimme umdrehte, wurde ihr klar, dass sie zu alt und weich klang.
Sie gehörte zu einem Mann mit kurz geschnittenen grauen Haaren und faltigem Gesicht. Er saß auf einem Pony, das keinen Sattel trug, nur geknotetes Zaumzeug aus alten Stricken.
Sie hatte ihn nicht gehört. Auf dem weichen Waldboden bewegte sich das Pferd beinahe lautlos.
Der Mann war groß und dünn. Er trug ein dunkles Leinenhemd und eine dunkle Stoffhose. Beides war zu kurz, und man konnte seine knochigen Gelenke sehen. Er war barfuß. Staub bedeckte ihn und sein Pony wie ein grauer Dunst. Er erinnerte Ana an die Bauern, die manchmal zur Festung gekommen waren, um ihren Vater um etwas zu bitten – eine Steuersenkung oder einen Schuldenerlass. In ihrer zusammengeliehenen, schlecht sitzenden Kleidung hatten sie versucht, würdevoll auszusehen, aber doch nur lächerlich gewirkt.
Der Mann sah sie an, schien auf eine Antwort zu warten. Seine Beine waren so lang, dass sie fast bis zum Boden reichten.
»Ja«, sagte Ana. »Es kommt wohl ein Gewitter auf.«
Er ging nicht auf ihre Antwort ein. Sein Blick musterte sie einen Moment lang, dann richtete er ihn auf einen Punkt am Horizont. In seinem langen faltigen Hals hüpfte der Adamsapfel auf und ab.
»Sie kennen dich nicht«, sagte er. »Das ist seltsam. Sie kennen eigentlich jeden.«
»Wer?«
Er schwieg. Sein Blick verlor sich in der Ferne.
»Wer kennt mich nicht?«
Sein Blick schwang zu ihr zurück und an ihr vorbei wie ein Pendel. Er grinste und zwinkerte ihr zu. »Die Toten«, sagte er. Unvermittelt verschwand das Grinsen aus seinem Gesicht. »Sie müssten dich eigentlich kennen. Du bist ja auch tot.«
Seine Worte jagten ihr einen Schauer über den Rücken.
»Nein.« Sie stieß das Wort hervor. »Ich bin nicht tot. Ich lebe.«
Er ist verrückt, dachte sie. Ihre Finger schlossen sich so fest um die Zügel, dass ihr Pferd nervös zu tänzeln begann.
»Wirklich?« Er runzelte die Stirn. Seine Augen glänzten nass, als müsse er weinen. »Das tut mir leid.«
Er wendete sein Pony und führte es tiefer ins Unterholz, weg von der Straße. »Der Regen wird dich reinigen«, rief er, ohne sich umzudrehen. »Sie mögen es nicht, wenn man schmutzig ist.«
Ana fragte nicht, was er damit meinte. Sie sah ihm nach, bis seine schaukelnde Gestalt zwischen Gestrüpp und Bäumen verschwunden war. Ihr Herzschlag wurde langsamer. Ihre verkrampften Finger lösten sich von den Zügeln.
»Nur ein Verrückter«, flüsterte sie.
Sie ritt weiter die staubige Straße entlang. Bei jedem Geräusch zuckte sie zusammen. Die Bäume zu beiden Seiten des Wegs und der Himmel über ihr schienen ein dunkles Zelt zu bilden, in dem die Luft stand.
Regentropfen, schwer und kalt wie Schnee, fielen in den Staub und auf Anas Gesicht. Sie senkte den Kopf. Sie mögen es nicht, wenn man schmutzig ist, hatte er gesagt. Die Worte kreisten durch ihre Gedanken. Wer waren sie? Die Toten? Und warum hatte er geglaubt, Ana wäre tot? Es waren die Worte eines Wahnsinnigen, trotzdem konnte sie nicht aufhören, nach ihrer Bedeutung zu suchen.
Der Regen wurde heftiger, ließ die Welt vor Anas Augen verschwimmen. Sein Rauschen schluckte alle anderen Geräusche, bis nichts mehr zu existieren schien außer ihm, ihren Gedanken und dem Pferd, auf dem sie saß.
Sie bemerkte die Hütte erst, als sie schon fast daran vorbeigeritten war.
Sie stand an einer Kreuzung, an der die Straße auf einen anderen kleineren Weg stieß, der von Norden durch den Wald führte. Einige Pferde und Ponys hatte man in einem Unterstand angebunden, ein kleines Mädchen hockte neben ihnen im Stroh, die Knie angezogen, das Kinn auf ihre verschränkten Arme gelegt. Es sah Ana desinteressiert an.
Hinter der Hütte war ein schmales Feld zu sehen. Grüne, hochgewachsene Pflanzen, die Ana nicht kannte, ließen die Blätter hängen. Einige Hühner standen unter ihnen, um sich vor dem Regen zu schützen.
Jemand hatte einen alten verrosteten Kessel an einen Baum vor der Hütte genagelt – das Zeichen für eine Taverne. Erst da bemerkte Ana, wie nass und durchgefroren sie war. Wasser lief aus den Falten ihres Umhangs, als sie abstieg und das Pferd zum Unterstand führte.
Das Mädchen stand auf und streckte die Hand aus. »Zwei Kupfermünzen, dann striegle ich dein Pferd, füttere es und passe darauf auf.«
Ana zog ihren Geldbeutel aus dem Gürtel. Sie wusste nicht, ob der Preis angemessen war. In Somerstorm hatte sie sich um so etwas nicht gekümmert, und auf ihrer Reise hatte sie Jonan das Geld verwalten lassen.
»Hier«, sagte sie und drückte dem Mädchen die zwei Münzen in die schmutzige kleine Hand.
Sie mögen es nicht, wenn man schmutzig ist, dachte sie erneut.
»Ist die Taverne geöffnet?«, fragte sie dann, während sie damit begann, ihr Pferd abzusatteln. Sie hatte gelernt, nichts von Wert in der Obhut anderer zu lassen. Eine Lektion von Jonan, die sie nicht vergessen hatte.
Das Mädchen zeigte stumm auf die Tür. Ana zog den Sattel vom Pferderücken und ging auf die Hütte zu. Über ihr blitzte es. Sie spürte den Donner in ihrem Magen.
Die Tür klemmte. Ana musste sie mit beiden Händen aufziehen. Mit dem Fuß schob sie den Sattel ins halbdunkle Innere, dann drückte sie die Tür zu und drehte sich um.
Sechs Menschen sahen sie an. Fünf von ihnen saßen auf Hockern an einem Tisch vor dem Kamin, der sechste, eine rundliche Frau mit langen grauen Haaren, stand am Kessel, der über dem Kamin hing, und rührte darin mit einem Holzlöffel. Es roch nach Fett, Bier und Rauch. Die hintere Tür war geöffnet und trug Luft und Feuchtigkeit ins Innere. Fenster gab es keine.
»Den Göttern zum Gruß«, sagte die Frau und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie war verschwitzt. Ihre Wangen waren gerötet.
»Den Göttern zum Gruß«, sagte Ana. Sie legte den Sattel neben die Habseligkeiten der anderen Gäste: Sättel, Rucksäcke, zwei Bündel mit Tierfellen, eine große Tasche voller Werkzeug und mehrere Kisten.
Einer der Gäste, ein grobschlächtig wirkender Mann mit Unterarmen, die breiter als Anas Beine waren, stand von seinem Hocker auf.
»Setz dich ans Feuer, Mädchen«, sagte er. Sein Körper wirkte zu groß für die Hütte, seine Stimme schien für weite Ebenen, nicht für enge Räume bestimmt zu sein. Auf seiner Stirn war ein Hammer tätowiert. Er war ein reisender Schmied.
»Ich will dich nicht von deinem Platz vertreiben.«
Der Mann winkte ab. »Mein Hintern fängt gleich Feuer, so warm ist er.«
Die anderen Gäste lachten. Ana sah sie an. Es waren zwei Frauen und zwei Männer, die anscheinend zusammen reisten. Das jüngere Paar wirkte so alt wie sie, das ältere fünfzehn, vielleicht zwanzig Jahre älter. Ana nahm an, dass es sich um eine Familie handelte.
»Danke«, sagte sie und legte den durchnässten Umhang ab. Darunter trug sie die Kleidung, die Jonan den toten Nachtschatten abgenommen hatte. Das Leder war so speckig und dunkel, dass die Blutflecken nicht auffielen. Dass es Männerkleidung war, würde niemanden stören. Die meisten Frauen bevorzugten auf Reisen Männerkleidung, weil sie bequemer und robuster war. Sogar Anas Mutter war auf diese Weise gereist.
Der Schmied nahm seinen Krug und setzte sich auf einen freien Hocker. »Mein Name ist übrigens Guus«, sagte er.
Der ältere der beiden anderen Männer zeigte zuerst auf sich, dann auf den Rest der Familie. »Ich bin Frek, das ist mein Mann Urek und das meine beiden Frauen Marta und Hetie.«
General Norhan, der alte Berater ihres Vaters, hatte Ana einmal von Soldaten erzählt, die sich einen Mann zu ihren Frauen nahmen, damit diese versorgt waren, sollten sie selbst ums Leben kommen. Doch Frek sah nicht wie ein Soldat aus.
»Ich bin Penya«, sagte sie. In den letzten Monaten war ihr der Name so vertraut geworden, dass sie kaum noch zögerte, wenn sie ihn nannte.
Sie setzte sich nahe an den Kamin. Die Hitze des Feuers trocknete ihr Gesicht und brannte in den Augen. Die grauhaarige Wirtin reichte ihr ein Schaffell, das sich Ana um die Schultern legte.
»Du musst im Voraus zahlen, wenn du essen und trinken willst«, sagte die Frau. Sie wirkte freundlich, aber bestimmt.
»Natürlich. Wie viel ist es?«
»Drei Kupferstücke.« Die Wirtin sah zu, wie Ana das Geld abzählte und auf den Tisch legte, dann steckte sie es in die Tasche ihrer Schürze. Es klimperte.
»Früher haben wir immer alles nachher kassiert«, sagte sie. Ihr Blick glitt über ihre Gäste, als suche sie nach Verständnis. »Aber seit mein Sohn tot ist und nur noch Cissja und ich hier leben, glauben viele, sie könnten sich einfach verdrücken, wenn es ans Bezahlen geht. Was sollen eine alte Frau und ein kleines Mädchen denn machen?«
Der Schmied nickte. »Die ganze Welt hat den Anstand verloren, und es wird mit jedem verdammten Tag schlimmer.«
Frek stützte sich mit den Ellenbogen auf den Tisch und legte den Kopf auf seine gefalteten Hände. »Bist du viel gereist in letzter Zeit?«, fragte er den Schmied.
»Mein ganzes Leben lang. Schwielen an den Händen und Schwielen am Arsch, daran erkennt man einen Schmied. Ich …« Er unterbrach sich und sah Ana und die anderen Frauen am Tisch an. »Entschuldigt meine groben Worte. Ich vergesse manchmal, dass ich nicht nur von Schmieden umgeben bin.«
Marta schüttelte den Kopf. »Uns stört das nicht«, sagte sie, als spräche sie für alle in der Taverne. Ana empfand das als unhöflich, schwieg jedoch.
»Wenn die Holzfäller kommen, dann wird hier richtig geflucht«, sagte die Wirtin, während sie dünnen Eintopf aus dem Kessel in einen Napf schaufelte und ihn Ana reichte. »Deine Worte beleidigen mich nicht.«
Der Schmied sah Ana an. Sie fühlte sich gezwungen, auf seine Entschuldigung zu reagieren, und nickte. »Bitte rede weiter.«
»Wenn ihr alle meint.« Er nahm einen Schluck Bier aus seinem Krug. »Wie schon gesagt, mein ganzes Leben bin ich gereist. Im Krieg war ich Schmied in der Armee.«
»In welcher?«, fragte Urek.
»Das spielt keine Rolle mehr. Ich will nur sagen, dass ich viel gesehen habe, aber so was wie in letzter Zeit …« Er trank noch einen Schluck und rülpste leise. »Balderick war zwar ein alter Bastard, aber bei den Göttern, ohne ihn ist es noch schlimmer geworden. Er …«
Der Name ließ Ana aufhorchen. Sie unterbrach den Schmied. »Was weißt du über Fürst Balderick?«
Marta mischte sich ein, bevor Guus antworten konnte. »Weißt du etwa nicht, was geschehen ist?« Sie hatte das Gesicht eines Truthahns und sprach hektisch und atemlos, so als könnte sie es nicht erwarten, anderen eine schlechte Nachricht zu überbringen.
Ana wollte ihr antworten, aber Marta ließ sie nicht zu Wort kommen, als hätte sie Angst, jemand könnte die Neuigkeit vor ihr verraten.
»Er ist tot. Alle sind tot. Seine ganze Armee. Abgeschlachtet. Die Nachtschatten waren es«, sagte sie zwischen kurzen Atemstößen. »Fünfzig Mann kamen zurück nach Westfall. Sie trugen Baldericks Kopf in einer Kiste bei sich. Die Leute sagen, das Gras wächst nicht mehr, dort, wo sie den Kopf vorbeigetragen haben.«
»Und die Felder liegen brach.«
Marta warf Hetie einen Blick zu, verärgert über die Unterbrechung. Die jüngere Frau senkte den Kopf.
»Was ist mit Rickard?«, fragte Ana. Sie spürte ihren Herzschlag laut und hämmernd hinter ihren Schläfen.
»Rickard?« Marta runzelte die Stirn. »Wenn er bei seinem Vater war, wird er wohl auch tot sein«, sagte sie dann. »Wie dem auch sei, Westfall ist geschlagen.«
»Ich habe gehört, dass die Fürstin den König ohne Land heiraten wird«, sagte Guus. »Und sie presst Bauern in den Militärdienst, um eine neue Armee aufzustellen.«
Ana hörte ihm kaum zu. Die Neuigkeiten drohten sie zu überwältigen. Ihr fiel auf, dass ihre Hände zitterten, und versteckte sie unter dem Schaffell.
»Und ihr wisst sicher, dass Rickard tot ist?«, fragte sie.
Frek hob die Schultern. »Ist das nicht egal? Selbst wenn er noch am Leben wäre, könnte er Westfall nicht retten. Sein Vater war ein schlechter Feldherr, und Rickard hat sein Können von ihm gelernt.«
Guus lachte. »Lass Penya doch die Hoffnung. Sie ist jung, und wie alle jungen Mädchen träumt sie davon, einen Prinzen zu heiraten. Habe ich nicht recht?«
Ana blinzelte die Tränen zurück. Sie drehte den Kopf und blickte ins Feuer, um die anderen Gäste nicht ansehen zu müssen. Wenn Rickard tatsächlich mit seinem Vater in der Schlacht gefallen war, welche Hoffnung gab es dann noch für sie? Ihr Plan hatte darin bestanden, in eine der südlichen Städte Westfalls zu gehen und Rickard einen Boten zu schicken. Niemand außer ihm hatte erfahren sollen, wo sie sich aufhielt, vor allem nicht die Fürstin. Ana schluckte. Eine seltsame Leere breitete sich in ihr aus.
Um Ana herum wurde weiter geredet und spekuliert. Sie hörte, wie sie über Fürsten diskutierten, deren Namen sie nicht einmal aussprechen konnten, und über Provinzen sprachen, an denen sie auf dem Großen Fluss einmal vorbeigefahren waren. Es waren einfache Leute, die nichts von Politik verstanden und ihre Neuigkeiten von anderen Reisenden erfuhren. Was wussten sie schon.
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen.
»Keiner von euch«, sagte sie und unterbrach damit das Gespräch, »war dabei, als die Schlacht geschlagen wurde. Keiner von euch weiß wirklich, was geschehen ist.«
Die anderen Reisenden sahen sich an. Marta schien etwas entgegnen zu wollen, aber ihr Mann legte ihr die Hand auf den Arm. »Nein«, sagte er, »keiner von uns war dabei. Wir haben diese Geschichten auf dem Weg von Norden gehört.«
»Gut.« Ana griff nach dem Löffel und begann den lauwarmen, nach Flusswasser schmeckenden Eintopf zu essen. Sie spürte, wie Hoffnung wie die Hitze des Feuers durch ihren Körper strömte. Nichts hatte sich geändert. Sie war nicht verloren, sie wusste immer noch, welches Ziel am Ende ihres Weges wartete. Alles würde so eintreten, wie sie es geplant hatte.
Diese Überzeugung, dachte sie, während neben ihr die Reisenden ihre Unterhaltung stockend wieder aufnahmen, war wohl auch der Grund dafür, dass sie keine Trauer spürte, wenn sie an Rickard dachte, und keine Sorge.
So war es bestimmt.
Kapitel 2
Dem Reisenden, der Gomeran bereist, sei ein Besuch des dortigen Klosters empfohlen. In seiner Bibliothek liegen mehr als zehntausend Schriftrollen, und sie alle beschäftigen sich mit derselben Frage: Haben die Götter den Großen Fluss erschaffen, oder hat der Große Fluss die Götter erschaffen?
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Er hatte gelacht, als sein Vater, der Fürst, ihm von den Völkern erzählt hatte, die zum Großen Fluss beteten. Wie kann man zu einem Fluss beten?, hatte er gesagt. Das ist doch nur Wasser. Sein Vater hatte gelächelt und geschwiegen. Damals hatte er das als Zustimmung gewertet, aber nun, da er auf einer Insel am Ufer des Großen Flusses saß, erkannte er, dass es das Lächeln eines Mannes gewesen war, der einem kleinen Jungen nicht hatte widersprechen wollen.
Ich hätte die Wahrheit nicht verstanden, dachte Gerit. Sein Blick glitt über das Wasser, suchte nach etwas, an dem er sich festhalten konnte, fand jedoch nichts. Der Große Fluss war nicht wie das Meer, das er von den Klippen Somerstorms gesehen hatte. Es gab keine hohen Wellen, keine Schaumkronen, keine Eisschollen, die knirschend aneinanderrieben. Da war nur Wasser, eine endlose blaue Fläche, die mit dem Horizont verschmolz und Gerits nackte Füße umspülte. Alles, was er sah, hörte, roch, berührte, schien vom Wasser geprägt zu sein. Sein süßlicher Geruch wurde vom Wind über das Land getragen. Alles schmeckte danach, der Fisch, das Wild, die Früchte. Das Rauschen des Wassers war allgegenwärtig. Manchmal glaubte Gerit zu hören, wie es die Steine glatt schliff und die Inseln, die in ihm lagen, Stück für Stück abtrug. Sogar die Menschen, die auf und mit ihm lebten, schien es zu formen. Sie waren klein und schmal, ohne die breiten Schultern und kantigen Gesichter, die Gerit von den Fischern Somerstorms kannte. Der Große Fluss glättete alles, sogar die Gedanken.
Sein Vater war tot. So wie die meisten Menschen, die auf der Burg des Fürsten, seines Vaters, gelebt hatten. Nur er hatte den Angriff der Nachtschatten überlebt. Er und seine Schwester Ana und deren Leibwächter Jonan – die ihn in Stich gelassen hatten, die ihn allein zurückgelassen hatten unter all den Nachtschatten.
Gerit erinnerte sich an die Angst, die er durchstanden hatte, an die Todesfurcht, während er sich auf der besetzten Festung vor den Nachtschatten versteckt hatte. Dann hatten sie ihn entdeckt – und ihn nicht wie erwartet umgebracht. Seitdem sah seine Welt anders aus. Inzwischen lebte er mit den Nachtschatten. Manchmal glaubte er, dass er wie sie dachte, doch in Wirklichkeit, das wusste er, verstand er sie nicht. Vielleicht verstanden sie nicht einmal sich selbst.
»Gerit?«
Er drehte den Kopf. Einer Gewohnheit folgend wollte er die Karte, die auf seinen Knien lag, in die Hosentasche stecken, doch dann strich er sie nur glatt. Er hatte keine Geheimnisse mehr.
»Ja?«
»Weißt du, wo Korvellan ist? Einer der Schreiner sucht ihn.«
Sommerwind ging barfuß über Sand und kleine Steine. Wenn sie mit Gerit sprach, nahm sie meistens menschliche Gestalt an. Sie hatte eine helle Haut und langes dunkelblondes Haar. Gerit schätzte, dass sie ungefähr so alt wie er war. Er hatte sie nach ihrem Alter gefragt, aber sie wusste es nicht genau. Oben im Norden, wo sie gelebt hatte, zählte man weder die Winter noch die Sommer. Gerit fand es seltsam, das eigene Alter nicht zu wissen, fast so, als kenne man den eigenen Namen nicht.
»Nein«, sagte er. »Ich habe ihn seit dem Morgenmahl nicht gesehen.«
»Dann muss der Schmied ihn wohl selbst suchen.« Sommerwind blieb neben Gerit stehen. Er wollte von dem Stein aufstehen, um ihr seinen Platz anzubieten, aber sie winkte ab, als er dazu ansetzte.
»Bleib ruhig sitzen. Der Stein ist groß genug für uns beide.«
Gerit rutschte so weit zur Seite, wie es ging. Sommerwind setzte sich neben ihn. Ihre Hüfte drückte gegen sein Bein, ihre Schulter gegen seinen Arm. Er roch das Wasser des Großen Flusses in ihrem Haar.
»Was hast du da?«, fragte sie.
»Eine Karte.« Gerit betrachtete das Pergament. Es fiel ihm schwer, sich darauf zu konzentrieren. »Korvellan hat sie mir gegeben, damit ich immer sehen kann, wo wir gerade sind.«
Sommerwind beugte sich vor. Die Haare fielen ihr ins Gesicht. Sie strich sie zurück und runzelte die Stirn. »Wie denn?«
»Siehst du diese Linien? Das sind die Grenzen der Provinzen. Die Häuser zeigen an, wo es Städte gibt, die Zeichen daneben, welchen Namen sie tragen. Da oben, das ist Somerstorm.«
»Und wo sind wir?«
Er zeigte auf einen kleinen Kreis mitten im Großen Fluss. »Hier.«
»Woher willst du das wissen? Das sind doch nur Zeichen, die jemand aufgemalt hat.« Sie hob den Kopf. Ihr Gesicht war ernst, fast schon feierlich. »Oder ist das Magie?«
Gerit lachte laut. »Was ist das denn für eine Frage? Es …«
Er unterbrach sich, als Sommerwind plötzlich aufstand und sich abwandte. »Lach mich nicht aus.«
»Das tue ich nicht.« Rasch faltete er die Karte zusammen, steckte sie in die Tasche und sprang auf. Die Wärme, die ihr Körper hinterlassen hatte, verschwand. »Sommerwind, warte.«
»Warum? Damit du noch mehr über mich lachen kannst?« Sommerwind stapfte durch den Sand, dem Lager entgegen, dessen Rauchfahnen hinter einem Hügel aufstiegen.
Gerit folgte ihr. »Das war doch nicht so gemeint«, rief er ihr nach. »Es tut mir leid.«
Sie blieb stehen. Er holte zu ihr auf und ergriff ihre Hand, ohne darüber nachzudenken. Sommerwind entzog sich seinem Griff. Peinlich berührt steckte er seine Hände in die Taschen.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte er dann. »Das war eine sehr dumme Bemerkung.«
»Ja.« Sommerwind atmete tief durch. »Dümmer als die Frage?«
»Viel dümmer.«
»Gut.«
Gerit wollte wissen, ob damit alles vergessen sei, schluckte die Frage jedoch hinunter. Es galt als ein Zeichen von Stärke, sich für seine Fehler zu entschuldigen. Einen anderen durch die Bitte um Vergebung unter Druck zu setzen, war jedoch unhöflich. Das hatte er von den Nachtschatten gelernt, und er bemühte sich, danach zu handeln.
»Ich will mir die blöde Karte nicht mehr ansehen«, sagte Sommerwind nach einem Moment. »Komm, wir gehen am Strand entlang. Vielleicht finden wir ja ein paar Möweneier.«
»Ich wette, ich finde mehr als du.«
»Träum weiter.« Sommerwind lief los. Selbst in ihrer Menschengestalt bewegte sie sich schneller und geschmeidiger als er. Doch Gerit ließ sich auch absichtlich zurückfallen. Er folgte ihr mit seinen Blicken. Sie lief zwischen den dornigen Sträuchern und Büschen am Ufer entlang, zog sie auseinander und suchte nach Nestern, so als hätte sie die Auseinandersetzung mit ihm bereits vergessen. Auch das war etwas, was Gerit bei den Nachtschatten aus dem Norden aufgefallen war: Wenn sie etwas taten, konzentrierten sie sich vollständig darauf. Selbst die, die wie Sommerwind auch menschliches Blut in sich hatten, verhielten sich so. Vielleicht, so dachte er, während er Sommerwind zusah, zwang der Norden seine Bewohner dazu, allem, was sie taten, ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen. Gerit konnte sich kaum vorstellen, dass jemand im ewigen Eis leben konnte. Selbst die Karte, die er in seiner Hosentasche spürte, endete an Somerstorms nördlicher Grenze.
»Gerit.«
Die Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Er hatte Sommerwind betrachtet, ohne sie wirklich zu sehen. Er bemerkte, dass sie zwei Möweneier in der Armbeuge trug und hinter einigen hohen Sträuchern hockte. »Gerit«, sagte sie erneut. »Komm her.«
Mit dem freien Arm winkte sie ihn heran, bedeutete ihm gleichzeitig, sich zu ducken. Er tat, was sie wollte, ging sogar auf Hände und Knie, als er die Sträucher erreichte.
»Was ist los?«, flüsterte er.
Sommerwind antwortete nicht, zeigte nur durch die Blätter und Dornen zum Fluss. »Ich glaube, sie streiten«, sagte sie leise.
Die beiden Nachtschatten, auf die sie zeigte, standen weniger als einen Steinwurf entfernt zwischen Algen und Treibholz am Ufer des Flusses. Einer von ihnen hatte seine Tiergestalt angenommen, der andere sah aus wie ein Mensch, und Gerit erkannte sofort, dass er verärgert war. Er kannte Korvellan lange genug. Seine Hand tastete beinahe unwillkürlich nach der Narbe auf seiner Wange. Ja, er kannte ihn.
»… keine Disziplin«, sagte Korvellan. »Wir haben fast fünfzig Soldaten auf dem Weg hierher verloren.«
»Es sind keine Soldaten, es sind Krieger.« Schwarzklaue war mehr als einen Kopf größer als Korvellan, trotzdem schien er ihn nicht zu überragen. »Sie ziehen mit uns, weil sie es so wollen.«
»Und irgendwann wollen sie es nicht mehr?« Korvellan schüttelte missbilligend den Kopf. »Wie sollen wir siegen, wenn wir nicht sicher sein können, dass die Armee, die heute mit uns marschiert, morgen noch da ist?«
»Siegen?« Schwarzklaue knurrte so tief, dass Gerit das Geräusch in seinem Bauch spürte. »Hast du überhaupt den Mumm dazu?«
»Was soll das heißen?«
Sommerwind legte Gerit die Hand auf den Arm. »Komm, wir gehen«, flüsterte sie. »Das geht uns nichts an.«
»Du kannst gehen. Ich will das hören.«
Ihre Hand rutschte von seinem Arm, aber sie stand nicht auf. Am Ufer begann Schwarzklaue auf und ab zu gehen. Muskeln zeichneten sich bei jeder Bewegung unter seinem Fell ab.
»Wir marschieren und verhandeln und marschieren!«, brüllte er plötzlich. Einige Vögel flatterten erschrocken aus den Sträuchern auf. Korvellan trat einen Schritt zurück, Gerit wusste nicht, ob aus Überraschung oder Furcht. »Du führst uns zu Städten, vor deren Toren die Bäume stehen, an denen sie uns gehängt haben. Wir sollten ihre Mauern einreißen und ihre Häuser niederbrennen, bis nichts mehr an sie erinnert, aber was tust du?« Er hob die Arme. Die Krallen an seinen Händen krümmten sich, als wollten sie etwas zerreißen. »Du redest mit den Menschen. Du beruhigst sie. Du schenkst ihnen Gold, damit sie Saatgut kaufen können. Was für ein General bist du?«
»Einer, der dir den Rücken freihält.« Korvellan fuhr sich mit der Hand über die Augen. Er wirkte auf einmal müde. »Gehen die Krieger deshalb? Glauben sie, ich wäre zu feige für den Kampf?«
Seine Ruhe schien sich auf Schwarzklaue zu übertragen. Er ließ die Arme sinken. »Nein. Sie glauben, du bist zu sehr Mensch. Ich sage ihnen, dass das nicht stimmt, aber wenn sie Fragen stellen, habe ich keine Antworten.«
»Was für Fragen?«
Schwarzklaue stieß den Atem aus. Gerit wusste, dass er lange Unterhaltungen nicht mochte. »Warum wir die verschonen, die uns hassen.«
»Weil Menschen, die noch etwas zu verlieren haben, keine Aufstände anzetteln. Nimm ihnen alles, und du wirst ganze Armeen brauchen, um sie im Zaum zu halten.«
»Nicht, wenn man ihnen das Leben nimmt«, sagte Schwarzklaue. »Das verstehen die Krieger nicht. In Somerstorm brauchten wir Menschen für die Minen. Kein Nachtschatten würde wie ein Wurm in der Erde herumkriechen, Menschen schon. Aber wieso sie hier verschonen? Wem nutzt das?«
Seine letzten Worte gingen in schrillen Vogelrufen unter. Gerit sah in den Himmel. Eine Handvoll Möwen kreisten über seinem Kopf. Sie wirkten aufgeregt. Weißer Kot tropfte auf die Blätter der Sträucher.
»Was antwortest du ihnen?«, fragte Korvellan.
»Dass ich dir vertraue, dass du uns bis hierher geführt hast, ohne Schwäche zu zeigen.«
Gerit stieß Sommerwind an und deutete mit dem Kinn nach oben. »Die Möwen«, flüsterte er.
»Was ist mit den …« Sie ließ den Satz unvollendet in der Luft hängen. Ihr Blick fiel auf die Eier in ihrer Armbeuge. »Die gehören jetzt mir.«
»Das sagst du ihnen wirklich?« Gerit hörte das Lächeln in Korvellans Stimme. Er glaubte Schwarzklaue nicht.
»Ja, und weißt du, was sie mich dann fragen?« Schwarzklaue sah zum Himmel. Die Möwen schrien lauter. »Sie fragen, warum du den Jungen mitschleppst.«
Gerit zuckte zusammen.
»Der Junge hat keine Bedeutung«, sagte Korvellan.
»Dann töte ihn.«
Sommerwind musterte Gerit aus den Augenwinkeln. Über ihnen schrien die Möwen. Einige flogen auf die Sträucher zu, drehten aber wieder ab.
Korvellan schüttelte den Kopf. Gerit spürte Erleichterung.
»Lass mich ausreden«, sagte Korvellan dann. »Der Junge hat keine Bedeutung für mich, aber er ist der einzige männliche Nachkomme der Somerstorms. Wir brauchen ihn für die Allianzen, die wir bald schmieden werden.«
Gerit schmeckte Blut. Er hatte sich auf die Lippe gebissen, ohne es zu bemerken.
Korvellan trat einen Schritt auf Schwarzklaue zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Geduld, mein Freund. Wir können nicht die ganze Menschheit in einem einzigen Sommer besiegen. Wir werden langsam vorgehen, eine Provinz nach der anderen. Die reichen besiegen wir, die armen bestechen wir. Wir werden den Menschen schmeicheln, sie vor den Deserteuren, die schon bald über das Land ziehen werden, beschützen, ihre Taschen mit Gold vollstopfen, bis sie uns in ihren Häusern willkommen heißen, uns aus ihren Töpfen essen lassen und zusehen, während wir es mit ihren Töchtern treiben. Dann werden wir sie vernichten.«
Schwarzklaue lachte. »Treiben und töten. Das ist gut. Wann …«
Er unterbrach sich, als Korvellan die Hand von seiner Schulter nahm und warnend hob. Sein Blick glitt zu den kreischenden Möwen empor. »Etwas stimmt nicht.«
Sommerwind zog Gerit am Ärmel. Er ließ sich mitziehen, folgte ihr halb auf allen vieren kriechend, halb laufend. Die Möwen folgten ihnen.
»Weg mit den Eiern!«, zischte Gerit. Sommerwind ließ sie fallen. Eines rollte durch den Sand, das andere zerbrach an einem Stein.
Gerit folgte Sommerwind, stolperte auf einige hohe Sträucher zu, die ihm als gutes Versteck erschien. Die Möwen blieben zurück. Ihre Schreie klangen wie das Weinen alter Frauen.
Er sah zum Fluss, als sie die Sträucher erreicht hatten. Weder Korvellan noch Schwarzklaue folgte ihnen. Zwei Möwen waren im Sand gelandet. Die anderen kreisten über ihnen. Gerit sah weg.
Sie liefen weiter bis zum Lager, tauchten in dem Wirrwarr aus Zelten, Karren, Nachtschatten und Pferden unter.
»Meinst du, sie haben uns gerochen?«, fragte Sommerwind, als sie vor ihrem Zelt stehen blieben.
»Ich weiß es nicht.« Gerit wollte nicht darüber nachdenken. Sein Kopf fühlte sich taub an, so als hätte man ihn aus einem tiefen Schlaf gerissen.
»Korvellan hat es bestimmt nicht so gemeint«, sagte Sommerwind nach einem Moment. »Er mag dich.«
»Ist mir egal, ob er mich mag.« Gerit verschränkte die Arme vor der Brust und hob das Kinn. »Er braucht mich. Das ist viel wichtiger.«
»Und was er über die Menschen gesagt hat …«
Er schüttelte den Kopf. »Ist mir auch egal. Kein Mensch hat mir geholfen, als ihr kamt. Das war ich ganz allein.« Der Gedanke fühlte sich gut an. »Ich komme schon klar.«
»Wenn du meinst.« Sommerwind klang zweifelnd.
Gerit wandte sich ab. »Und es ist mir erst recht egal, was du denkst«, sagte er und ließ sie stehen.
Er ging zwischen den Zelten hindurch, wartete darauf, ihre Hand auf seinem Rücken zu spüren oder ihre Schritte neben den seinen zu hören. Aber sie folgte ihm nicht.
Er hob die Schultern. Und wenn schon, dachte er.
Kapitel 3
Gewarnt sei der Reisende vor den Übertreibungen, zu denen viele seiner Weggefährten neigen. So könnten sie ihm glauben machen, das Volk von Frakknor bestünde nur aus Wegelagerern, Dieben und Halsabschneidern. Obwohl dies nicht stimmt, sei vom Besuch der Provinz Frakknor abgeraten, denn ihr schlechter Ruf hat die Einheimischen mürrisch und misstrauisch gemacht.
Jonaddyn Flerr, Die Fürstentümer und Provinzen der vier Königreiche, Band 2
Es regnete die ganze Nacht. Erst am Morgen ließ das Plätschern des Wassers nach. Als das erste Tageslicht unter der Tür durchschimmerte, legte Ana das Schaffell beiseite, das ihr als Decke gedient hatte, und stand auf.
Alle Gäste hatten unter Fellen und Decken in der Hütte übernachtet. Am Abend waren noch zwei alte Männer hinzugekommen, ehemalige Sklaven, denen ihr Herr die Freiheit geschenkt hatte und die ohne Zuhause und ohne Geld durch das Land zogen. Sie waren auf dem Weg zum Sklavenmarkt von Srzanizar, in der Hoffnung, dass sie dort jemand kaufen würde. Aus Mitleid hatte Guus, der Schmied, ihnen die Übernachtung in der Hütte bezahlt.
Ana verließ die Hütte durch die offene Hintertür. Es war heller, als sie gedacht hatte. Sie blinzelte in den wolkenverhangenen Morgen und gähnte.
»Eine Regentonne steht links von dir, falls du dich säubern möchtest«, sagte Ruta.
Ana zuckte zusammen. Die Wirtin hatte hinter einigen der mannshohen Pflanzen auf dem Feld gestanden und war nicht zu sehen gewesen. Nun trat sie zwischen den langen Blättern hervor. In einer Hand hielt sie einen Korb mit roten Schoten, in der anderen ein langes Messer.
»Für das Morgenmahl«, sagte sie. »Rotaugenschoten. Wer danach nicht aufwacht, ist tot.«
Ana ließ das Messer nicht aus den Augen. Es war alt und verrostet. Die Spitze der Klinge war abgebrochen.
»Hier in der Gegend«, fuhr die Wirtin fort, »legt man den frisch Verstorbenen Rotaugenschoten in den Mund, damit man sicher sein kann, dass sie auch wirklich tot sind. Hast du das gewusst?«
»Nein.«
»Wie auch, du bist ja nicht aus dieser Gegend.« Ruta rammte das Messer in einen Baumstumpf. Die Spannung wich von Ana.
»Nein«, antwortete sie mit der Geschichte, die sie einstudiert hatte, »ich bin aus Ashanar. Der Mann, dem ich versprochen wurde, hat einen Hof in Gomeran. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Eigentlich sollten meine Brüder mich begleiten, aber der Fürst hat sie gezwungen, Soldaten zu werden.«
Die Wirtin stellte ihren Korb neben der Regentonne ab und begann die Schoten zu waschen. »Dann solltest du den Flussgöttern dafür danken, dass sie dich zu dieser Taverne und zu solch freundlichen Mitreisenden geführt haben. Es ist gefährlich hier im Süden, vor allem in letzter Zeit. Man weiß nie, wem man begegnet.«
»Das habe ich gemerkt.« Ana nahm eine der fingerlangen Schoten aus dem Korb. Sie war erstaunlich schwer und verströmte einen beißenden Geruch, der zum Niesen reizte. »Da war so ein seltsamer Mann gestern im Wald.«
Ruta sah sie von der Seite an. »Saß er auf einem kleinen Pferd und trug feine Kleidung?«
»Nun, er …« Ana musste sich erst ins Gedächtnis zurückrufen, dass die schäbigen Klamotten, die der Alte getragen hatte, bei der elenden Landbevölkerung als »feine Kleidung« durchgingen. Doch bevor sie noch etwas sagen konnte, ergriff die Wirtin wieder das Wort.
»Hast du mit ihm gesprochen?« Die Frage klang beiläufig, aber etwas Lauerndes schwang darin mit, das Ana aufhorchen ließ.
»Nein«, sagte sie. »Das habe ich nicht.«
»Kein Wort?«
»Nein. Er hat mich nicht beachtet.«
Die Wirtin nahm ihr die Schote aus der Hand. »Die Götter meinen es wirklich gut mit dir.«
»Wieso, ist er gefährlich?«, fragte Ana. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Guus das Haus verließ. Er nickte ihr kurz zu, dann ging er zu den Bäumen am Rand des Feldes.
»Nein … ja.« Ruta zögerte, suchte sichtlich nach den richtigen Worten. »Er sieht die Welt nicht wie wir. Du und ich sind nicht da für ihn, nur die, denen die Götter bereits ihr Totenmal auf die Stirn gezeichnet haben. Mit ihnen kann er sprechen. Das geht schon seit einigen Jahren so.«
Ana hörte den Schmied pfeifen, während er sein Morgengeschäft verrichtete. »Heißt das, dass alle, mit denen er spricht, sterben müssen?« Ihr Mund war so trocken, dass sie die Frage kaum aussprechen konnte.
»Die Götter entscheiden, wer stirbt und wer lebt, niemand sonst. Savver ist ihnen nur näher als die meisten.«
Ruta nahm den Korb und zog das Messer aus dem Baumstumpf. »Komm«, sagte sie, »das Morgenmahl ist gleich fertig. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr Srzanizar noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollt.«
Das ist nur Aberglaube, dachte Ana. Es hat nichts zu bedeuten.
Sie hakte die Daumen ineinander und klatschte dreimal in die Hände, um die bösen Geister zu vertreiben, so wie ihre Zofe Zrenje es ihr als Kind gezeigt hatte. Danach fühlte sie sich besser.
In der Hütte hatten die anderen Reisenden begonnen zu packen. Die Vordertür stand offen, die meisten Pferde waren gesattelt und beladen worden, zwei von ihnen hatte man bereits vor einen Karren gespannt, dessen Ladung aus Kisten und Fellbündeln unter einer Decke hervorragte.
Urek stocherte mit seinem Kurzschwert in dem niedergebrannten Kaminfeuer. Flammen leckten an frischem Holz, Funken stoben.
»Es ist noch Eintopf da«, sagte er, aber niemand beachtete ihn.
Schweigend nahmen sie das Morgenmahl ein. Es bestand aus Brot, Schmalz und Rotaugenschoten. Ana tränten bereits nach dem ersten Bissen die Augen, aber sie aß weiter, wie alle anderen auch.
»Schärfe reinigt die Seele«, hörte sie Ruta sagen. »Und einer reinen Seele ist das Glück wohlgesonnen.«
Sie mögen es nicht, wenn man schmutzig ist. Der Satz stand ungewollt in Anas Gedanken. Ohne zu kauen schluckte sie den Rest der Schote hinunter und leerte ihren Krug mit dünnem Bier.
Wenig später brachen sie auf.
Magrik und Theul, die beiden alten Sklaven, waren die Einzigen, die kein Reittier hatten, aber Frek ließ sie auf seinem Karren mitfahren, was zu einem kurzen Streit zwischen ihm und Marta führte. Dann endlich ließen sie die Taverne hinter sich.
Der nächtliche Regen hatte die Straße in Schlamm verwandelt. Bei jedem Tritt der Pferde spritzte es nach oben, die Räder des Karrens gruben sich so tief ein, dass es einige Male fast so aussah, als müsse man die Waren abladen, um ihn aus dem Schlamm zu befreien.
Gegen Mittag lösten sich die letzten Wolken auf. Sonnenstrahlen begannen die Straße zu trocknen.
»Wurde auch verdammt noch mal Zeit«, sagte Guus wenig später, als der Karren wieder über festen Boden rollte. Seine Stimme riss Ana aus dem Halbschlaf, in dem sie die letzten Stunden verbracht hatte. Sie wusste nicht, wie weit sie gekommen waren, aber es konnte nicht sehr weit sein. Der Karren hielt die Gruppe auf.
Allein wäre ich viel schneller, dachte Ana, doch sie schreckte davor zurück, die anderen zu verlassen. Zu gefährlich musste die Gegend, durch die sie zogen, sein, wenn sogar der Schmied die Gemeinschaft mit anderen suchte – und zu sehr beschäftigten sie die Worte des Wahnsinnigen.
Sie sah auf, als Hetie ihr Pferd neben das ihre lenkte.
»Kommst du von weither?«, fragte sie, ohne Ana anzusehen.
»Zwölf Tagesreisen.« Es war das erste Gespräch, das sie miteinander führten.
»Und du warst die ganze Zeit allein?«
Ja, dachte Ana. Ich war allein, auch wenn jemand bei mir war. Und ich werde immer allein sein, weil es so sein muss, wenn man herrschen will.
»Das war ich«, antwortete sie und fühlte sich auf einmal sehr erwachsen, viel erwachsener als das Mädchen, das neben ihr ritt und sie noch nicht einmal anzusehen wagte.
»Ich war noch nie allein«, sagte Hetie, »und ich bin auch noch nie gereist.«
In ihrer Stimme schwang Sehnsucht mit, so als wartete alles, was sie sich erträumt hatte, an einem fernen Ort auf sie.
»Aber jetzt reist du doch?«
Hetie sah sich nach dem Rest ihrer Familie um. »Das ist nicht dasselbe«, sagte sie leise. »Du reist zu dem Mann, dem du versprochen wurdest, aber wenn du nicht zu ihm wolltest, könntest du einfach an einen anderen Ort gehen, nicht wahr? Niemand würde dich aufhalten.«
»So einfach ist das nicht«, antwortete Ana, obwohl sich ein Teil von ihr fragte, ob es nicht tatsächlich so war. Sie wechselte das Thema. »Wo reist ihr denn hin?«
»Nach Srzanizar und von dort in die südlichen Steppen. Frek ist Pelzjäger, aber seit die Milizen überall durch die Wälder ziehen, findet er kein Wild mehr. Deshalb gehen wir nach Süden.«
»Dann wirst du viel Neues erleben«, sagte Ana, um sie ein wenig aufzumuntern. »Im Süden soll es Tiere so groß wie Berge geben und Fische, die über das Wasser fliegen. Du wirst gar nicht wissen, was du dir zuerst ansehen sollst.«
»Ich werde nichts sehen außer dem Kochtopf und dem Waschzuber.« Hetie senkte erneut den Kopf. »Das ist mein Schicksal als zweite Frau.«
Ana wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. »Du …«, begann sie, doch im gleichen Moment zischte etwas an ihrem Kopf vorbei. Erschrocken zuckte sie zusammen.
Guus schrie. Ana fuhr herum, starrte entsetzt auf den Bolzen, der aus seinem Auge ragte. Er hatte den Schädel durchschlagen. Die Metallspitze war am Hinterkopf ausgetreten. Blut lief seinen Nacken hinab.
Sein Pferd stieg in Panik auf und galoppierte den Weg entlang. Er blieb darauf sitzen, schlaksig wie eine Stoffpuppe. Ana gelang es erst, den Blick von ihm zu lösen, als er hinter einer Biegung verschwand.
Das dumpfe Katapultgeräusch von Armbrustbolzen hallte durch die Bäume.
»Rettet euch!«, schrie einer der beiden alten Männer. Sein Begleiter lag auf dem Karren und wand sich schreiend. Ein Bolzen steckte in seiner Seite.
»Weg hier!« Ana drehte sich zu Hetie um. Sie hatte die Hände vor ihr Gesicht geschlagen und zitterte. Ana griff nach den Zügeln ihres Pferdes. »Halt dich fest!«
Dann trat sie ihrem eigenen Pferd in die Flanken. Erschrocken galoppierte es los. Die Zügel, die Ana in der Hand hielt, strafften sich; einen Augenblick fürchtete sie, das zweite Pferd würde dem Zug nicht nachgeben, dann lockerten sich die Zügel.