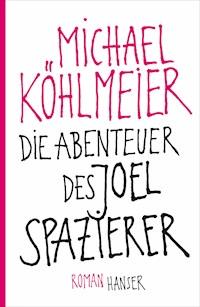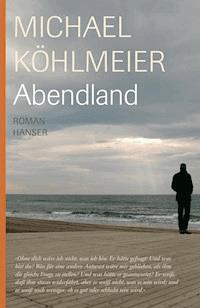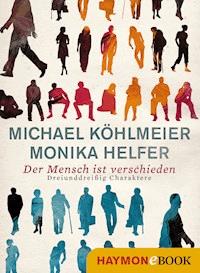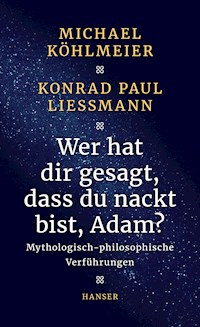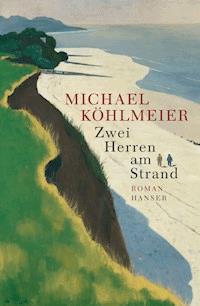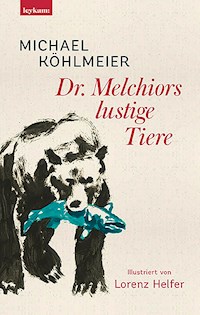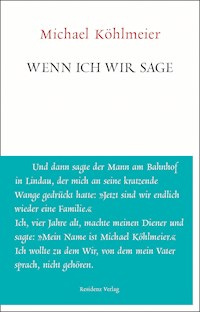Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HAYMON schwärmt
- Sprache: Deutsch
Mehr als ein Liebesbekenntnis: Michael Köhlmeier über die Faszination der Märchen. Lieben Sie Märchen? Dann lieben Sie dieses Buch Michael Köhlmeiers Erzählerstimme ist hierzulande untrennbar mit den Stoffen der Märchen verknüpft, seine Nacherzählungen sind legendär und gehören längst selbst zum Kanon der großen Märchenliteratur. Nicht weniger geschätzt ist Köhlmeier für seine eigenen Erzählungen und Romane, darunter "Sunrise", "Abendland", "Die Abenteuer des Joel Spazierer" oder zuletzt "Der Mann, der Verlorenes wiederfindet". Dass seine Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, mit den Märchen der Brüder Grimm begann, verrät er nun in diesem Buch. Mit Michael Köhlmeier das Geheimnis der Märchen ergründen In seiner unverwechselbaren Tonart lässt Köhlmeier uns teilhaben an seiner Faszination für das Genre der Märchen und verfällt dabei selbst ins Erzählen: Er schildert Episoden aus Kindheit, Jugend und Studienjahren, er schreibt von seiner Märchen erzählenden Großmutter und dem geschichtsbesessenen Vater, vom Aufkeimen seiner Liebe zu den Märchen und Mythen, von der Bewunderung für die Brüder Grimm - und dringt dabei tief ins rätselhafte Herz der Märchen vor. Bezauberndes Geschenkbuch in bibliophiler Ausstattung Ein intimes, reichhaltiges und wunderbar beglückendes Porträt eines Geschichtenerzählers und seiner Leidenschaft als Auftakt der neuen Reihe HAYMON schwärmt. Bibliophil ausgestattet, ist dieses Buch das perfekte Geschenkbuch für jeden, in dessen Leben Fantasie und Geschichten einen besonderen Platz haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHAEL KÖHLMEIER
Von den Märchen
HAYMON
so oft aber ich nunmehr dasmärchenbuch zur hand nehme,rührt und bewegt es mich,denn auf allen blättern steht vormir sein bild und ich erkenneseine waltende spur.
JACOB GRIMM AM ENDEDER REDE AUF SEINEN TOTENBRUDER WILHELM
Inhalt
Cover
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Der Autor
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
1
Märchen sind die Primzahlen der Literatur, und mein erstes Märchen war Herr Korbes.
Dabei hat mir meine Großmutter die Geschichte nicht aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm vorgelesen, wir besaßen zwar, wie die meisten Haushalte, eine Ausgabe, sondern sie hat sie mir mit ihren eigenen Worten erzählt. Sie hielt sich dabei noch knapper als die Grimms; in der Sammlung ist es eines der kürzesten Märchen. Die Begebenheiten beunruhigen mich bis heute.
Hähnchen und Hühnchen spannen die Mäuschen vor den Wagen, sie wollen hinaus zu des Herrn Korbes seinem Haus. Unterwegs treffen sie auf die Katze, auch sie will zum Herrn Korbes. Dann steigt noch das Ei zu und die Ente und die Nähnadel und die Stecknadel und zum Schluss der Mühlstein. Herr Korbes ist nicht zu Hause. Hähnchen und Hühnchen verstecken den Wagen in der Scheune, die Katze verkriecht sich im Kamin, die Ente wartet in der Küche beim Wasserhahn, das Ei wickelt sich in das Handtuch, die Nähnadel schlüpft in das Sitzkissen, die Stecknadel ins Kopfkissen. Der Mühlstein aber wuchtet sich hinauf auf den Türstock. Endlich kommt Herr Korbes heim. Er möchte im Kamin Feuer machen, da wirft ihm die Katze Asche in die Augen. Er eilt in die Küche, um sich mit dem Handtuch abzuwischen, da spritzt ihm die Ente Wasser ins Gesicht, und das Ei zerbricht und verklebt ihm die Augen. Verwirrt setzt er sich auf den Stuhl, da sticht ihn die Nähnadel in den Hintern. Er weint und wirft sich aufs Bett, da sticht ihn die Stecknadel in den Kopf. Er läuft aus dem Haus, der Mühlstein fällt vom Türstock und schlägt den Mann tot.
Meine Großmutter schnitt weiter an ihren Fingernägeln oder fädelte weiter ihren Faden ein oder formte die Wolle, die ich zwischen meinen Händen straffte, zu einer Kugel, und das Totschlagen eines Mannes durch einen Mühlstein war ihr keines Kommentars wert – auf diese Weise sind mir Märchen erzählt worden: unaufgeregt, unbeteiligt, mit gleichgültiger Stimme, undramatisch, ohne jeden Versuch, meine Gefühle zu lenken, sei es durch Modulation oder Mimik oder Gestik. Meiner Großmutter kam gar nicht der Gedanke, ihre Geschichte zu deuten, also kam mir dieser Gedanke auch nicht. Manchmal sah sie mich bei ihrem letzten Wort an, und mir schien, als denke sie an etwas ganz anderes.
2
Wie gehen wir vor, wenn wir eine Sache deuten? Wir vergleichen sie mit einer anderen Sache. Wir stellen eine Beziehung her. So entsteht Sinn. Wir betten eine Sache in ein Netz von Beziehungen ein, in dessen Mitte – wie die Spinne – wir sitzen. Wir formulieren Fragen und beantworten sie. Eigentlich: Wir konstruieren eine Antwort, suchen dazu die entsprechende Frage und behaupten die umgekehrte Reihenfolge. Warum tun sich Dinge und Tiere zusammen, um einem Menschen zu schaden? Aber wir denken uns nicht willkürlich etwas aus; wir borgen – wir suchen nach ähnlichen Fällen und borgen uns von dort die Deutungen. Wir greifen zurück auf einen Katalog von Präzedenzfällen, den wir uns angelegt haben – »wir« meint die gesamte Kulturgeschichte. Wie anders sollen wir die systematische Misshandlung und Ermordung eines Mannes, über den wir gar nichts erfahren, deuten, als dass wir Informationen hinzufügen, auf die in keiner Weise aus der Geschichte geschlossen werden kann? Irgendetwas muss in der Vergangenheit des Herrn Korbes passiert sein, was diesen Feldzug von Tieren und Dingen rechtfertigt. Vielleicht hat der Herr Korbes irgendwann Hühnchen und Hähnchen ein Leid angetan? Vielleicht hat er die Jungen der Katze ersäuft? Vielleicht hat er Nähnadel und Stecknadel verrosten oder deren Verwandtschaft liederlich irgendwo liegen lassen? Vielleicht ist der Herr Korbes ein Steinmetz, und der Mühlstein hat ihm nicht verziehen, dass er ihn einst aus einem Fels herausgehauen hat? Es lässt sich immer ein Motiv finden, warum jemand geschlagen werden soll.
So eine Vorgehensweise beruhigt uns – aber doch nur scheinbar. Wir zwingen der Geschichte eine Deutung auf, und wir wissen das. Das Märchen selbst bietet uns dafür keinen Anhaltspunkt. Märchen sind tautologisch, sie verweisen auf nichts anderes als auf sich selbst. Anders als in den großen Mythen der Griechen, in denen über ein Netz von Verwandtschaften eine Geschichte mit vielen anderen, eine Person mit vielen anderen verbunden ist, sind Hänsel und Gretel mit Dornröschen weder verwandt noch verschwägert, auch nicht über hundert Ecken hinweg. Hans im Glück kennt Hans mein Igel nicht; Schneewittchen ist Dornröschen nie begegnet, sie hätten einander nie begegnen können. Märchen sind stumm. Sie wehren sich weder gegen Missbrauch, noch bieten sie sich an, zu welchem Gebrauch auch immer.
Das alles meinte ich zu wissen, lange bevor ich die Begriffe kannte. Märchen stehen mit nichts in Beziehung, was mich umgibt; will ich in sie eintauchen, muss ich das Meine aufgeben und das Ihre annehmen, und manchmal ist das dem Märchen Eigene eine Teufelshaut, in die ein Mensch nicht hineinpasst. Ich habe mich nie mit einer Märchenfigur identifiziert, niemals. Dem Tom Sawyer und dem Huckleberry Finn wollte ich gleich sein, dem Froschkönig doch nicht und auch nicht dem rußigen Bruder des Teufels, der vom Gottseibeiuns nur Gutes zu berichten weiß; ich wollte nicht sein wie das Gevatterkind des Todes, aus dem ein berühmter Arzt wurde; und ich wollte nicht in die Welt hinausziehen, um das Fürchten zu lernen, und auch keinem der vielen Königssöhne oder einem Zauberer wollte ich gleichen. Der gestiefelte Kater gefiel mir, so einen hätte ich gern an meiner Seite gehabt, aber nicht einmal eine Fieberfantasie reichte hin, mir daraus einen Bilderbogen vorzustellen, der mein Leben illustrieren hätte können, mein wirkliches Leben in unserem Haus oder draußen auf der Straße, auch nicht in den Wäldern und Bergen um Hohenems herum, wo ich aufgewachsen bin, auch nicht im Herbstnebel unten am alten Rhein, wo die alten Weiden so grau schienen.
Ich betrachtete die Märchen und dachte über sie nach, wie ich den Blitz am Nachthimmel betrachtet und wie ich auf den Donner gelauscht habe und auf den Regen. Was gab es an diesen Erscheinungen zu begreifen – ich meine: Hatten sie Bedeutung? Hielten sie für etwas her, was sie nicht selbst waren? Ein Berg, wie er von der Natur hingestellt wurde, ist doch keine Metapher. Hätte ich ein Märchen begreifen können? Was bedeuteten Märchen? Waren die Figuren, die Geschehnisse, die Zaubereien metaphorisch zu verstehen? Sollte ich überhaupt versuchen, ein Märchen zu begreifen? – »Greif einen Schmetterling nicht an!«, hieß es, als ich ein Kind war. »Wenn die feine Staubschicht auf seinen Flügeln verletzt wird, stirbt er.«
Ich ahnte, es gibt nichts zu begreifen an einem Märchen. Nichts zu deuten. Die Deutungen erzählten mehr über den Deuter und seine Ansichten und Absichten als über seinen Gegenstand. Sehr früh hatte ich eine Nase dafür, wenn jemand mithilfe dieser stummen Schönheiten mir seinen Braten schmackhaft machen wollte.
3
Märchen hörten sich auch anders an als andere Erzählungen – zum Beispiel, wenn mein Vater von Karl dem Großen berichtete oder den Wikingern oder den Helden der Französischen Revolution – Robespierre, Danton, Jean-Paul Marat, Desmoulins, Saint-Just, allein ihrer Namen wegen wollte ich schon sein wie die. Ich konnte mir vorstellen, dass sie sich am Abend an unseren Küchentisch setzen, dass sie das Wort an mich richten, dass ich ihnen ein Brot schmiere und Brombeermarmelade darauf häufe und meine heiße Schokolade mit ihnen teile, dass sie die Erzählungen meines Vaters ergänzen und dass sie ihn beim Erzählen ablösen, und mein Vater sitzt dabei und nickt stolz und wissend. König Drosselbart würde das nicht tun; er könnte es nicht; es führt kein Weg von seinem Schloss zu unserem Haus.
Einmal hatte mein Vater versucht, mir ein Märchen zu erzählen, er hatte es meiner Mutter versprochen, er war allein mit mir, meine Mutter war auf Kur, meine Großmutter zusammen mit meiner Schwester in Coburg – er ist gescheitert. Es war ihm peinlich. Er hat gewartet, bis es dunkel wurde, es war Sommer und spät, aber der Mond hat geschienen, und ich sah, wie peinlich es ihm war. Gestammelt hat er und mittendrin abgebrochen. »Ich sehe, du bist zu müde … das respektiere ich … vielleicht erzähl ich dir besser morgen weiter …«
Mein Vater erzählte ausschweifend und ungeniert aus der Historie, und es ist mir nie zu lange oder gar langweilig geworden. Er hat nichts lieber getan, er hat sich selbst die Geschichte verständlich gemacht, indem er sich zurück- und hineinversetzte in die Szenen, die er für neuralgisch hielt, immer wieder, bis er meinte, die Widersprüche einer fernen Zeit zu Widersprüchen in seiner und der Person seiner Zuhörer umgeformt zu haben, so dass er und sie nicht mehr nur Betrachter, sondern mithandelnde Subjekte waren, und sei es bei schwer zu begreifenden Ereignissen – wie dem Arianischen Streit im 4. Jahrhundert, in dem es darum ging, ob Jesus göttlich, gottähnlich oder geschöpflich/menschlich sei; oder der »Magdeburger Hochzeit«, wie die Zerstörung der Stadt Magdeburg während des Dreißigjährigen Kriegs genannt wurde, bei der von den 35.000 Einwohnern gerade 450 überlebten; oder der Überführung Lenins in einem »plombierten« Waggon von Zürich nach Russland auf Befehl Kaiser Wilhelms II., weil der lieber eine bolschewistische Revolution in Kauf nahm, als auch nur den kleinsten Vorteil seines Neffen dritten Grades, des Zaren Nikolaus II., zu dulden. Bis zur Erschöpfung hat mein Vater erzählt, seine Begeisterung für Geschichte ließ ihn Essen, Trinken, Anstand, alles vergessen, und nie hat er sich darum gekümmert, wie spät am Abend es war, und selbstverständlich auch nicht, ob sein sechsjähriger Sohn seinem Vortrag folgen konnte oder nicht. Er erzählte, als wäre er auf Armlänge dabei gewesen, als wäre er der fleischgewordene auktoriale Erzähler – als geschehe jetzt, in dem Augenblick des Erzählens, das Erzählte. Als erschaffe er erzählend die Historie. Er konnte frei Dialoge erfinden zwischen Talleyrand und Napoleon, zwischen Hitler und Schuschnigg, zwischen Antonius und Brutus, sogar zwischen Persönlichkeiten, die einander nie begegnet waren wie Shakespeares Richard III. und Josef Stalin. Er sah mir am helllichten Tag in die Augen und drohte mit dem Zeigefinger, als er den Bismarck spielte, wie er Kaiser Wilhelm II. in die Schranken wies – und ich war der Kaiser und schnitt das entsprechende Gesicht dazu, und er entschuldigte sich hinterher bei mir, weil er mir den schlechten Part zugeschoben hatte, er hielt Wilhelm II. für eine verachtenswerte Person.
Nie habe ich einen Mann souveräner durch die Geschichte schreiten sehen als meinen Vater, aber als er zum simplen »Es war einmal …« anhob, musste er sich wegdrehen, so peinlich war ihm die Sache. Und obwohl das Mondlicht alles in ein gnädiges Schwarzweiß tauchte, fühlte ich, wie ihm das Blut in den Kopf stieg und er rot wurde. Nicht, weil er die Märchen für kindisch hielt oder eines vernünftigen Mannes für unwürdig, das glaube ich nicht, nein; er wusste ja, dass sich die klügsten Köpfe mit Märchen befasst hatten; das Wörterbuch der Brüder Grimm hielt er für eine der größten geistigen Leistungen deutscher Sprache, Goethes Faust ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen; dass sich die Brüder – Jacob wenigstens nur in seiner Jugend, Wilhelm allerdings bis ans Ende seines Lebens – mit Märchen befasst hatten, was ja nur möglich ist, wenn man Märchen liebt, das war ihm nicht geheuer, das war meinem Vater schon fast körperlich unangenehm, er vermutete dahinter nicht etwas Dummes, sondern etwas Krankhaftes – er musste sich schon bei der ersten Wendung – Es war einmal – wegdrehen, als bestünde Gefahr, dass er mich über diese Worte ansteckt.
4
Ich ahnte ferner: Märchen sind nichts für Kinder. Eine solche Abwehr bringt ein Erwachsener nur auf, wenn die Sache ihn betrifft, ihn selbst, und mein Vater war für mich der Erwachsene schlechthin (wenn ich heute mit meinen achtundsechzig Jahren einen Zwanzigjährigen treffe, der einen ähnlichen Haaransatz hat, wie er einen gehabt hatte, einen vernünftigen, erwachsenen Haaransatz, der die Haare aussehen lässt, als strebten sie nach hinten, als strebte der ganze Mann voran – dann erinnere ich mich an meine Selbsteinschätzung als Kind: ein Faulpelz, ein Zauderer, ein Träumer, ein Es-war-einmal, einer, der nur im Schatten des Mondes glänzte).
Jacob Grimm hat später zugegeben: »Das Märchenbuch ist mir gar nicht für Kinder geschrieben, aber es kommt ihnen recht erwünscht und das freut mich sehr.« Aus der Biografie der Brüder schließe ich auf einen kleinen Zusatz: Es freute ihn sehr für den Bruder Wilhelm.
Der Wilhelm nämlich war es, der erfunden hat, was die Gattung Grimm genannt wird. – André Jolles hat diesen Begriff geprägt. In seinem 1930 erschienenen Buch Einfache Formen – für die Märchenforschung ein Standardwerk, auch wenn der Gattung darin nur ein Kapitel gewidmet ist – schreibt er: »Ein Märchen ist eine Erzählung oder eine Geschichte in der Art, wie sie die Gebrüder Grimm in ihren Kinder- und Hausmärchen zusammengestellt haben. Die Grimm’schen Märchen sind mit ihrem Erscheinen, nicht nur in Deutschland, sondern allerwärts, ein Maßstab bei der Beurteilung ähnlicher Erscheinungen geworden. Man pflegt ein literarisches Gebilde dann als Märchen anzuerkennen, wenn es – allgemein ausgedrückt – mehr oder weniger übereinstimmt mit dem, was in den Grimm’schen Kinder- und Hausmärchen zu finden ist.«
5
Jacob Grimm war zunächst nicht damit einverstanden, dass die Sammlung mit Kinder- und Hausmärchen (von nun an: KHM) betitelt werden sollte. Das war Wilhelms Vorschlag. Jacob legte sehr viel mehr Wert auf Nachworte und Vorworte und begleitende Untersuchungen und Betrachtungen und Theorien als auf den Text der Märchen; der Text war ihm Beispiel und Beleg für eine Idee. Die Idee war: Die Volksmärchen haben ihren »geheimnisvollen Ursprung in den Tiefen der Volksseele«. Der Volksseele nachzuspüren, die sich in der Sprache eines Volkes ausdrückte und nicht nur dort, sondern auch in seinen Bräuchen, seinen Liedern, seiner Art, Recht zu sprechen, das hatte sich Jacob Grimm zur Lebensaufgabe gemacht – und wurde dabei der Gründervater der Germanistik, der Sprachwissenschaft, der Volkskunde.
Jacob hat sich die Frage gestellt, wie entstehen Märchen, wie kamen sie zu uns, was ist ihr Urgrund; er hat nicht in die Märchen hineingegriffen, um sich Brauchbares herauszuholen, mit dem man irgendwelche Weltanschauungen festigen könnte, die mit den Märchen eigentlich gar nichts zu tun haben. – Das muss heute gesagt werden, wo Esoterik und Ratgeber aller Art meinen, sich an Märchen vergreifen zu dürfen, Alternativ-Pillen in Papierform. »Kinder brauchen Märchen« – wenn ich das schon höre! In die Wahrheit übersetzt lautet diese Parole: »Pädagogen missbrauchen Märchen, um Kinder auf den Leim zu locken, den sie vor ihre eigenen Angelegenheiten geschmiert haben.« – Auch wenn sich Jacob für die Theorie mehr interessierte als für die Märchen selbst, hat er sie doch nicht als Argumente für Weltanschauung herangezogen. Er hat sie bestehen lassen in ihrer Rätselhaftigkeit und ihrer Geschlossenheit. Er hat sie nicht im Auftrag eines vermeintlich höheren Gutes gedeutet, um für dieses höhere Gut zu werben oder um es zu sanktionieren. Er hat sie auch nicht zu Gleichnissen erklärt und instrumentalisiert.
In dem freundschaftlichen Federstreit mit Achim von Arnim, der die Meinung vertrat, die Bedeutung der Volksdichtung liege einzig darin, dass sie »eine Art Erfindsamkeit anregt«, das heißt, dass sie Großmüttern, Müttern, aber auch Dichtern Rohstoff und Inspiration liefert, woraus dann Kunst entsteht, auf welchem Niveau auch immer, hielt Jacob dagegen: »All meine Arbeit, das fühle ich, beruht darauf, zu lernen und zu zeigen, wie eine große epische Poesie über die Erde hin gelebt und gewaltet hat, nach und nach von den Menschen vergessen und vertan worden ist …« Vor dem Vergessen, einem endgültigen Vergessen, sollten diese erratischen Gebilde gerettet werden. Seiner Meinung nach hatten sich Achim von Arnim und Clemens Brentano mit der Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn, für die er und Wilhelm Zulieferer gewesen waren, eigentlich etwas Unseriöses geleistet: Sie hatten das vorgefundene Material lediglich zum Weiterdichten verwendet, eben als Material – das heißt, sie haben es gebraucht, und das heißt: missbraucht. Jacob glaubte nicht, die Erzeugnisse der Volksseele hätten es nötig, von Dichtern veredelt zu werden.
6
Der deutsche Mediävist und Volkskundler Hans Naumann entwickelte in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Theorie vom gesunkenen Kulturgut, der zufolge, verkürzt dargestellt, alle kulturellen Leistungen einer Gesellschaft von den Oberschichten ausgehen und im Laufe der Zeit nach unten sinken und dort von den Menschen der sogenannten Unterschicht auf ihre Bedürfnisse und gemäß ihren Fähigkeiten umgemodelt werden. So entstünden aus ehemals hehren Mythen die Märchen, denen folglich geringerer Wert zugeschrieben werden müsse, geringerer Erkenntniswert, geringerer ästhetischer Wert, geringerer moralischer Wert.
Naumann publizierte 1921 sein Buch Primitive Gemeinschaftskultur. Beiträge zur Volkskunde und Mythologie; darin breitete er seine Thesen zum ersten Mal aus. Er widersprach der damals noch immer herrschenden, von Jacob Grimm vorgestellten Auffassung, das Volk sei nicht nur in der Lage, eine eigenständige Kultur zu entwickeln, sondern gebe gar die Impulse für sämtliche kulturellen Leistungen, liefere sozusagen die Rohfassung, die in den höheren Schichten lediglich Verfeinerung und Veredelung erfahre – also dass Kulturgut nicht absinke, sondern aufsteige. Naumann bezog sich auf Achim von Arnim; der hatte Jacob Grimm entgegengehalten, Volksdichter gebe es nicht, es gebe nur Dichter. Naumann gestand dem Volk im Erschaffen von Kultur durchaus eine gewisse Basisfunktion zu, mehr allerdings nicht – gespeist werde der Baum zwar von den Wurzeln, die Früchte aber trage die Krone. Das Volk müsse eben auch in kulturellen Dingen geführt
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: