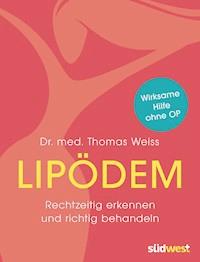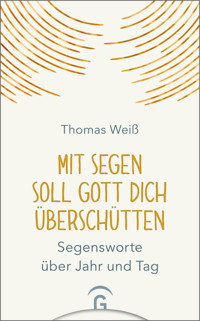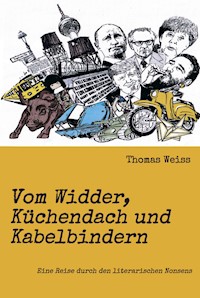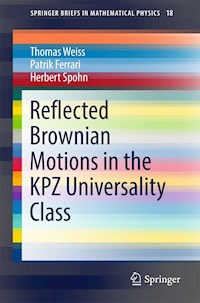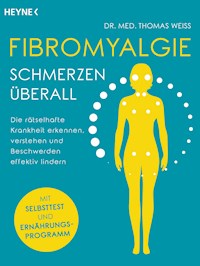12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hilfe für alle, die in schwierigen Situationen nicht mehr weiterwissen
Wo ist Gott, wenn es im Leben so richtig schlecht läuft? Als Seelsorger hat Thomas Weiß oft versucht, mit betroffenen Menschen Antworten auf diese Frage zu finden. Als ihn selbst die Not trifft und eine Krankheit sein Leben bedroht, wird ihm, was er gesagt und sich zurechtgelegt hat, schal. Gott rückt ihm fern. Findet er in seiner Angst noch Gehör bei dem, auf den er bisher vertraut hat? Er zweifelt, aber er will diesen Gott nicht loslassen.
Die Meditationen, Gedichte, kleinen Geschichten und Essays dieses Buches sind Zeugnisse dieses Ringens. Sie zeigen: In der Angst kann gerade der Zweifel an der Nähe Gottes die Art des Glaubens sein, die durch die Not hindurchträgt. Ein Buch, das den schweren Fragen des Lebens nicht ausweicht und gerade darum tröstet und hilft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wo ist Gott, wenn es im Leben so richtig schlecht läuft?
Als Seelsorger hat Thomas Weiß oft versucht, mit betroffenen Menschen Antworten auf diese Frage zu finden. Als ihn selbst die Not trifft und eine Krankheit sein Leben bedroht, wird ihm schal, was er gesagt und sich zurechtgelegt hat. Gott rückt ihm fern. Findet er in seiner Angst noch Gehör bei dem, auf den er bisher vertraut hat? Er zweifelt, aber er will diesen Gott nicht loslassen.
Die Meditationen, Gedichte, kleinen Geschichten und Essays dieses Buches sind Zeugnisse dieses Ringens. Sie zeigen: In der Angst kann gerade der Zweifel die Gestalt des Glaubens sein, die durch die Not hindurchträgt.
Ein Buch, das den schweren Fragen des Lebens nicht ausweicht und gerade darum tröstet und hilft.
Thomas Weiß, geboren 1961, Studium der Evangelischen Theologie in Bielefeld und Heidelberg, danach Arbeit in Gemeinden Süd- und Nordbadens und als Erwachsenenbildner in Freiburg. Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik, Leipzig, Stipendiat und Mitglied des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg, Stuttgart. Derzeit arbeitet er als Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung in der Badischen Landeskirche (Landesstelle für evang. Erwachsenen- und Familienbildung, Karlsruhe). 2020 wurde er in das PEN-Zentrum Deutschland aufgenommen. Thomas Weiß lebt in Baden-Baden.
Thomas Weiß
Wäre da doch jemand, der mich hört!
Wege durch Zeiten des Leids
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2024 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © jesse – Adobe Stock.com
ISBN 978-3-641-29000-9V001
www.gtvh.de
Unseren Eltern zum Gedächtnis
ecclesia dell’arte
Inhalt
1
Auch ohne ihn. Der abwesende Gott
2
Wieder einmal. Glaubensgeschichte(n) und Zweifel
3
Du musst etwas sagen. Der schweigsame Gott
4
Ganz ungelöst. Der fragwürdige Gott
5
Wir wissen ja nicht. Der befremdliche Gott
6
Spielen die Finger. Der verwunderliche Gott
7
Wie wenn die Sonne sich verfinstert. Der verschattete Gott
8
Wieder da. Der verwegene Gott
9
Voll Schmerz. Der versehrte Gott
10
Nicht müde wirst uns zu wollen. Der vermenschlichte Gott
11
Ganz und gar nicht. Der unbrauchbare Gott
12
Nicht ausrechnen. Der verliebte Gott
13
Hält dir seine Flügel hin. Der ersehnte Gott
14
Getanzt muss sein. Glaube und Zweifel
Anmerkungen
Sagt Ja Sagt Nein Getanzt Muess Sein
(Motto des Füssener Totentanzes, St. Anna-Kirche 1602)
1
Auch ohne ihn. Der abwesende Gott
Rede des ev. Pfarrers
(lacht:)
Ach, wissen Sie,
auch ohne ihn
haben wir viel zu tun.
Manche in der Gemeinde
haben ihn schon vergessen.
Anderen fehlt er. Sehr.
War es besser mit ihm?
Der Trost drang tiefer,
und die Scham darüber,
geboren zu sein,
ließ sich leichter
verbergen.
(Michael Krüger)1
Und – fehlt er Ihnen?
Ich finde diese Frage nicht leicht zu beantworten. Natürlich fehlt mir einer, der mir die Welt erklären kann, der am Ende alles zum Guten wendet, auf den ich mich verlassen kann, wenn der Atem knapp wird und mir die Luft ausgeht. Es ließe sich leichter leben so. Wenngleich den Verlegenheiten, die das Leben bereithält – Michael Krüger spricht von der Sehnsucht nach Trost und von der Scham, überhaupt da zu sein –, nicht abgeholfen wird. Ob er da ist oder nicht. Gott federt das ab, macht es erträglicher, aber dass mein Leben unvollkommen, gebrochen, gezeichnet und gefährdet ist, daran ändert sein erhofftes, gefühltes oder postuliertes Dasein nichts. Es lässt sich nur leichter überspielen: Ich finde Worte dafür in alten Gebeten oder neuen Liedern. Mir tun sich Räume der Stille auf, in denen ich mich beruhigen kann. Ich habe einen, den ich anrufen oder anschreien kann, wenn mir nach Klagen und Rechten ist. Das ist nicht wenig. Doch ist es schon alles?
Fehlt er mir, weil ich es gerne erträglicher hätte? Damit meine schmerzliche Sehnsucht einen Ort hat, wohin sie sich wenden kann? Damit ich mir meine Fragen nicht alle selbst beantworten muss? Damit Antworten von einer Autorität kommen, die nicht ständig in Frage steht?
Anderen fehlt er, weiß das Gedicht. Zu denen gehöre ich wohl, auch wenn ich mir der Gründe meiner Mangelerfahrung nicht sicher bin. Es könnte sein, dass er mir fehlt, weil ich einen Gott brauche, weil ich – im Bild gesprochen – ohne die göttliche Krücke2 nicht gehen kann. Weil mir ein Gott sehr recht wäre. Einer, der mir dies und das abnimmt, für das ich zu kraftlos und mutlos – oder zu unmotiviert und faul – bin. Einer, der mich kennt und aushält. Ein Gott, der den Horizont weitet, so dass ich nicht allein auf die Weite meiner Erkenntnis (die nicht sehr weit ist) und die Grenzen meiner Angst (die eng sind) gewiesen bin. Ein Gott, der für eine Zukunft der Menschen und der Welt steht, an die zu glauben mir kaum noch möglich ist. Er braucht keinen besonderen Namen und keine Titel haben, keine besondere Persönlichkeit auch, dieser Gott. Wichtig ist, dass er mir aufhilft, dass er mir nützt. Solch einen Gott kann ich brauchen. Da bin ich gewiss nicht der oder die Einzige.
Max (natürlich hieß er nicht wirklich so) habe ich während meiner dritten Chemotherapie-Woche kennengelernt. Er lag neben mir, an deutlich mehr Messgeräten und Perfusoren angeschlossen als ich – er war schon da, als ich neu in das Dreibettzimmer kam. Oft habe ich nur seine Nasenspitze und seine Stirn gesehen, der schmale, kleine Mann lag meist in den Decken und Kissen verborgen. Aber wir sprachen ab und an miteinander, wie es der Mensch, der einem Leidensgenossen begegnet, eben tut, aus Höflichkeit und einem kleinen bisschen Neugierde – und um vielleicht etwas zu hören, eine Geschichte, eine Erfahrung, ein Detail, das Mut machen könnte. Max war vor seiner Erkrankung Fotograf, ich denke: ein guter, mit künstlerischem Anspruch. Als er erfuhr, dass ich Theologe sei, versicherte er sich, ob ich auch ein »echter« sei, ein Pfarrer nämlich – und richtete sich, als ich bejahte, im Bett etwas auf (was sehr, sehr mühevoll für ihn war und, wie es mir schien, mit Schmerzen verbunden), um mir zu sagen (leise, er sprach immer sehr leise): »Beneidenswert. Wie hilfreich muss das sein, einen Gott zu haben. Das macht’s doch irgendwie leichter, wenn du einen hast, zu dem du beten kannst.« Und nach ein paar Sekunden: »Ich kann nicht an Gott glauben – aber manchmal fehlt mir das.«
Wäre da doch jemand, der mich hört. Max konnte das – wie ich damals auch – nur als Wunsch, als Verlangen formulieren. Da fehlte etwas oder eine/r, der oder die nötig gewesen wäre. Viele, die dieses Buch lesen mögen, teilen diese Erfahrung – in bestimmten Zeiten, in Zeiten des Leids, wie es scheint: immer oder wenigstens oft, wenn es darauf ankommt, glänzt Gott durch Abwesenheit. Der Zweifel an ihm, ob es ihn gibt und wenn, ob er hilfreich sein kann oder will, liegt näher als der Glaube daran, dass er aufmerksam ist und die Hände regt.
Ich hatte für Max keine Antwort. Verstanden habe ich ihn wohl, aber zu diesem Zeitpunkt war Gott mir sehr, sehr fern, ich fühlte zwischen meinen eigenen Schmerzen und Ängsten nichts von ihm – und hätte mich doch gern festgehalten; an ihm oder sonst wem. Ich dachte: Ich brauche ihn, aber wenn ich ihn brauche, ist er nicht da, jedenfalls nicht spürbar. Was soll er mir dann? Vielleicht ist etwas falsch an der Idee, Gott würde gebraucht, Gott sei brauchbar? Nicht zu leugnen ist, dass Gott fehlte: Max ganz grundsätzlich, mir zumindest aktuell. Für die einen ist das eine Not, für die anderen nicht der Rede wert.
Manche … / haben ihn schon vergessen – das ist noch freundlich gesagt. Gewiss gibt es die Gleichgültigen, die sich ihren gemütlichen Gott zurechtgemalt haben und nun leben sie mit ihm, als gäbe es ihn nicht, so wie einer mit dem kleinen, nichtssagenden Gemälde in der Wohnzimmerecke lebt, mit den blassen Buchrücken im Bücherregal, die er täglich sieht, aber gar nicht mehr wahrnimmt vor lauter Gewöhnung. Und es gibt die Gottesverächter/innen3 – seit Friedrich Schleiermacher hervorragende Gesprächspartner und -partnerinnen der theologischen Zunft –, die sich beleidigt fühlen, wenn sie glauben sollen, dass es neben dem Menschen und neben den Menschen noch einen anderen gibt, der denkt und entscheidet und Rat weiß.
Beachtlich und vielleicht am größten aber ist, glaube ich, die Menge der von Gott Enttäuschten. Sie haben sich vertrauensvoll an ihn gewandt – und er hat geschwiegen. Sie haben gefleht, dies und das gelobt, zum Tausch für Hilfe angeboten – er hat nicht reagiert. Sie haben sich mit Gott die Welt erklärt, tiefschürfend und klug, aber sie sind daran gescheitert, dass er die Welt offensichtlich nicht gut genug gemacht hat, sie nicht heilt oder sie ungerührt zugrunde gehen lässt. Gegen alle Verheißungen, auf die sie immer wieder gesetzt haben.
Andere können mit einem Gott, der undemokratisch-königlich regiert, der ein gestreng-autoritärer Vater, ein willkürlicher Herr ist, der ein Opfer – den eigenen Sohn – nötig hat, um besänftigt zu werden, einfach nichts mehr anfangen. Sie haben Gottes Lächeln vergeblich gesucht, seine milde Hand vermisst, den Freund an der Seite nicht erlebt. Solch ein Gott lässt seine empathischen Anteile vermissen, in seiner Menschenebenbildlichkeit – es mag erlaubt sein, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen auch in die andere Richtung zu denken – kennt er keine Diversität. Gott fehlt nicht nur, ihm fehlt auch mancherlei, das ihn oder sie mir zum Partner, zur Partnerin meines Lebens machen könnte. Auf Augenhöhe. Aber dazu schwebt oder hockt er viel zu weit oben – in den kirchlich-theologischen Sprachbildern jedenfalls, die für ihn gefunden wurden, wenn vom himmlischen Thron die Rede ist, vom Hirten, vom Allmächtigen.
Sie merken es: Ich rede gar nicht so sehr von Gott selbst als von den Gottesbildern, die Menschen – wir Menschen – uns von ihm gemacht haben und in denen wir täglich leben und sprechen, wenn wir für Gott noch Worte übrighaben, wenn er uns noch der Erwähnung wert ist.
»Von Gott selbst« kann ich gar nicht sprechen. Er ist – wenn er ist – immer weiter, tiefer, größer, kleiner, näher und ferner, als meine Worte ausdrücken können. Sie reichen nicht an ihn heran, sie ergründen ihn nicht, sie füllen ihn nicht aus, sie umschreiben ihn nicht. Menschenworte sind, wie Paulus einmal anmerkt, Stückwerk. Das macht sie nicht wertlos – sie sind das Einzige, was wir haben; und nun zähle ich die Sprache von Musik und Malerei, von Dichtung, Lied und Tanz zu den Menschenworten dazu. Es sind keine armseligen, es sind reiche, bunte, schöpferische Worte und Bilder, die wir benutzen. Aber sie sind eben immer nur dies: Menschenworte und Menschenbilder.
Aus vielen von ihnen, aus altvorderen und althergebrachten, auch aus neuen Versuchen, uns Gott auszumalen, zu erdichten und zu erglauben, hat Gott sich verabschiedet. Viele Gottesbilder sind unnütz geworden, haben sich nicht bewährt, benötigen frische Farben oder eine grundsätzliche Renovation. Von daher stimmt es: auch ohne ihn / haben wir viel zu tun. Wenn mir denn von Gott zu reden noch etwas bedeutet, wenn ich ihn für mich noch gelten lassen möchte.
Dieses Buch stellt sich der Aufgabe, »Wege durch Zeiten des Leids« zu versuchen, und – zu eben diesem Zweck – Gottesbilder schonungslos anzusehen und zu prüfen. Schonungslos vor allem dahingehend, dass ich den eigenen Bildern, die mir aus der kirchlichen Tradition und der eigenen Glaubenserfahrung bedeutsam und wichtig sind, nicht mit Nachsicht begegne, und dass ich Gott streng und erwartungsvoll befrage, der sich hinter manchem Wortgebilde und mancher frommen Formel verbirgt. Wer so fragt, nimmt sich aus Sicht der traditionellen Gottesrede Ungebührliches heraus, die oder der benimmt sich frech. Jenseits der Lust, mir das einmal zuzugestehen, lasse ich mir das als Ermahnung durchaus sagen: Nicht, was mir gut passt und einleuchtet, ist schon ein hilfreich-gültiges Gottesbild; wer immer Gott und die Bilder von ihm kritisiert, darf sich nicht selbst zum Maßstab nehmen – so verlockend das ist.
Zugleich kennt die Bibel selbst eine ihr innewohnende Gottesbild-Kritik4: Generell und unmissverständlich ausgesprochen im zweiten Gebot: »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen …« – und ins Persönliche gewendet in Psalm 27: »Mein Herz hält dir vor dein Wort: ›Ihr sollt mein Antlitz suchen.‹ Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.« Der Beter des Psalms – er wird David zugeschrieben – fühlt sich von Gott selbst ermutigt, sich auf die Suche zu machen, nach ihm zu fragen. Was das Befragen und In-Frage-Stellen einschließt. In der Vorstellung des Beters wird er als Subjekt seines Glaubens, seiner Gottesrede sichtbar, im Zwiegespräch begegnen sich Gott und David als Partner. Der Liederdichter David sucht. Er ist also nicht von vorneherein festgelegt auf ein Bild von Gott, auch auf keines, das Gott von sich selbst preisgibt, auf keine Offenbarung oder Setzung, er sucht. Und fühlt sich im Einklang mit einem Auftrag, der von Gott selbst kommt: »Suche, sei nicht zufrieden mit dem, was andere als mein Antlitz beschrieben oder gezeichnet haben, mache deine eigenen Erfahrungen, zeichne dein eigenes Bild.«
Und wenn das gelungen ist, wenn es mir auf der Hand oder auf der Zunge liegt – fange ich wieder von vorne an, beginne ich die Suche neu.
Das ist nicht sehr befriedigend für Menschen, die eindeutige Konturen und Klartext lieben, die für ihr Denken und Glauben Geländer möchten, an denen sie sich festhalten und entlangtasten können. Zu denen gehöre ich bisweilen auch – und ich halte doch dafür, dass wir als Zeitgenossinnen und Zeitgenossen einer Moderne, die nur noch wenig Verlässliches vorhält, immer wieder genötigt sind, unsere Gottesbilder zu überdenken, sie in Frage zu stellen, neu darüber zu entscheiden. Zumal, wenn wir im Gespräch mit denen sind, die keinen Gott brauchen oder sich einem anderen, mit anderem Namen, anderem Antlitz zugehörig fühlen. Auch vor ihnen müssen wir, was uns von Gott her einleuchtet und trägt, verantworten – nicht nur vor Gott, vor der theologischen Tradition, vor Bekenntnis und Dogma, und nicht nur vor uns selbst.
Übrigens ist es eine grundlegende und folgenreiche Erkenntnis eben der theologischen Tradition, dass von Gott nicht »adäquat«, also angemessen und ihm genau entsprechend, gesprochen werden kann – unsere Worte über ihn reichen an ihn selbst nicht heran. Sie sind immer nur Näherungen, Umschreibungen, Vorläufigkeiten. Manche sind tragfähiger als andere, manche bilden lange Wortgeschichten heraus, bis sie von neuen Versuchen, Gott ins Wort und ins Bild zu fassen, abgelöst werden. »Trefflich« – im Sinne von genau – ist keines. Anders gesagt: Gott ist in den Worten über Gott wohl anwesend, aber doch nur zu erspüren, hinter den Worten und zwischen den Zeilen.
Das kann frustrierend sein: Woran soll ich mich halten?
Oder: Ich nehme es als Befreiung wahr, die Befreiung, neue, andere Worte zu wagen, zu versuchen, wie weit sie tragen und ob sie etwas vermitteln, das bisher nicht oder nicht genügend gehört worden ist. Dann wird die Gottesrede gewissermaßen zur Poesie, und die poetische Wortsuche erlaubt sich die Freiheit, jede Aussage über Gott als »offenes Kunstwerk«5 (Umberto Eco) zu verstehen, das erst rund wird und sinnvoll, wenn die Hörenden ihr eigenes Verhältnis dazu gefunden haben. Wieder klingt durch: Der Einzelne und die Einzelne sind die Subjekte, die Urheber/innen ihres Glaubens, ihnen wird zugemutet, sich zu entscheiden, die eigenen Schritte zu gehen.
Weil es auf diesem Weg aber nie zu eindeutigen Gotteserkenntnissen kommt, sind die Menschen, die auf der Suche sind und sich Gott angelegen sein lassen, immer aufeinander gewiesen. Sie brauchen das Gespräch, den Dialog, sie sind genötigt, aufeinander zu hören, sich gegenseitig zu befragen und sich befragen zu lassen, Geduld zu üben und sich leidenschaftlich auseinanderzusetzen. Sich auf einen Weg miteinander zu begeben. Mir macht das die Gottessuche höchst lebendig.
Viel zu tun – diese »Sache mit Gott« ist kein einfaches Ding, er ist nicht selbsterklärend, und wer vermeint, begriffen zu haben, sollte mit Misstrauen gehört werden. Lohnt es sich denn, viel zu tun? Ist es das (noch) wert, Gott zu suchen, an ihm irgendwie festzuhalten? Eine Antwort lässt sich nur als persönliches Bekenntnis geben. Es gibt keine gesellschaftliche, staatliche oder kirchliche Autorität mehr, die diese Frage für mich beantworten könnte: Religiös zu sein gehört nicht mehr zum guten, bürgerlichen Ton. Staaten bestehen, wenn sie demokratisch sind, auf die Religionsfreiheit (was die Freiheit, keine Religion zu haben, einschließt) und die Kirchen haben sich viel Mühe damit gegeben, unglaubwürdig zu sein, wenn ihre Predigt von Liebe, Heil, Freiheit mit den Realitäten von Macht, Missbrauch und Moralität abgeglichen werden.
Mein ganz persönliches Motiv, an Gott festzuhalten, ist ein Gefühl: Ich sehne mich nach ihm. Das wird noch auszuführen sein, hier nur dieses, dass im Gefühl der Sehnsucht zweierlei zusammenfällt: die Erfahrung der Abwesenheit Gottes und die Gewiesenheit auf Gott. Diese lebendige, oft genug schmerzliche und immer wieder begeisternde, hinreißende Spannung zwischen dem Fehlen Gottes und dem Hingezogen-Sein zu ihm hält mich aufmerksam, lässt mich noch etwas erwarten. Ich gebe mir mit Gott und ich gebe Gott mit mir noch einmal eine Chance, immer wieder noch einmal.
Aber da ich ihn und mich ernst nehme, geht das nur durch Dunkelheiten hindurch. Die »Wege durch Zeiten des Leids«, von denen dieses Buch im Untertitel spricht, sind keine hell erleuchteten Bahnen, keine Alleen, die am frühen Abend noch in der untergehenden Sonne glänzen. Sie liegen bisweilen in konturlosem Nebelgrau oder in tiefschwarzer Nacht – und müssen gewagt werden. Die Lampen sind geizig mit ihrem fahlen Licht und helfen nur spärlich; ich setze meine Schritte vorsichtig und achtsam. Aber: Es gibt sie, diese Wege!
Ob sich mir Wege auftun, das hängt meiner Erfahrung nach von dem ab, was ich (noch) glaube und was ich (schon) bezweifle. Durch mein Leid haben mich beide geführt (und führen mich noch): Glaubenswege und Zweifelswege.
Die meines Glaubens waren holprig, es gab eine Menge Steine, mich daran zu stoßen, und oft genug habe ich die Orientierung verloren, über die nächste Wegkreuzung nicht hinausgesehen. Auf den Wegen meines Zweifels war die Not unabweisbar, es gab keine einfachen Wegmarken und detailgenauen Wanderkarten – aber ich habe mich selbst auch gespürt. Im Zweifel bin ich präsent. Der Zweifel öffnete mir (und öffnet weiterhin) das Gelände und ermutigte mich, meine eigenen, persönlichen Schritte zu gehen, auf noch nicht ausgetreten Pfaden, über Hängebrücken, die bedenklich schwanken können. Der angeschlagene Glaube, der frech-verzagte Zweifel halfen (und helfen) mir, das Leid zu meinem Leid zu machen – dann ist es kein blindes Schicksal mehr – und meinen Weg darin zu suchen, zu finden, zu beschreiten. Davon will ich schreiben, davon erzähle ich.
2
Wieder einmal. Glaubensgeschichte(n) und Zweifel
Einsicht
Wir schwiegen
wieder einmal
über Gott und die Welt.
Gott können wir
sowieso nicht ändern.
(Axel Kutsch)1
Es scheint, vorderhand und auf den ersten Blick, angebracht zu sein, zu schweigen. Was können wir über Gott schon ernsthaft sagen? Natürlich: Wir haben lange Traditionen der Gottesrede, nicht nur im Christlichen, die sogenannten »theistischen« Religionen, die einen Gott oder mehrere Götter und Göttinnen bekennen, bieten eine unerschöpfliche Vielfalt an Bildern und Worten von und über Gott, die schier unüberschaubar und schon in der je eigenen Glaubenstradition zuweilen widersprüchlich sind. Aber erreiche ich, erreichen die Religionen mit diesen Worten und Bildern tatsächlich Gott? Gott können wir / sowieso nicht ändern – diese offensichtlich ernüchternde Erkenntnis spiegelt die Verlegenheit: An Gott zu rühren, auf Gott Einfluss zu nehmen, Gott zu bewegen, ist uns wohl nicht gegeben. Der evangelische Theologe Rudolf Bultmann2