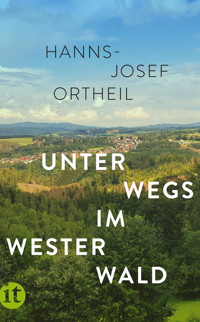9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über die Lebenskunst – und über die Kunst, sein Leben zu führen.
»Was ich liebe – und was nicht« ist ein Buch über die literarische Lebenskunst Hanns-Josef Ortheils: über seine Vorlieben beim Wohnen und Reisen, beim Essen und Trinken, beim Hören von Musik und dem Anschauen von Filmen. Und es ist zugleich weit mehr: ein Buch über die Kunst, ein Leben zu führen.
In seinem neuen Buch erzählt Hanns-Josef Ortheil von seinen Lebensthemen. Entlang zentraler Stichworte wie Wohnen, Reisen, Essen und Trinken, Film, Jahreszeiten oder Musik geht er den vielfältigen Facetten einer literarischen Lebenskunst auf den Grund, die so etwas wie die Basis für seine literarischen Werke bildet. In kurzen, erzählenden und essayistischen Texten werden diese Passionen nicht nur beschrieben, sondern auch nach ihrer Herkunft und vor allem danach befragt, was sich hinter ihnen verbirgt. Warum hasst Ortheil Frühstückbüffets, und warum hört er beim Schreiben ausschließlich Klaviermusik aus den Zeiten vor 1750? Wieso gefällt ihm eine so spröde TV-Sendung wie das »Alpenpanorama«, und warum wird er wohl nie nach Japan reisen, vielleicht aber einmal ein Buch über Japan schreiben?
»Was ich liebe – und was nicht« steht in der Tradition der klassischen Bekenntnisliteratur, der »Confessiones«. Es ist ein Buch, das – fast zeitgleich zum 65. Geburtstag des Autors im November 2016 – auf besonders intensive Lebensmomente zurückblickt, aber auch Pläne, Wünsche und Träume für die Zukunft entwirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
In seinem neuen Buch erzählt Hanns-Josef Ortheil von seinen Lebensthemen. Entlang zentraler Stichworte wie Wohnen, Reisen, Essen und Trinken, Film, Jahreszeiten oder Musik geht er den vielfältigen Facetten einer literarischen Lebenskunst auf den Grund, die so etwas wie die Basis für seine literarischen Werke bildet. In kurzen, erzählenden und essayistischen Texten werden diese Passionen nicht nur beschrieben, sondern auch nach ihrer Herkunft und vor allem danach befragt, was sich hinter ihnen verbirgt. Warum hasst Ortheil Frühstückbüffets, und warum hört er beim Schreiben ausschließlich Klaviermusik aus den Zeiten vor 1750? Wieso gefällt ihm eine so spröde TV-Sendung wie das »Alpenpanorama«, und warum wird er wohl nie nach Japan reisen, vielleicht aber einmal ein Buch über Japan schreiben?
»Was ich liebe – und was nicht« steht in der Tradition der klassischen Bekenntnisliteratur, der »Confessiones«. Es ist ein Buch, das auf besonders intensive Lebensmomente zurückblickt, aber auch Pläne, Wünsche und Träume für die Zukunft entwirft.
Zum Autor
HANNS-JOSEF ORTHEIL wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
HANNS-JOSEF ORTHEIL
Was ich liebe – und was nicht
LUCHTERHAND
Entrée
Der französische Zeichendeuter und Schriftsteller Roland Barthes hat viele Bücher geschrieben. Über den Eiffelturm, die Mode, die Sprache der Liebe. Als er sechzig war, stellte er solche Themen aber einmal zurück und schrieb ein entspanntes Buch nur über sich selbst. Warum er gerne Zigarren raucht. Wie er sich hinter einem Vortragspult fühlt. Was er besonders liebt (Salat, Zimt, Käse, Rosen, Schreibfedern etc.) und was er überhaupt nicht mag (Geranien, das Telefonieren, das Cembalo etc.).
Es wurde ein übermütiges und auch heiteres Buch, in dem der Autor sich in vielen Facetten porträtiert. Mit bloßen Benennungen seiner Passionen begnügte er sich jedoch nicht. Vielmehr ging er ihnen detailliert nach: Wie waren sie entstanden (Ursprünge)? Woraus bestanden sie (Strukturen)? Und als welchen Typus oder Charakter ließen sie ihren Darsteller erscheinen (Zugehörigkeit zu einer Spezies)?
In Barthes’ Buch Über mich selbst habe ich seit seinem Erscheinen (1975) immer wieder gelesen. Und jedes Mal erlebte ich während der Lektüre, wie »anregend« es wirkte und dass es mich darüber nachdenken ließ, was ich selbst liebe und was eben nicht. Als befragte das Buch mich ganz direkt und redete auf mich ein: Gib doch zu …, lass mal hören …, denk mal drüber nach …!
Oft legte ich es schon nach wenigen Seiten Lektüre zur Seite und überließ mich meinen Ideen und Gedanken. Viele davon habe ich aufgeschrieben und mit den Jahren gesammelt. Jetzt sind die meisten in dieses Buch eingegangen. Insgeheim schielen sie danach, dass auch die Leserin oder der Leser sich selbst befragen. Damit das Ganze nicht nur mein eigenes Selbstporträt in kurzen Fragmenten bleibt, sondern zu einer Art Spiegel wird, in dem Leserin oder Leser sich selbst genauer erkennen.
Im Grunde handelt es sich bei einem solchen Vorhaben um ein traditionsreiches, schon seit der Antike bekanntes Projekt. Es geht dabei um so etwas wie Lebenskunst, das heißt um die Fragen, wie ich mein Leben einrichte und meine fortlaufenden Überlegungen dazu begründe. Einerseits schaut man dabei auf all die subjektiven Passionen, die sich in einem Leben mehr oder minder zufällig herausgebildet haben, schließlich aber bewusst angenommen und kultiviert wurden. Der Ursprung dieser Passionen liegt in der Kindheit und Jugend. Daher werde ich, um viele von ihren Ursprüngen her genauer zu erkennen, immer wieder in diese frühen Zeiträume zurückgehen müssen.
Andererseits schaut man aber auch darauf, welche Strukturen und Hintergründe die gelebten Passionen im Zusammenhang mit den Überlegungen, die sie stabilisieren und formen, im Laufe der Zeit ausgebildet haben. Solche Fragen betreffen Räume und Zeiten, Architekturen des Lebens und lebenslang ausgebildete Rituale.
In der griechischen und römischen Antike waren solche Fragen beliebte Themen im brieflichen oder mündlichen Dialog zwischen Philosophen und Schriftstellern. Von den meisten Autoren des frühen Christentums wurden sie übernommen und mit dem Blick auf die organisierenden Lebensformen des Christentums bis heute thematisiert.
Ein in diesem Zusammenhang besonders und von mir »über die Maßen« (wie Roland Barthes in hymnischen Momenten gerne sagt) geliebtes Buch ist das Kopfkissenbuch der japanischen Dichterin Sei Shōnagon, das sie als Hofdame am japanischen Kaiserhof um das Jahr 1000 n.Chr. geschrieben hat (Erstmals vollständig aus dem Japanischen übersetzt und neu herausgegeben von Michael Stein. Zürich 2015). Diese sehr privaten Bekenntnisse erzählen nicht nur vom Leben am Hof, sondern sind auch ein Kompendium verschiedener Kurzformen des Berichtens und Bekennens. So gibt es viele Listen, die bestimmte Attraktionen und Passionen sammeln und nebeneinanderstellen. Oder es gibt kurze Dialoge, in denen sich zwei Menschen (oft leise, geheim und flüsternd) über Dinge und Ereignisse austauschen, die nicht öffentlich werden sollen.
In der Formanlage dieses Buches habe ich mich (auch) an Sei Shōnagons Kopfkissenbuch orientiert. So gibt es lauter mehr oder minder kurze und in sich geschlossene Texte, die der Leser wie knappe Meditationen, Gedankengänge oder auch emotionale Ausbrüche lesen kann. Eingestreut habe ich kurze Gedichte, die ich in meiner Kindheit geschrieben und deren Gedichtformen ich bis heute beibehalten habe. (Über ihre Herkunft habe ich in meinem Roman Der Stift und das Papier ausführlicher erzählt.) Daneben gibt es Listen, Dialoge mit anderen Menschen, kurze Inhaltsangaben von Projekten, O-Töne aus meiner Umgebung und vieles andere mehr.
Im Ganzen ist auf diese Weise ein buntes Kaleidoskop (und keine durchlaufende Reflexionsprosa) entstanden. Die Mischform der vielen sehr unterschiedlichen Kurztexte soll etwas von der Lebendigkeit und Fülle der zugrundeliegenden »Lebensprosa« wiedergeben. So, als wäre alles noch keineswegs sicher, zur Ruhe gebracht und damit abgegolten, sondern als wäre vieles noch sehr in der Schwebe, unruhig und inspirierend.
Daher »bekennt« sich in diesem Buch ein Ich in vielen unterschiedlichen Rollen und Lebensaltern: Das Kind macht seine ersten Beobachtungen, der Pubertäre versucht, sich zu orientieren, und der Mann mittleren und höheren Alters gibt sich erfahren, verständig und an jeder Kleinigkeit interessiert, nicht ohne die Neugierde laufend anzufachen und anzustacheln, damit die alte, nicht versiegende Unruhe immer wieder Überraschendes und Unerkanntes hervorbringt.
Hanns-Josef Ortheil
Stuttgart, Köln, Wissen an der Sieg,
im Frühjahr 2016
Reisen
Autofahren 1
Ich fahre nicht gern mit dem Auto. Obwohl ich seit Jahrzehnten eines besitze, gehe ich vor jeder Fahrt mit leichtem Widerwillen darauf zu, während das Fahrzeug mit sturer Geduld auf mich wartet. Eigentlich will ich nicht einsteigen, nein, ich will mich nicht in einen unbequemen Autositz pressen und stundenlang in peinlicher Bewegungsstarre festhalten lassen.
Sitze ich dann doch, mache ich oft etwas verkehrt und tue so, als hätte ich vergessen, wie man überhaupt Auto fährt. Ich bin nicht der routinierte Autofahrer, der sich längst an alles gewöhnt hat, sondern der ewige Anfänger, der noch darüber nachdenken muss, wie er für die richtige Innentemperatur sorgt und die Lüftung perfekt einstellt. Dabei weiß ich doch genau, dass ich die Lüftung nie richtig werde einstellen können, denn alles, was mein Wagen an Technik und Komfort zu bieten hat, erschließt sich nur über Gebrauchsanweisungen der Hersteller. Diese dicken Bücher mit all ihrem penetranten Technikerempfehlungsdeutsch lese ich aber nicht. Die Technik sollte sich leicht erschließen. Sie will jedoch beachtet, bedient und laufend neu eingestellt werden. So etwas ist nicht nur lästig, sondern auch unverschämt. Schließlich sollte die Technik auf mich und meine Wünsche eingehen und sich daraufhin von selbst einstellen, anstatt von mir immer wieder neu mit hilflos herumtastenden Fingern bedient zu werden.
Fahre ich dann endlich los, erscheinen mir die nächsten Stunden, die ich wie ein Gefängnisinsasse in meinem Wagen verbringe, als reinste Zeitverschwendung. Alle Vergnügen, die ich sonst liebe, sind streng verboten. Ich kann weder etwas Gescheites essen noch trinken, ich kann weder lesen noch Klavier spielen, ich darf lediglich Musik hören oder eine der chic gewordenen Hörbuchkassetten einlegen, um der 13. Fortsetzung von Theodor Fontanes »Effi Briest« ergeben zu lauschen.
Immerhin, die Hörbuchkassetten sind eine gute Erfindung und für einen Autofahrer wie mich eine gewisse Wohltat. Allerdings verleiten sie dazu, das Autofahren nun vollends zu ignorieren und sich ausschließlich auf den gehörten Text zu konzentrieren. Meist wird mir viel zu spät klar, dass ich mich zwar im zehnten Kapitel von »Effi Briest«, gleichzeitig aber auch auf der Autobahn zwischen Darmstadt und Frankfurt und damit auf einem Autobahnstück befinde, auf dem ich mich gar nicht befinden sollte.
Vor lauter Zuhören und gedanklichem Mitgehen bin ich von meiner eigentlichen Route abgewichen und treibe nun auf Gegenden zu, auf die ich nicht zutreiben dürfte. In solchen Fällen hilft alles nichts, ich muss auf einen Parkplatz fahren, den Wagen einige Minuten zur Ruhe kommen lassen, »Effi Briest« sofort aus meinem Kopf wegblenden, um dann wieder (scheinbar gelassen) einzusteigen und (wie das Navigationsgerät empfiehlt) »wenn möglich bitte (zu) wenden«.
Hätte ich bloß früher auf dieses Gerät gehört, aber ich höre darauf nicht, wenn eine Hörbuchkassette läuft und erst recht nicht, wenn ich Musik höre, die mich begeistert. Eigentlich höre ich fast nie auf das Navigationsgerät, ich lasse es reden und Strecken empfehlen und verkünden, dass soeben eine neue Routenberechnung vorgenommen wurde – all das ist mir gleichgültig, denn ich empfinde eine gewisse Schadenfreude, wenn ich anders fahre, als das Gerät empfiehlt. Aus eigenem Antrieb, mit eigenem Willen, strikt gegen alle noch so tüchtigen Empfehlungen für eine »dynamische Route«!
Ich mag weder »dynamische« noch »sportliche« noch »effiziente« Routen, am liebsten würde ich stets auf den entlegensten, langsamsten fahren und natürlich am allerliebsten nicht auf Autobahnen, sondern auf Landstraßen ohne Mittellinie. Ganz im Abseits, im Nirgendwo zwischen Brumpfdorf und Rumpfdorf an Feldern und Wäldern entlang – das ist gerade noch erträglich, denn es lässt einem Zeit, auch auf die Umgebung zu achten. Ein Habicht auf einem Feldzaun! Die kleine Schar Kühe vor einem Unterstand! Wie sich die Wolkenmassen über den nahen Hügeln herumlungernd ausbreiten, als warteten sie auf den richtigen Zeitpunkt, endlich all das Wasser abzulassen, das sich gerade in ihnen staut! So etwas zu sehen und sich ihm zu widmen, macht seltsam ruhig und führt oft dazu, dass ich anhalte, aussteige und ein Stück spazieren gehe. Ist ein Gasthof in der Nähe? Oder wo gäbe es sonst etwas an guten, ländlichen Freuden?
Es kommt gar nicht so selten vor, dass ich wirklich einen Gasthof finde, der etwas Überraschendes, ländlich Fernes hat. Keine Anbindung an die neusten Gastromoden. Einfach Schwein, Rind, Kalb oder Lamm von der nächsten Weide geschlachtet und schlicht zubereitet! Und dazu die genau passenden Getränke, eisgekühltes Bier oder einen Grauburgunder vom Weinberg gerade hinter dem Haus! Sind keine freundlichen Einheimischen für ein Gespräch da, reichen notfalls auch ein paar Tageszeitungen aus dem ländlichen Umkreis. Ich sitze, esse, trinke und lese – wie schön vergehen doch solche Stunden, so schön, dass ich den Wagen vollends stehen lasse und mich danach erkundige, ob in dem entlegenen Gasthof noch ein Zimmer frei ist.
Meist ist eines frei. Wie gut! Wie entgegenkommend! Ich hole meinen kleinen Allerweltskoffer aus dem Auto und lasse dem Wagen wie einem müden Gaul seine nächtliche Ruhe, soll er doch weiter geduldig und apathisch dreinschauen und warten: ich kann ihm einfach nicht helfen – wir sind nicht füreinander gemacht.
Aufbruch
Ich: Wo ist die Brille?
B: Welche Brille?
Ich: Die Sonnenbrille, Du weißt schon.
B: Die steht Dir nicht, Du siehst furchtbar damit aus.
Ich: Wo ist sie? Ich sehe fast nichts.
B: So schlimm ist es doch gar nicht.
Ich: Schaust Du jetzt bitte mal im Handschuhfach nach.
B: Dass es dieses Wort überhaupt noch gibt.
Ich: Welches Wort?
B: Handschuhfach!
Ich: Schaust Du jetzt bitte mal nach? Die tief stehende Sonne blendet.
B: Tief stehende Sonne … auch so eine altertümliche Wendung.
Ich: Ich hätte jetzt gern mal meine Sonnenbrille …
B: Du siehst damit aus wie ein Zuhälter aus Köln-Mülheim …
Ich: Wieso denn das?
B: Als hättest Du was zu verbergen …
Ich: Was sollte ich schon verbergen …
B: Lassen wir das … (schaut im Handschuhfach nach) … Da ist sie nicht.
Ich: Aber da war sie immer …
B: Manchen steht sie … manchen aber kein bisschen.
Autofahren 2
Vielleicht hat meine Abneigung gegenüber dem Autofahren auch damit zu tun, dass ich als Kind nicht frühzeitig daran gewöhnt worden bin. Anders als die Eltern meiner Klassenkameraden besaßen meine Eltern nämlich sehr lange kein Auto, und als sie sich endlich eins anschafften, waren diesem Kauf lange Debatten darüber vorausgegangen, ob wir denn wirklich ein Auto brauchten. Viele Jahre sind wir nur mit der Bahn gefahren – was hatte nähergelegen, als genau das zu tun, arbeitete mein Vater doch als Vermessungsingenieur für dieses alte, stolze Unternehmen und konnte uns daher in den schönsten Abteilen mitbefördern.
Wir gingen sehr viel zu Fuß, fuhren nie Bus, sondern höchstens Straßenbahn und bewältigten längere Strecken ausschließlich im Zug. Kein einziges Auto konnte ich als Kind an der Marke erkennen, Lokomotiven dagegen erkannte ich auf den ersten Blick. Nie kam es uns seltsam vor, ausschließlich mit der Bahn zu fahren, vielmehr hielten wir das für »natürlich« oder »normal«, als wäre die Bahn ganz selbstverständlich für uns da, wie ein uraltes Fuhrunternehmen, das zur Familie gehörte.
Als wir uns schließlich doch ein Auto gekauft hatten, parkte dieses Auto oft tagelang vor der Haustür. Kürzere Strecken gingen wir weiter zu Fuß, etwas längere fuhren wir mit der Straßenbahn – und für noch längere Strecken taugte das Auto nicht, weil es (wie mein Vater sagte) »zu unbequem« sei. Wann also konnte das Auto überhaupt zum Einsatz kommen? Ausschließlich, um etwas schwerere Waren aus der Innenstadt in unsere Wohnung zu befördern! So wurde das Auto zu unserem Gepäckträger und hatte außerhalb dieser Dienste frei.
Erst nach langem Stillstehen kam es häufiger zum Einsatz, und das auch nur, weil ein Kollege meines Vaters behauptet hatte, ein Auto müsse »dann und wann auch gefahren oder bewegt werden«. Mein Vater glaubte solchen Behauptungen sofort. Im Grunde verstand er nicht viel von Autos, wohl aber von Lokomotiven – und natürlich war in seinen Augen das Lokomotivwissen ein weitaus interessanteres, anspruchsvolleres als das Autowissen. Lokomotiven fuhren nur aufgrund schwer zu verstehender, komplizierter Gesetze, Autos dagegen fuhren einfach von selbst, man musste nur etwas Gas geben!
Und so nahm mich mein Vater als seinen Beifahrer und Begleiter mit auf kleine Touren durch die nähere Umgebung. Diese Fahrten dauerten meist nicht mehr als eine Stunde und führten zu irgendeinem Aussichtspunkt in der Nähe von Köln, von dem aus man »die halbe Welt auf einen Blick« (Vater) überschauen konnte. Oft gingen wir in der Umgebung eines solchen Höhenpunkts noch etwas spazieren, um schließlich am Rand eines Waldes auf eine Bushaltestelle zu treffen und mit dem Bus wieder nach Köln zurückzufahren.
Dort fiel uns dann auf, dass wir unseren Wagen in der Nähe des Aussichtspunkts stehen gelassen hatten. Wir hatten ihn einfach vergessen, denn wir waren nicht daran gewöhnt, ihn im Auge oder in Erinnerung zu behalten. An einem der folgenden Tage mussten wir den irgendwo abgestellten Wagen zurückfahren, manchmal hatte er während seiner einsamen Stunden ein paar Stöße und Püffe abbekommen und sah ramponiert aus – und einmal hatte jemand sogar eine Scheibe zerschlagen und ihn gewaltsam geöffnet, ohne etwas Nennenswertes in ihm zu finden.
Mein Vater sagte nach solchen Missgeschicken (die gar nicht so selten vorkamen), dass sich der Wagen »von uns entfremdet habe«. Das hörte sich so an, als hielte er ihn für ein lebendiges Wesen mit eigenen Launen und einem undurchsichtigen Charakter. Wenn er einstieg und der Wagen erstmal nicht anspringen wollte, sagte er »na willst du wohl!« oder auch »was hast du denn heute wieder?« Der Sturkopp oder die Mimose benahmen sich dann auch während der Fahrt seltsam, sie würgten ab oder rasselten mit uns unbekannten Teilen des Motors. Passierte so etwas während einer Fahrt häufiger, war es mein Vater irgendwann leid und parkte den Wagen am Straßenrand. »Dann bleib doch, wo du bist«, rief er ihm beim Weggehen zu, und es klang wie das Wort zur endgültigen Scheidung.
Erst Tage später fuhr er ihn wieder zu unserem Haus zurück (»na, geht doch!«). Danach aber beachtete er ihn tagelang nicht, sprach nicht mit ihm und ließ ihn stehen, bevor er ihn (als ginge es um einen Akt der Versöhnung) noch einmal »um den Block« fuhr (fünf Minuten, als wollte er ihn testen). Passierte auch auf dieser kurzen Tour etwas nicht Erwartetes, wurde der Wagen umgehend verkauft. Auf diese Weise durchlitten wir in wenigen Jahren viele Autos (alle von der Marke VW). Keines fand Gefallen an uns, alle »entfremdeten« sich schon bald – und so gaben wir es schließlich auf, uns an ein Auto zu gewöhnen, und fuhren wieder nur noch mit der Straßenbahn und mit dem Zug.
Gedichte aus der Kindheit
1962, im Frühjahr
Wir fahren ein Auto,
das keiner will.
Wir fahren ein Auto,
das uns nicht mag.
Wir fahren ein Auto,
das uns bald nicht mehr gehört.
1962, im Frühjahr
Papa sagt,
ein VW sei ein Kompromiss.
Ein Mercedes
wäre aber auch ein Kompromiss.
Im Grunde sind alle Autos
Ein übler, peinlicher Kompromiss.
Zug fahren 1
Genau so ist es bis heute geblieben. Ich fahre gern mit einer Straßenbahn und noch lieber mit einem Zug, selten aber mit einem Bus und nur ungern mit einem Auto. Der Bus ist nichts anderes als ein etwas längeres Automobil, deshalb mag ich auch das Busfahren nicht. Die Straßenbahn dagegen hat etwas von einem Zug, man kann sie durchqueren, den Platz wechseln, man kann in ihr stehen, all das macht sie zu einer kleinen Verwandten des viel größeren Zugs.
Fast jede Woche bin ich mit einem Zug durch halb Deutschland unterwegs, meistens mit einem ICE. Ich habe mich in den letzten Jahrzehnten derart an das ICE-Fahren gewöhnt, dass ich den ICE selbst kaum noch bemerke. Die Gewöhnung hat dazu geführt, dass ich ihn als einen vertrauten Wohnraum empfinde. Einen Platz zu belegen, bedeutet dann: für drei oder vier Stunden wieder zu Hause einzuziehen und es sich möglichst bequem zu machen.
Das klappt natürlich am besten in einem sonst leeren Abteil, wie es fast jeder ICE vor allem spätabends und nachts anbietet. In einem sonst leeren Abteil unterwegs zu sein, erlebe ich jedes Mal als ein besonderes Vergnügen. Denn das leere Abteil ist letztlich nichts anderes als ein kleines Zimmer mit Tisch, Leselampen und Lesesesseln. Auf den Tisch gehören ein gutes Getränk und ein paar kleine Speisen, die Leselampen lassen meine Lektüren (möglichst alle in der 1. Klasse kostenlos angebotenen Zeitungen, daneben drei oder vier Bücher, in denen ich abwechselnd lese) erstrahlen, und die Lesesessel sorgen dafür, dass ich mich manchmal zurücklehnen und entspannt Musik hören kann. Manchmal habe ich sogar einen kleinen Lautsprecher der Firma Bose dabei. Ein solcher Lautsprecher bringt – in Verbindung mit einem Smartphone – eine Musik zustande, die das sonst leere Abteil in einen Konzertsaal verwandelt.
All diese Zutaten und Arrangements machen aus einer banalen Zugfahrt eine unterhaltsame Séance mit lauter fernen Gesprächspartnern (Schriftsteller, Musiker, Künstler), die einen mit der Zeit vergessen lässt, dass man außerdem noch ein Ziel hat. Und wirklich ist es schon mehrmals vorgekommen, dass ich über mein eigentliches Ziel »hinausgeschossen« bin und vergessen habe, rechtzeitig auszusteigen. Komme ich aber glücklich irgendwo an, könnte ich oft behaupten, nach einer solchen Fahrt nicht mehr dieselbe Person zu sein wie die, die vor Kurzem noch in einen ICE eingestiegen ist. Die Fahrt hat mich ein wenig verändert, sie hat mich (wie eine Abenteuerreise in alten Tagen) durch unbekannte Kontinente (des Lesens und Musikhörens etc.) geführt. Wenn ich den ICE endlich verlasse, bin ich in Gedanken nicht dort, wo ich gerade ankomme, sondern in einer durch die Reise geweiteten Kopflandschaft.
Tagsüber jedoch gelingt mir das weitaus schwerer. Zum einen sind zu viele Parallelreisende in einem ICE unterwegs. Meist telefonieren sie lange oder unterhalten sich übertrieben detailliert und laut mit einem Gesprächspartner. Andere suchen während einer Fahrt mindestens dreimal eine Toilette auf, während die Exhibitionisten jede Fahrt dazu nutzen, den ganzen Zug mehrmals ganz zu durchwandern, um sich allen Mitreisenden mindestens zweimal von allen Seiten zu zeigen. Dagegen hilft, die Fahrt im Speisewagen zu verbringen (jedoch nicht im Bistro!, das Bistro ist entschieden zu klein!). Selbst in sonst vollen Zügen ist der Speisewagen ein kleines Refugium der Ruhe und Konzentration, drei oder vier Bücher direkt vor einem auf dem Esstisch sorgen für eine gute Abschirmung, und wenn man nach etwas gefragt oder sonst gestört wird, antwortet man auf Italienisch oder erklärt in gebrochenem Deutsch, dass man des Deutschen leider »nicht mächtig« sei.
Manchmal gelingt in einem Speisewagen aber auch so etwas wie gute Konversation. Seltsam ist, dass ich oft schon in der ersten Minute bemerke, ob das gelingt oder nicht. Ich habe keine einleuchtende Erklärung für das, was in solchen Momenten geschieht, aber ich weiß, dass sie sich immer wieder von selbst ergeben und man sich oft über etwas unterhält, über das man bis zu diesem Zeitpunkt selten oder fast noch nie gesprochen hat. Durch einen Zufall nenne ich den Namen eines Musikers oder Künstlers – und als wäre mein Gegenüber eine Art magnetischer Pol, antwortet er sofort auf eine derart verblüffende Weise, dass uns beiden in den nächsten Minuten lauter Interessantes über den erwähnten Musiker oder Künstler einfällt.
Solche unerklärlichen Annäherungen erscheinen mir so, als »zelebrierten« wir gemeinsam das Fest eines Namens oder einer Sache. Während wir uns immer einfallsreicher über sie unterhalten, erscheinen wir wie kleine Affizierte, die einem Idol huldigen. Wir baggern in unserem Geheimwissen, das uns in all seinen Details zuvor kaum bekannt war, wir kramen darin und fördern Schätze an kleinen Einsichten zutage, die wir ohne unser Gegenüber nie in uns entdeckt hätten. Alles stimmt – die Nähe zu einem bestimmten Objekt, das Temperament des Gesprächs, die Lust, nicht aufhören zu wollen, sondern sich immer länger »gehen zu lassen«. Man könnte sagen: Zwei Gesprächspartner haben einen idealen Spiegel gefunden, um ihre eigenen Themen durch die Spiegelung erst so recht zu erkennen und zu begreifen.
Sitze ich dagegen in einem überfüllten Großraumwagen, schaue ich nicht selten lange Zeit zum Fenster hinaus. Kaum ein Reisender schaut noch aus einem Fenster hinaus auf die vorbeiziehende Landschaft. Alle sind meist auf erstaunlich kindische Art beschäftigt. Sie dösen intensiv, lösen Kreuzworträtsel, widmen sich auf dem Laptop albernen Spielen, blättern laut raschelnd die Zeitungen durch oder beißen krachend in den einen mitgebrachten Apfel (ich kenne kaum ein hässlicheres Geräusch – höre ich den ersten Biss, stehe ich sofort auf, trete die Flucht an und bleibe so lange fern, bis der Apfel bis auf den Kern abgeknabbert ist).
Aus dem Fenster zu schauen, demonstriert Hilflosigkeit. Es gelingt mir nicht, lange an etwas Anspruchsvollem zu arbeiten oder andere Genusskanäle zu aktivieren. Die vielen Störungen durch meine Umgebung lassen mir nur die Wahl des meditativen Schauens und Betrachtens: Wo bin ich? Richtig, kurz vor Mainz, in dieser sandsteinroten Rheinlandschaft mit den Pappelreihen am Horizont! Schaue ich lange und intensiv genug hin, nehme ich zu diesen Landschaften Kontakt auf. Ich gehe für ein paar Minuten durch sie hindurch, ich bin der ferne Fahrradfahrer, der sich auf dem schmalen Feldweg durch die Landschaft bewegt, oder ich bin der Spaziergänger mit Hund, der an einem Feld mit hohen Maisstauden entlangstreift.
Wird der Kontakt stärker, packt mich eine nur schwer zu bekämpfende Lust, sofort auszusteigen und mich in solche Figuren zu verwandeln. Wie schön könnte es sein, die Reise jetzt zu unterbrechen, das Ziel zu vergessen und sich in der nahen Landschaft für ein paar Stunden zu verlieren! Immer wieder (fast auf jeder Fahrt) regen sich in mir solche anarchischen Gedanken: Auszeit!, Unterbrechung!, rasch hinein in ein anderes, abenteuerlicheres Leben! Es meldet sich ein seltsames Abenteuergen, das mich anmacht, alles liegen zu lassen und nichts anderes zu tun als: »davonzugehen«.
Dieses Gen habe ich von meinem Vater geerbt. In meiner Kindheit bin ich oft mit ihm »davongegangen«, einfach so, von einem Moment auf den andern. Wir saßen zu Hause beim Frühstück, und mein Vater räusperte sich und sagte »wir gehen jetzt los«, und dann standen wir beide auf, verließen die Wohnung und gingen so lange, bis uns ein Ziel einfiel. Wird mir langweilig, gehe ich noch heute einfach davon, ja, es ist schon oft vorgekommen, dass ich irgendwelchen Verpflichtungen (Teilnahme an einem Literaturfestival, mehrstündigen Sitzungen in bestimmten Kommissionen) entkommen bin, indem ich »einfach davonging«. (Und das geht wirklich sehr »einfach«: Man steht auf und geht …, man geht, solange man will, man erklärt einen sich irgendwann auftuenden, einladend erscheinenden Raum schließlich zum Ziel und ruft beim Veranstaltungsort an, um sich krank zu melden).
Das meditative Aus-dem-Fenster-Schauen dagegen habe ich eindeutig von meiner Mutter geerbt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie während einer Zugfahrt je etwas anderes getan hätte. Sie las nicht, sie nahm nie etwas zu sich, sie unterhielt sich nur mit wenigen Worten, und wenn sie sprach, sprach sie von dem, was sie sah. Unzählige Male bin ich mit ihr die gewundene Bahnstrecke von Köln Richtung Siegen entlang der Sieg gefahren – und jedes Mal gerieten wir fast aus dem Häuschen, wenn wir den schmalen Fluss sahen: »Die Sieg! Da ist sie!« (Als hätte sie seit unserer letzten Fahrt auch davonfliegen können …) Hatten wir sie entdeckt und ausgemacht, folgten wir ihrem Lauf mit den Augen, indem wir lauter Beobachtungen über ihren Zustand austauschten. Im Winter waren die Ufer »struppig, von Geröll überschwemmt«, und im Sommer waren sie »eine Pracht: diese Schilfgehänge, die so tun, als wären sie Theatervorhänge für ein Puppentheater«.
Wenn ich heutzutage allein in einem ICE sitze und hinausschaue, beginnt meine Mutter in mir zu reden. Schon bald quillt das Geredete und Besprochene über, und ich muss es notieren. Ich sitze da, schaue hinaus und schreibe auf, was mir meine Mutter diktiert. Oft fragt mich dann jemand: »Was gibt es da draußen denn so Besonderes zu sehen?« Und ich antworte: »Ich liebe die schmalen, milchgrauen, geschotterten Wege, die sich in Serpentinen einen Hügel hinaufziehen.« Mein Gegenüber starrt hinaus, aber er findet nicht, wovon ich spreche. Und so lässt er mich allein mit meinen Beobachtungen und Fantasien und mit all den Geschichten, die ich der vorbeiziehenden Landschaft entnehme.
Könnte man dieses Sehen und Schauen nicht eine Lust nennen? Ja, es handelt sich wohl um eine Ausprägung der Schaulust. Die Schaulust geht der Fotografie voraus, die Fotografie hat versucht, sich ihrer zu bedienen und das ihr Eigentümliche zu bewahren. Während ich aus meinem Zug hinausschaue, fotografiere ich aber nie. Die Augen fotografieren und filmen, und das Gesehene zieht ein in den Körper, um ihn auf die Umgebung hin zu polen und auszurichten. Eine wirkliche Fotografie dagegen würde mich von dieser langsamen Osmose trennen und mich wieder auf Distanz zu den Dingen bringen. Reales Fotografieren funktioniert so nicht, sondern anders. Meine Mutter hat nie fotografiert, aber ich weiß: Sie hatte Millionen von entwickelten, fertigen Schwarz-Weiß-Fotografien im Kopf.
O-Ton
Liebe Reisende, in Kassel ist unser mobiler Erdnussverkäufer zugestiegen, der Sie an Ihrem Platz mit frisch gerösteten Erdnüssen gerne bedient.
Liebe Reisende, wir möchten Sie noch auf unseren gastronomischen Service in Wagen 8 aufmerksam machen. Wie wäre es mit Königsberger Klopsen auf Himalaya-Reis? Oder wie wäre es mit einem leckeren Stück Bananenkuchen mit einer Tasse Kaffee? Unser Serviceteam erwartet Sie gerne vor Ort. In der 1. Klasse werden Sie von unserem liebenswürdigen Herrn Stüber auch an Ihrem Platz bedient. Kosten Sie einfach einmal, Sie werden es nicht bereuen!
Zug fahren 2
Jede Zugfahrt ist gleichsam das Unikat einer Aufführung oder eines zeitlich begrenzten Schauspiels mit mehreren Akten. Da ich häufig fahre, kann ich schon zu Beginn relativ genau darüber spekulieren, wie diese Aufführung sich gestalten wird. Solche Spekulationen sind keineswegs vage Vermutungen, sondern beziehen sich auf die ersten Beobachtungen vor Ort. Sie gelten zunächst dem Zugpersonal, dann den wahrgenommenen Atmosphären im Zuginnern und schließlich auch den Fahrgästen und der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen.
Der erste Eindruck beim Betreten des Zuges lässt erkennen, wie der Zug besetzt ist und wie die jeweils besondere Besetzung ihn prägt und bestimmt. Es gibt Züge, in denen sich die Reisenden nur in bestimmten Wagen drängen und zu geballten Unterhaltungszentren verklumpen, während in den Abteilen des Nachbarwagens jeweils ein Einzelgänger mit seinem Laptop spielt. Und es gibt Züge, in denen kleine, umherziehende Gruppen unaufhörlich unterwegs sind, das Bistro belegen, zwei Abteile bis auf den letzten Mann besetzen und alle halbe Stunde neue Formationen eingehen.
Im Normalfall sind aber sehr viele Alleinreisende unterwegs, die sich beim Betreten des Zuges in Kämpfer um Einzelplätze verwandeln. Bis etwa zehn Minuten nach Abfahrt herrscht diese kämpferische, aggressive Stimmung, die von jenen Reisenden beherrscht wird, die Plätze reserviert haben. »Das ist mein reservierter Platz!« ist ein Satz, der in Deutschland im Offiziers- und Befehlston ausgesprochen wird. Alle anderen Reisenden haben sich dem Befehl, den jeweiligen Platz sofort zu verlassen und freizugeben, zu beugen. Dagegen hilft nur, ein kleines Gebrechen vorzutäuschen und sich hinkend, einen Fuß langsam und schwer hinter sich herziehend, davonzuschleppen. Vor allem Menschen mit ausgeprägtem Mitleid geben die Reservierung eines Platzes in einem solchen Fall ohne Murren oder Kommentar auf.
Stark werden die Zugatmosphären durch den Zugführer und das Personal geprägt. Nichts ist schlimmer als redselige Zugführer, die an ihrem Mikrofon hängen und an jeder Station sämtliche erreichbaren Zugverbindungen von Kleindödel nach Kleinblödel durchgeben, und das jedes Mal vor einer Ankunft und nach einer Abfahrt – und vielleicht sogar noch auf Englisch. Die sehr weisen, äußerst raren und hochkarätigen Zugführer dagegen sagen fast nichts außer »Wir begrüßen die neu zugestiegenen Fahrgäste und wünschen Ihnen eine gute Fahrt!« Dieser geradlinige, schöne und einfache Satz wird samtweich und leise gesprochen, als wollte er gleich wieder verschwinden. Er weht wie ein Begrüßungshauch durch den Zug und löst sich in Luft auf, während die geballten fünf- bis zehnminütigen Durchsagen samt der Empfehlung von Königsberger Klopsen oder »einem Stückchen Schokoladenkuchen plus einer Tasse Kaffee«, die »unser Bordpersonal Ihnen gerne serviert«, zu den gröbsten Verstößen gegen die gebotene Zugruhe gehören.
Denn in den besten Momenten kann sich auch in einem voll besetzten ICE auf einer stark befahrenen Strecke das Wunder einer fast unglaublichen Stille ereignen. In den Großraumwagen arbeiten die Fahrgäste leise und konzentriert vor sich hin. Niemand unterhält sich oder plappert Zeittotschlagungsdeutsch, die Ruhe hat vielmehr etwas so Ansteckendes, dass auch die Neuankömmlinge sofort still auf ihre Plätze sinken und sich tiefsinnig stellen. Der Zugführer sitzt in seiner kleinen Kabine und kaut gedankenverloren sein Zugführerbrot, und das übrige Zugpersonal gönnt sich eine Ruhe- und Schlafpause in den leeren Abteilen. Keine einzige Schweinskopfsülze samt Weizenbier wird durch den halben Zug vom Speisewagen bis in die 1. Klasse getragen, und niemand zerreißt dort die Gratiszeitungen in kleine Streifen, von denen er die eine Hälfte unter seinem Sitz verteilt, während er die andere in Klarsichtfolien verstaut, um sie mit nach Hause zu nehmen.
Ich liebe diese Epiphanien der Stille in voll besetzten Zügen, sie haben etwas Sakrales, Frommes, als verstünden alle Reisenden plötzlich, wie das richtige Leben so geht. Und wirklich sitzen die meisten Reisenden da wie Bekehrte, die manchmal traumverloren an die Decke blicken oder den letzten tumben Tor, der noch einmal den Zug durchqueren möchte, lächelnd anschauen. »Es sei Dir vergeben!« bedeutet dieses Lächeln, »Du gehst noch und schleichst Deiner kleinen Unruhe nach, wir aber haben uns eingefunden im Reich des japanischen Haiku- und Zen-Meisters Bashô, der uns im siebzehnten Jahrhundert das dreizeilige Dichten lehrte.«
Mitten in diese gloriose Stille hinein können freilich manchmal drei hohe, beißende Töne fahren. Es handelt sich um ein Pfeifen oder Piepen von wenigen Sekunden (in Form einer Terz), aus dem nur einige sehr erfahrene Reisende richtige Schlüsse ziehen. Die beißend hohen Töne in Form einer Terz werden von der »Betriebsleitung in Karlsruhe« ausgesendet, um den bereits halb eingeschlafenen Zugführer zu wecken. »Wach auf!« schreien sie, »bereite Dich aufs Schlimmste vor, denn Deinem Zug droht Übles: Gleich wird er für eine Stunde stillstehen oder einen Umweg von drei Stunden fahren oder im nächsten Bahnhof für heute enden …«
Erfahrene Reisende stellen sich, wenn sie diese Töne gehört haben, auf alles ein und ziehen sofort in Richtung Speisewagen, um sich mit allen noch vorhandenen Getränken zu versorgen. Zehn Minuten nach Erklingen der Katastrophensignale sind Bier und Wein ausverkauft, und es gibt nur noch Getränke für Kinder. Ich selbst öffne in solchen Fällen meinen Allerweltskoffer und hole meine Notversorgung für die nächsten Stunden heraus. Einen dicken Roman von nicht unter 800 Seiten, eine kleine Flasche Portwein aus dem Douro-Tal samt einem Portweinglas mit sehr schlankem Kelch und kandierten Ingwer in kleinen Stücken. Ich postiere alles auf meinem Klapptisch und gönne mir den ersten Schluck. Kaum jemand um mich herum versteht, was ich da treibe, aber ich weiß: Das Stellwerk kurz vor Gelnhausen hat wieder seinen Aussetzer, das kostet uns anderthalb Stunden, ich nenne sie die Gelnhausener Freizeit, und ich genieße sie, indem ich nach Portugal reise.
O-Ton
Ich bin gleich in Göttingen. Göt – tin – gen!! Ja, genau, Göttingen! Die Stadt, die Wissen schafft! (lautes, hämisches Lachen) Zum Schießen, was?! Die Stadt, die Wissen schafft! Göttingen! Ausgerechnet! Was machen die Kinder? Aber wieso denn? Wieso denn bitte schön? Verstehe ich nicht! Ich verstehe das einfach nicht. Und ich möchte mich jetzt auch nicht damit beschäftigen! Nein! Jetzt nicht! Absolut nicht! Ich werde jetzt in den Speisewagen gehen und mir einen reinziehen! Oder besser noch zwei! Gleich hinter Göttingen! Schluss. Aus. Ich schaffe jetzt Tatsachen. Ende.
Dann leiten Sie die Dateien Exfin mal bitte gleich an mich weiter, Frau Stabel! Die Regenrinnen sind noch nicht drauf auf der Rechnung, oder? Die übernehmen wir dann aus der Datei Dortmund, Sie wissen schon. Und die bleiverzinkten Rohre, 16 Millimeter, Flankenabtrennung, die bieten Sie mit an. Machen Sie einen Vermerk. Die sind nur noch bis Ostern zu haben. Und knallen Sie noch ein paar Transportprozente auf die Mülldestillerien! Zehn Prozent! Das müssen die schlucken! Müll ist das Teuerste überhaupt, das begreifen heutzutage selbst solche Dödel wie die von Simske & Co.
Fliegen
Erst im Alter von Mitte zwanzig bin ich das erste Mal mit einem Flugzeug geflogen. Und seit diesem ersten Mal mag ich fast nichts am Fliegen. Ich hasse die umständliche Anfahrt zu meist hässlichen Flughäfen und das lange Warten in der Schlange vor den Personenkontrollen, ich mag das langweilige Herumlungern inmitten einer apathischen Reiseschar eine Stunde vor Betreten des Flugzeugs nicht, und ich schwöre mir beim Platznehmen auf einem viel zu engen Sitz jedes Mal, nie mehr zu fliegen.
Dann sitze und warte ich, in Flugzeugen kann ich keine Bücher, sondern nur Zeitschriften oder irgendwelche Broschüren lesen, auch das ärgert mich. Kurz darauf jedoch kommt der seltsame Augenblick, um dessentwillen ich noch immer fliege. Es ist der Moment etwa vier oder fünf Minuten nach dem Abflug. Die grauen, braunen oder dunkelgrünen Streifen Landes werden langsam wie ein entschwebender Teppich unter einem weggezogen, und wie eine schwere Feder wird man emporgehoben in den Reigen der Wolken und – wenn es besonders schön wird – ins gleißende Sonnenlicht.
Es sind Minuten des Abschieds von aller Erdenschwere, die einem suggerieren, der Mensch sei zumindest partiell auch für das Fliegen gemacht. Sie gelingen aber nur, wenn das Flugzeug sich kaum zu bewegen, sondern wie erstarrt über den Wolken im Sonnengold zu verharren scheint. Die Zeit steht still, die Umgebung wächst zu einem Bild zusammen, alles hält den Atem an. Das genau ist der große, starke Moment des Fliegens: Die Reglosigkeit der künstlich erscheinenden Welten weit oberhalb der Erde, die Entgrenzung, das Gefühl, in andere Szenen jenseits des Irdischen hinaufkatapultiert worden zu sein.
Längst bewegt sich auch das Flugpersonal mit seinem schmalen Wägelchen durch die Reihen und bedient die Gäste. Ich habe nie begriffen, wie man angesichts des Sonnengolds und der watte- und bettähnlichen Wolkenversammlungen einen Kaffee oder gar einen Tee bestellen kann. Ich verstehe auch nicht, warum ich in Tausenden Meter Höhe ausgerechnet einen Tomatensaft trinken sollte. Ganz zu schweigen von jenen seltsamen Produkten, die einem zum Essen angeboten werden: verknautschte Brote mit herausquellendem Billigbelag, angetrocknete Toastbrotscheiben, von Weichtomaten durchtränkt, Roastbeefscheiben mit dunklen Altersrändern, auf denen sich einige Minigürkchen herumräkeln.
Nirgendwo erscheint mir Essen so überflüssig wie während eines Flugs, und nirgendwo verabscheue ich das (natürlich kostenlos) gereichte Mineralwasser mehr. Für mich gibt es nur sehr wenige Getränke, die zur Sonnengoldfeier hoch über den Wolken passen: Sekt, Prosecco oder Champagner, nichts sonst! Da aber genau diese absolut passenden Getränke etwas kosten, enthalten sich fast alle Fluggäste dieses Genusses und beharren in genau dem falschen Moment auf einem merkwürdigen Geiz. Und so sitze ich fast immer allein mit meinem Glas da und genieße das Beste, das leider verschmäht wird, in kurzen, winzigen Schlücken.
Stimmt es, dass Alkohol in Tausenden Meter Höhe eine stärkere Wirkung entfaltet als auf der Erde? Ich kann diese Frage bejahen. Schon nach wenigen Minuten durchrauscht mich eine intensive Belebungswelle, die sich mit der sowieso schon vorhandenen Himmelseuphorie auf ideale Weise verbindet. Wie schade, dass man in Flugzeugen nicht tanzen kann! Wie schade, dass jetzt niemand hoch, hell und leicht reißerisch singt – ein Sopran wie der von Cecilia Bartoli sollte die Mozart-Motette »Exsultate, jubilate« anstimmen, das wäre perfekt!
Enthoben- und Entrücktheit – das also macht die schönen Momente am Fliegen aus. Schon während der ersten Ansagen, die alle Fahrgäste auf die Landung vorbereiten, meldet sich jedoch wieder die leichte Depression, die sonst damit verbunden ist. Will ich wirklich in Berlin-Tegel landen und kurz nach meinen extremen Euphoriemomenten dort neben einem Laufband stehen, um Hunderte von muffigen Gepäckstücken kreisen und die ganze Vergeblichkeit des Daseins demonstrieren zu sehen?
Ich weiß, ich werde in einem irdischen Abseits weit von der nächsten Stadt landen, und es wird Stunden brauchen, bis ich mit Hilfe von Bus, Taxi oder Bahn im Zentrum ankommen werde. Abgeschnitten von allem gerade erlebten Schönen, werde ich langsam wieder auf irdische Verhältnisse umgepolt. Ich werde den Alltag einatmen, die Mühseligkeit aller Existenz, das Einerlei! Dagegen hilft nur, den Flug »ausklingen zu lassen«. Und wo geht so etwas? In einem Restaurant, das ich in der Stadt meiner Ankunft als Erstes aufsuchen werde, um dort meinen längst reservierten Platz einzunehmen.
»Sie sind zu zweit?« – »Ja, Frau Bartoli kommt etwas später.« – »Darf ich Ihnen schon etwas servieren?« – »Ja, servieren Sie zwei Glas Champagner und – wenn’s denn sein muss – die obligatorische Flasche Wasser. Das Wasser werde ich zur Ablenkung trinken, bis Frau Bartoli erscheint. Dann widmen wir uns dem Champagner!«
Mit wem ich gern ein Glas oder auch zwei Gläser oder auch eine Flasche Champagner trinken würde
Cecilia Bartoli
Etta Scollo
Sina Mainitz
Mariel Hemingway
Juliette Binoche
Emmanuele Béart
Greta Gerwig
Hélène Grimaud
Katharina Wagner
Christiane Arp
Japan
Ich werde wohl nie nach Japan fliegen, dabei liebe ich Japan sehr. Wie aber kann ich es lieben, wenn ich es doch überhaupt nicht kenne und auch keine Bücher lese, um mich mit dem gegenwärtigen Japan vertraut zu machen?
Ich liebe das alte Japan der Ostasiatischen Museen, das Japan der Bildrollen, der Wanderpoeten und Haiku, das Japan der kleinen Teehäuser mit Strohmatten auf dem Boden, das alte Japan der (eingebildeten, bloß vorgestellten) Stille. Ich kann mir gut den Reiz vorstellen, der den Haiku-Dichter Matsuo Bashô im siebzehnten Jahrhundert dazu trieb, Tausende von Kilometern durch das gebirgige Japan zu wandern, jeden Tag an ausgewählten Naturorten einen Andachtsmoment zu inszenieren, jeweils ein Haiku zu dichten, sich vor einer Kiefer oder einem Berg zu verneigen und stumm weiterzuziehen.
Schaue ich mir die Zeichnungen alter Wandbilder an, sehe ich ruhige Seen, Boote anscheinend ohne Bewegung, Menschen in kleinen Holzhütten und ein unvergleichliches Schimmern der Atmosphären. Das Licht lauert hinter den Bergen, ein Wind verfängt sich in einer Baumgruppe, am Rand des Sees kräuselt sich das Wasser ganz leicht, als hätten dort einige wenige Fische ihre Spuren gezogen. Alles erscheint ungeheuer verlangsamt, die Natur hat sich in allen Bezügen darauf eingestellt, mit hellwachem Blick durchdrungen zu werden.
Sich nicht regen, sondern schauen! – diese Aufforderung geht von den Bildelementen aus. Anders als der europäische erfasst der altjapanische Blick einen Bildraum nicht rasch, ordnend und zusammenfassend. Er legt sich vielmehr auf den Raum und wartet, bis der Raum sich im Betrachter einprägt. Das aber kann minutenlang oder gar eine Stunde dauern. Der Raum löst sich von seinem eigenen Dasein und wandert allmählich, unendlich verzögert, hinüber in das stillgelegte Nervensystem des Betrachters. Er durchströmt dieses System und zieht in es ein. Gelingt das, erlebt der Betrachter den Augenblick oder Moment einer »Ankunft« des Gesehenen in seinem Körper. Kein Ruck, keine Wirkung einer durchdringenden Kraft, sondern: ein »Anstoß«, eine »Anregung«. Werden solche Momente versprachlicht, entsteht ein Haiku: Hier bin ich, das sehe ich, dieses da ist jetzt ein Teil meines Lebens!
Ohne es zu ahnen, habe ich seit den Kindertagen »Gedichte« geschrieben, die immer von bestimmten »Augenblicken« ausgehen, sie festhalten und sich langsam wieder von ihnen trennen. Dabei geht es nie um eine stärkere Emotion oder die hymnische Entlastung eines inneren Überraschtwerdens. Es geht (viel schlichter) »nur« um das Festhalten, das »Stilllegen« eines Zeitmoments, ja, es geht um den bildlich-sprachlichen Abdruck.
Solche »Schlichtheit« erscheint im europäischen Sehen (das etwas zum »Verstehen«, zum »Deuten« und zum »Interpretieren« braucht …, etwas Geheimes, etwas Angedeutetes, vage Dunkelheit) verblüffend fremd. Wenn alles im Bau nur weniger Zeilen deutlich, klar und wie mit der Tuschfeder umrissen ist, braucht es keine »Deutung« im herkömmlichen Sinn. Das Gedicht muss nicht »befragt«, sondern höchstens »erläutert« werden (woher kommt die altjapanische Sympathie für bestimmte Vögel oder Pflanzen? Auf welche kulturellen Zeremonien geht das zurück? Warum betonen Haiku Momente der Jahreszeiten, und was verbinden Japaner mit ihrem Verlauf? etc.)
Ich könnte mir vorstellen, ein ganzes Jahr nicht in Japan, wohl aber mit dem Blick auf altjapanische Traditionen des Schauens zu erleben. Dazu wünschte ich mir einen Kalender. Seltsamerweise hat eine erfahrene, anscheinend mit Bashô verwandte Geisha mir genau diesen Wunsch jetzt erfüllt (Japanischer Taschenkalender auf das Jahr 2017). Ab dem Januar 2017 werde ich diesen Kalender täglich mit mir herumführen. Ich brauche nicht eigens nach Japan zu fahren, sondern ich schaue während eines ganzen Jahres in meinen Kalender und warte darauf, dass mich »etwas (möglichst Jahreszeitliches) anstößt«. Dann werde ich ein »Gedicht« schreiben, mit schwarzer Tusche, auf Japanpapier.
Driften
Wenn ich nostalgisch werde, denke ich an die frühen Siebzigerjahre. Ich war nach meinem gescheiterten Klavierstudium aus Rom zurück und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Nach einigem Stillstand und Hin und Her zog ich einfach los. Mit sehr wenig Gepäck machte ich mich von Mainz aus auf den Weg. Ein Ziel hatte ich nicht, ich überquerte einfach den Rhein, nahm einen Bus, stieg auf dem Land aus, ging durch die Felder, kam in ein Dorf und setzte mich unter einen Baum in der Mitte des Dorfplatzes.
Wie hört sich das an? Richtig, als schriebe ich an einer modernen Version von Joseph von Eichendorffs Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts. Dann ist die Geschichte vom Aufbruch in Mainz also frei erfunden? Nein, ist sie nicht, genauso hat sie sich zugetragen. Ich bin losgezogen und hatte kein Ziel, wohl aber Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts im Kopf.
Ich kenne einige Bücher (und dazu gehört unbedingt Ernest Hemingways Paris – ein Fest fürs Leben), die mich nicht nur wegen ihrer literarischen Qualität, sondern als Lebensbücher beeindruckt haben. Als seien darin Phasen eines Daseins vorgezeichnet, wie ich es mir gewünscht hätte.
Im Falle Eichendorffs war ich schon über den Anfang erstaunt. Es beginnt damit, dass sich der junge Taugenichts an einem Vorfrühlingsmorgen in die Sonne auf der Türschwelle seines Elternhauses setzt. Er reckt sich, es geht ihm gut. Seine demonstrative Faulheit reizt jedoch den Vater. Der Frühling bricht an, draußen gibt es zu tun, aber der Sohn liebt es, in der Sonne zu sitzen und manchmal die Geige zu spielen. Es reicht! Der Taugenichts bekommt zum Abschied einige Groschen und darf des Weges ziehen, um sich selbst seinen Unterhalt zu verdienen.
Eichendorff könnte das alles als eine finstere Sohnes-Vertreibung erzählen. Ein grober, verständnisloser Vater verstößt sein Kind und schickt es in eine gefährliche Fremde. So aber ist die Geschichte gerade nicht angelegt. Taugenichts steckt vielmehr Vaters Groschen begeistert ein, holt seine Geige und zieht los. All denen, die auf den Feldern arbeiten, winkt er zum Abschied gut gelaunt zu. Sollen sie ackern und schaffen, er hat es besser, denn er ist unterwegs. Der Sohn wird also nicht verstoßen, sondern geht liebend gern. Besten Dank für diese Anregung, guter Herr Vater!
Eine gefährliche Fremde tut sich erst recht nicht auf. Kaum hat er einige Schritte hinter sich, rollt nämlich schon ein Reisewagen mit zwei schönen Frauen daher. Kurz wechselt man ein paar Worte, und schon ist beschlossen: Die schönen Frauen nehmen den jungen Kerl mit, er springt auf, und die Kutsche rollt davon, eilig und schwungvoll, als hätten die schönen Frauen gerade auf den lustigen Kerl gewartet.
Das hat mich verblüfft: wie Eichendorff über jeden Realismus hinweg erzählt und, damit es nicht langweilig wird, von einer unglaubhaften Szene zur nächsten schaltet. Verfestigt sich die Geschichte, schüttelt er sie mit solchen Tricks rasch durch, und sämtliche Konstellationen verändern sich. Schlösser tauchen plötzlich aus den Wäldern auf, Posthörner unsichtbar bleibender Musikanten werden geschmettert – und alles nur, damit etwas los ist und die wunderbare Leichtigkeit des Seins erhalten bleibt.
In den frühen Siebzigerjahren habe ich zu einem Teil nach diesem Taugenichts-Projekt gelebt. Ich driftete durch Deutschland, begegnete hier und da einigen Menschen, verweilte ein bisschen und löste mich wieder vom jeweiligen Ort. Ohne Freunde oder sonstige Begleitung war ich zu Fuß unterwegs, fuhr sehr viel mit Überland- und Schienenbussen und hatte das Gefühl, endlos viel Zeit zu haben. Ich übernachtete häufig im Freien und mietete mich, wenn ich irgendwo länger bleiben wollte, bei Schrebergärtnern ein. Ich mochte keine Hotels oder Privatunterkünfte, und ich vertrug keine Unterhaltungen, die lange dauerten und in denen man viel von sich erzählen musste.
So zu driften (wie ich es heute nenne) ist ein stark pubertäres, aber auch zeitloses Projekt. Wenn ich heute im ICE reise und lange unterwegs bin, kommt manchmal der Moment, in dem ich mich nicht nur danach zurücksehne, sondern drauf und dran bin, den Zug zu verlassen. Warum nicht in Fulda, Kassel oder Göttingen aussteigen und den mobilen Erdnussverkäufer mitsamt seinen ICE-Welten zurücklassen? Warum nicht das schwere Gepäck in einem Schließfach verstauen und den nächsten Bus Richtung Burg Plesse und Bovenden nehmen?
Vielleicht gibt es auf Burg Plesse Posthornkurse und vielleicht wird auf dem letzten Stück Fußweg vor der Burg zumindest ein Citroën C 3 mit zwei schönen Mädels auf mich zukommen und anhalten. »Du schlenderst ja daher wie der junge Taugenichts in Joseph von Eichendorffs schöner Novelle«, würden sie mich ansprechen. Und ich würde erwidern: »Und ihr rollt daher wie die zwei schönen Damen, mit denen er nach W. verschwindet!« Sie würden gleichzeitig lachen und unseren Dialog glücklich beenden: »Komm, steig ein, wir fahren wahrhaftig nach Witzenhausen, dort wollen wir es uns in Schloss Berlepsch wohl sein lassen.«
Driften erscheint mir aber nicht nur als Sehnsucht nach einem jugendlichen Dasein ohne jede Verpflichtung. Es ist auch eine Ur-Sehnsucht, die viel tiefer sitzt. Im forteilenden Leben geht man von Jahr zu Jahr immer neue Bindungen ein. Man bindet sich an Menschen, Räume und Dinge, das Leben verfestigt sich und entwirft Stationen mit Bahnsteigen und Schienen. Dem gegenüber gibt es die große Verlockung, sich den Bindungen zu entziehen, selbst Bahnsteige und Schienen sind zuviel.
Man arbeitet dann nicht an dem, was Sigmund Freud »den Lebensroman« (mit Absätzen, Kapiteln, Übergängen – auf ein Ende zu) genannt hat, sondern man erzählt wie Eichendorff eine locker geknüpfte Novelle, in der es sogar einige Lieder gibt. Das Novellendasein kreist im Gegensatz zum Romandasein nur um einen einzigen wunden Punkt: von etwas Abschied zu nehmen und abzulassen – und sich später nicht einzugestehen, dass man sich genau danach sehnt und es in der Fremde unaufhörlich sucht.
Die Fremde soll poetische Heimat werden, das ist das ganz und gar verrückte Taugenichts-Programm. Die Verrücktheit rührt daher, dass der scheinbar fröhliche und lockere Abschied vom Reich der Eltern während der langen Reise durch »die weite Welt« immer mehr erkennbar wird als das, was er eben doch eigentlich war: der Abschied von Kindheit und Jugend. Allmählich wird dieses Umschlagen des irritierend fröhlichen Aufbruchs in bitteren Rückblicken erkennbar, das führt zu Tränen und dann auch zu gelinder Verzweiflung.
Aber: Man ist ununterbrochen unterwegs, ahnt manchmal etwas (dann erklingen die Posthörner oder auch Glocken) und verläuft sich geradewegs weiter in einer unendlichen Sehnsucht nach dem Zuhause. Niemals, weiß man schließlich, wird man dorthin zurückfinden, die Eltern leben längst für sich allein und denken kaum noch an den Sohn, der mit schönen Frauen durch den Wald gerollt ist. Sie haben seine Geige vielleicht noch im Ohr, aber sie wissen, er wird nicht wiederauftauchen, so wie der Sohn weiß, dass er nicht der verlorene Sohn aus einem Gleichnis der Bibel ist.
Kein Vater wird ihn tröstend noch einmal in die Arme schließen, das erkennt er schließlich sehr deutlich. Aber er hört nicht auf, darauf zu hoffen, denn die mögliche Heimkehr ist seine lebenserhaltende Illusion. Am Ende aber hat er die Eltern verloren, er ist zum Waisen geworden. Und was kann ihm in diesem Zustand noch blühen? Joseph von Eichendorff hat es mit großer Barmherzigkeit (ich kann es nicht anders nennen) genau gefasst und gesehen: dass ihm eine schöne, weibliche Waise begegnet, die ihn lieben und heiraten wird. Und wohin werden sie daraufhin ziehen? Der Taugenichts verkündet es trunken vor Seligkeit: »und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom, da gehen die schönen Wasserkünste …«
So ist das. Und, mein Gott, so ist es mir dann auch passiert. Als ich etwas Abstand zu all diesen Ereignissen hatte, habe ich leider nicht in einer Novelle, sondern in einem Roman (Fermer) davon erzählt. Dem Roman habe ich ein Motto vorangestellt, das von Joseph von Eichendorff stammt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einem Brief Eichendorffs an einen Freund. Und es lautet: Ob ich nun auf einem so verzweifelten Spaziergang den Weg ins Freie und in die alte poetische Heimat gefunden habe …, überlasse ich … Ihrem … bewährten Urteil …
Mahlzeiten
Essen als Kind
Als Kind habe ich oft mit meiner Mutter zusammen gekocht. Nichts Aufwendiges, sondern kleine Mahlzeiten (Suppen, Vorspeisen, viele Desserts), die wir erst dann zu uns genommen haben, wenn wir wirklich Hunger hatten. So haben wir an jedem Tag zu einer anderen Uhrzeit gegessen, mal früh, mal spät. In der Küche saßen wir an einem alten Tisch und schnippelten zusammen die Bestandteile des Essens: Möhren schälen und klein raspeln, Radieschen von ihren Strünken befreien, Sellerie in dünne Scheiben schneiden. Meist haben wir Musik gehört und kaum ein Wort gewechselt, und auch während des Essens haben wir nicht viel miteinander geredet. Nach fast jeder dieser kleinen Mahlzeiten aber haben wir uns angeschaut, und einer von uns hat den anderen gefragt: »Und?! Wie?!« Und dann hat der andere etwa so geantwortet: »Radieschen schmecken viel besser, als man denkt.« Oder: »Geraspelte Möhren sind zu wässrig.« Oder: »Gekochte Selleriescheiben mit etwas Öl und Walnüssen – gibt es etwas Besseres?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: