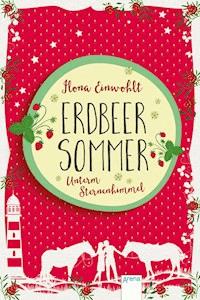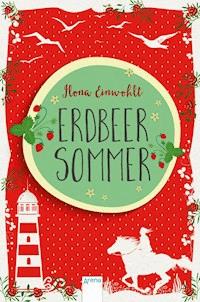12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt gehört denen, die sie verändern
Süddeutschland, 1919: Als Toni in der Stadt ankommt, ist sie voller Hoffnung, voller Tatendrang und voller Träume. Toni hat ein Ziel – sie möchte Medizin an der Universität studieren und Ärztin werden. Sie möchte endlich in der Lage sein Frauen und Kindern zu helfen. Schnell freundet Toni sich mit anderen Frauen an, die ebenfalls nach Wissen und Bildung streben. Doch nicht jeder ist mit ihrer Anwesenheit an der Hochschule einverstanden. Anfeindungen, Spott und Hohn gehören zur Tagesordnung. Und lohnt es sich, all das hinzunehmen, für den Traum einer besseren Zukunft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Villa Libertas ist ein fiktiver Ort, Personen und Handlung sind frei erfunden,
Ähnlichkeiten mit der aktuellen Situation der Frauen um 1920 sind beabsichtigt.
Frauen hatten bis 1908 kein politisches Mitspracherecht, erst im Januar 1919 durften sie zum ersten Mal wählen gehen.
Frauenvereine dienten i. d. R. wohltätigen Zwecken und setzten sich für Mädchenbildung, bessere Arbeitsbedingungen und Emanzipation ein.
Selbst wenn Frauen studieren durften, bedeutete dies noch lange nicht, dass ihnen später die Berufsausübung erlaubt war.
Originalausgabe © 2022 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Ilona Einwohlt wird vertreten von der Agentur Brauer (zuständige Agentin: Ulrike Schuldes) Covergestaltung von FAVORITBÜRO, München Coverabbildung von ILINA SIMEONOVA / Trevillion Images shutterstock / Verlion E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749904716www.harpercollins.de
1
Koffer voller Ungewissheit
Es gibt nur eine Moral, und die gilt für Mann und Frau.
LIDA GUSTAVA HEYMANN (1868–1943)
Mitten im Regen durch München zu laufen, war keine Freude. Erst recht nicht, wenn die Füße klamm in durchnässten Schuhen steckten und die Koffer viel zu schwer an den Armen hingen. Toni machte das nichts aus. Sie hatte ein Ziel, und das ließ aus lauter Vorfreude ihr Herz höherschlagen und sie über Pfützen des Bahnhofvorplatzes springen: die Universität. Wochenlang, ach was, Monate, hatte sie diesen Moment herbeigesehnt. Jetzt war es endlich so weit. Endlich würde sie sich für das Medizinstudium einschreiben. Endlich würde sie das Versprechen einlösen, das sie ihrer Mutter vor so vielen Jahren am Sterbebett gegeben hatte.
Schnell wischte Toni die traurigen Gedanken beiseite, der Tod der Mutter hatte Spuren hinterlassen. Wie der gerade verlorene Krieg, die Schmach der Niederlage, sie spürten, sie alle, und hier in der Stadt spiegelten die Fassaden die Trostlosigkeit. Auch zu Hause in den Bergen waren sie nicht verschont geblieben, beide Brüder gefallen und der Vater seitdem ein einsamer Mann, der mit seinen drei Töchtern nichts anzufangen wusste. Als Älteste hatte sich Toni von klein auf um alles kümmern müssen, was Haus und Hof anging, viel zu früh gelernt, Verantwortung zu tragen, Tag sind und Nacht geschuftet und nebenbei in ihren Büchern gelernt.
Dann war wie durch ein Wunder Gitti auf der Alm erschienen und hatte mit ihrer erfrischenden, jungen Art dem Berghof neues Leben eingehaucht. Vergessen die kargen entbehrungsreichen Jahre, Gitti ackerte von früh bis spät, schenkte dem Vater wieder einen Sohn – und Toni durfte zum Studieren in die Stadt. Ein Geschenk des Himmels für eine Bauerstochter, die außer ein paar Kleidungsstücken und der Kräuterfibel im Koffer nichts besaß, auch keine Mitgift. Dafür saugte Toni lernbegierig jedes Wissen ein und lernte für drei, hatte ihr Abitur mit Auszeichnung bestanden. Jetzt konnte sie das Studium kaum erwarten, ganz bestimmt würde sie eine gute Ärztin werden. Dann würde sie wie versprochen in den Weiler zurückkehren und Frauen und Kindern zu einem gesünderen Leben verhelfen.
Zuversichtlich blinzelte Toni in den wolkenverhangenen Himmel, dahinter schien gewiss die Sonne. Es würde schon alles gut werden, davon war sie zutiefst überzeugt, das Leben hatte es trotz allem bisher immer gut mit ihr gemeint. Und auch wenn München sie nicht sonderlich freundlich empfing, würde sie sich hier rasch zu Hause fühlen. Langsam lief Toni über den Karlsplatz, kaum eine Menschenseele war unterwegs. Auch sie wäre lieber im Warmen gewesen, obwohl ihr das Wetter sonst nichts ausmachte. Ob Regen, Schnee oder heißeste Sonne, die Arbeit auf dem Berghof hatte sie abgehärtet. Heute trug sie einen dünnen Mantel statt ihrer geliebten Lodenjacke und dazu einen Hut, von dessen Krempe das Wasser beständig in ihren Kragen tropfte und ihr seit geraumer Zeit den Rücken hinunterrann. Für einen kurzen Moment bereute Toni, nicht doch zuerst Tante Cilli in der Villa Libertas aufgesucht zu haben. Die hätte ihr sicher Überschuhe gegeben. Oder ihr eine Droschke spendiert, Toni war noch nie mit einem Auto gefahren. Sie kannte nur Kutschen und Fuhrwerke, meistens lief sie selbst neben den Gespannen her, um den Tieren die Arbeit zu erleichtern.
Später, tröstete sich Toni, später würde sie zu Tante Cilli in der Maxvorstadt gehen und ihr alles erzählen. Cilli würde verstehen und helfen, und bei diesem Gedanken wurde ihr sofort warm ums Herz. Wie sehr freute sie sich auf die alte Dame, die sie seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen hatte. Davor war Cilli regelmäßig zu Besuch gekommen und hatte mit ihrem imposanten Hut ein Gefühl von Großstadt in die karge Blockhütte gebracht. Jedes Mal hing Toni an ihren Lippen, wenn Cilli von ihrem Frauenverein erzählte und wie wichtig es war, dass Mädchen eine anständige Ausbildung bekamen. »Du bist wertvoll«, hatte ihr Cilli jedes Mal beim Abschied ins Ohr geflüstert. »Lass dir bloß nichts anderes einreden!« In den letzten Jahren hatte Cilli alles dafür getan, damit die Tochter ihrer Schwester zu ihr nach München in die Villa Libertas kommen konnte. Und jetzt war es endlich so weit. Jetzt war Toni hier zum Studieren!
Eilig lief sie weiter, die Ottostraße entlang – und wäre beinahe gestolpert. Das Kätzchen sprang direkt vor ihre Füße, leckte sich die Pfote und schaute Toni erwartungsvoll an.
»Mei, was machst du denn hier draußen, du bist ja ganz nass? Hast du etwa kein Zuhause?« Ungeachtet des Regens ging Toni in die Hocke, um dem kleinen Kater über das schwarze Fell zu streicheln. Vertrauensvoll schmiegte er seinen Kopf in ihre Hand und blinzelte sie an. »Von links kommst du gesprungen, soso«, murmelte sie halb belustigt, halb entsetzt und griff wieder nach ihren Koffern. Wer in den Bergen wohnte, besaß entweder tiefes Gottvertrauen oder folgte Brauchtum und Aberglaube. In Tonis Herz hatte beides Platz.
»Schick dich. Geh nach Hause, Kleiner!«, versuchte sie das Katerchen abzuwimmeln, das ihr jetzt auf Schritt und Tritt folgte. »An der Universität sind Tiere sicher nicht willkommen!«
Und Frauen vielleicht auch nicht, fügte sie in Gedanken hinzu. Es gehörte zu den Neuerungen der Zeit, dass Frauen studieren durften, doch die meisten waren der Meinung, dass Frauen bitte ihre gottgegebenen Aufgaben zu erfüllen hätten. Kinderkriegen, Wäsche waschen, warme Mahlzeiten und dem Manne ein heimeliges Heim bereiten. In München und anderswo waren vor dem Krieg Frauen wie Tante Cilli auf die Straße gegangen und hatten für ihre Rechte demonstriert: Sie wollten in der Politik mitreden und wählen, sie wollten über ihre Körper bestimmen dürfen und endlich an die Universität: lernen, wissen, wirken.
»Bist du etwa mein Glückskater? Das kann ich wirklich gebrauchen!« Jetzt hatte Toni den Kleinen doch auf den Arm genommen und drückte ihn überschwänglich an sich, sein Fell war ganz nass. Bei aller Freude darüber, dass sie bald Studentin der Medizin sein würde, plagten sie einige Zweifel. Was, wenn sie nicht schlau genug war? Die Schwestern und allen voran Gitti hatten immer wieder gestichelt und sie spüren lassen, dass Toni nur ein dummes Bauernkind war und Frauen wie sie nie im Leben mit den Großkopferten mithalten könnten. »Die Wiege, in die du gelegt wirst, entscheidet eben nicht«, hatte Toni ihnen trotzig entgegengehalten und ihre Koffer gepackt. Froh, der Enge des Holzhauses zu entkommen. Den weiten Blick über die Täler und Schluchten würde sie trotzdem vermissen.
Vorsichtig setzte sie den Kater wieder ab, dann lief sie weiter, nur flüchtig schaute sie an den prächtigen Fassaden hoch, die einen mit ihren Schnörkeln und Goldverzierungen lockten. Wie es den Menschen dahinter ging, wagte sich Toni nicht auszumalen, so viele Männer waren nicht von der Front zurückgekehrt. Wie ihre Brüder. Die Front, von der Toni nicht wusste, wie sie überhaupt aussah. Manchmal stellte sie sie sich als eine Linie aus Soldaten vor, schnurgerade am Waldrand aufgestellt bis zum Horizont. Oder waren es Panzerstellungen, die wie eine Perlenkette aufgereiht waren? Toni erschien dieFront als ein konzentriert versammelter Ort des Krieges, und doch hatte sie sich niemals vorstellen können, was es in Wirklichkeit für die Soldaten bedeutete, dort zu sein, mitten im Krieg im täglichen Tod. Auch Franzl galt als vermisst, doch Toni war zutiefst davon überzeugt, dass er lebte und zu ihr zurückkehren würde. Ihr guter, lieber Franzl, Freund und Gefährte aus Kindheitstagen. Aufgewachsen waren sie wie Geschwister und dann verlobt. Es gab keinen besseren Bergführer und Ziegenhüter, erst recht keinen Geigenbauer. Franzl hörte das Holz, bevor er es verbaute, er fühlte seine Klänge. Um seine Geigen zu kaufen, kamen sie aus aller Welt in den kleinen Laden unten im Dorf, den seine Familie bereits in der dritten Generation führte. Vor dem Krieg.
Toni blieb keine Zeit, ihren Erinnerungen nachzuhängen, denn vorne am Karolinenplatz hatte sich eine Menschenmenge versammelt, etwas schien passiert zu sein. Schnell schluckte sie die Traurigkeit hinunter, blinzelte den Regen aus ihren Augen. Dann umklammerte Toni ihre Koffer noch fester und lief weiter, dicht gefolgt von dem schwarzen Kater, der wohl beschlossen hatte, nicht mehr von ihrer Seite zu weichen.
Als sie entdeckte, warum die Leute gafften, zögerte Toni nicht eine Sekunde. Im nächsten Moment kniete sie neben der jungen Frau. Behutsam strich sie ihr eine Strähne aus der Stirn. Pechschwarze Haare, die sich drahtig anfühlten, und später wunderte sich Toni, warum ihr das als Erstes aufgefallen war. Grüne Augen verfolgten derweil aufmerksam jede ihrer Bewegungen, ihnen entging nichts. Der Kater leckte der Verletzten die Hand, die sich vor Schmerzen krümmte. Niemand von den Umstehenden machte Anstalten zu helfen, im Gegenteil. Abfällige Bemerkungen wie »Das geschieht einer wie der nur recht« oder »Ein Bankert weniger« drangen an ihr Ohr.
»Keine Sorge, ich bin da … Ich bin Toni Gruber und helfe Ihnen. Wie heißen Sie? Was ist passiert? Wo tut es Ihnen weh?« Die letzte Frage hätte sich Toni sparen können. Ein blutiger Fleck prangte unübersehbar in ihrem Schoß.
»Emilia«, kam es wimmernd, kaum hörbar, und Toni musste sich noch tiefer über sie beugen. »Ay, qué dolor … Es tut so weh …«
»Wo ist Ihr Mann?« Hastig zog Toni ihren Mantel aus, um die junge Frau vor den neugierigen Blicken der anderen zu schützen, unangenehm berührt von dem, was sie gerade mit ansehen musste.
Welch ungeschickte Frage von ihr! Das hier war München, eine Großstadt. Und nicht das heimatliche Bergdorf, wo jeder jeden kannte und die Jungfrauenehe Tradition war.
Da richtete sich Emilia auf, für einen Moment schienen ihre Schmerzen vergessen. »No hay. Ich habe keinen«, antwortete sie klar und selbstbewusst, bevor sie halb ohnmächtig zusammensank. Als wäre es das Normalste der Welt, dass eine junge schwangere Frau keinen Mann an ihrer Seite brauchte. Aus der Menge ertönte ein wissendes Raunen.
»Hier. Versuchen Sie, das zu lutschen.« Toni schob Emilia ein Kräuterbonbon in den Mund, das sie aus ihrer Manteltasche gekramt hatte. »Ich weiß, Thymian schmeckt furchtbar, aber hilft, versprochen«, fügte sie entschuldigend hinzu, als sie Emilias Grimasse bemerkte. Gut so. Dann vergaß sie hoffentlich ihre Schmerzen.
Hilfesuchend blickte sich Toni um. »Holt bitte jemand einen Arzt?«, rief sie in die Menge, doch niemand bewegte sich.
»No! Bitte keinen Arzt«, wimmerte Emilia. »Bring mich hier weg. Schnell, bitte.«
»Du musst ins Krankenhaus!« Toni atmete tief durch, sie musste jetzt Ruhe bewahren. Schweißperlen hatten sich auf ihrer Stirn gebildet, sämtliche Körperzellen in Alarm. Verzweifelt versuchte sie, die Bilder zu verdrängen, die sich unweigerlich vor ihr inneres Auge geschoben hatten, das Gefühl der ohnmächtigen Hilflosigkeit. Die Mutter, wie sie sich unter Schmerzen gewunden hatte, während das Blut aus ihr herausflutete. Der Körper, mit jeder Minute sterblicher. Blass, tiefe Ringe unter den Augen und immer wieder diese Schreie, die bald ein Wimmern wurden und schließlich für immer verstummten. Toni hatte es ihrer Mutter in deren letzten Minuten versprechen müssen: Sie würde Medizin studieren, alles lernen und wissen, um Frauen in Zukunft helfen zu können.
Und jetzt kniete sie hier, am helllichten Tag im strömenden Regen mitten auf der Straße. Beobachtet von diesem schwarzen Kater, der nicht von Emilias Seite wich, und wusste nichts zu tun, außer nach einem Arzt zu rufen.
»Bring mich zu Ida Petersen, so schnell du kannst. Bitte, Toni«, flüsterte Emilia und schaute sie eindringlich an. »Du musst es mir versprechen, nimm eine Droschke. Ich kann dir alles erklären … nur bitte keinen Arzt …«
»Bleib bei mir, nicht ohnmächtig werden, hörst du!« Toni klopfte ihr auf die Wangen. Panisch überlegte sie, was zu tun wäre. Ein Tee aus Kamille und Schafgarbe wäre gut, die Dose steckte in ihrem Koffer. Gitti hatte sie ausgelacht. »Du studierst bei Professoren und nicht bei Kräuterweiblein! Die moderne Medizin wirkt viel schneller als deine umständlich getrockneten Pflanzen …«, waren ihre Worte gewesen, als Toni ihre gesammelten Schätze eingepackt hatte.
Leider hatte Gitti recht. Wie um Himmels willen sollte sie hier auf der Straße Tee zubereiten! Finster starrte Toni den Kater an. Hätte der nicht von rechts nach links in ihr Leben springen können?
»Kann ich helfen? Gestatten, Georg Bender.« Jemand schob sie zur Seite, fühlte Emilias Puls. Dann hob der junge Mann die mittlerweile Ohnmächtige ohne Umstände auf seine Arme. »Wir bringen sie ins Krankenhaus. Bis ein Krankenwagen hier ist, ist es zu spät.«
»Nein, nicht.« Toni hielt ihn am Ärmel fest.
»Haben Sie etwa eine bessere Idee?« Sie erntete einen spöttischen Blick. Flüchtig zwar, aber lang genug, um die Entschlossenheit darin zu erkennen.
»Ja!«, erwiderte Toni mit fester Stimme, seine blauen Augen irritierten sie. »Wir bringen sie zu Ida Petersen.« Wer immer das war. Wo immer sie wohnte. Toni fühlte sich verpflichtet, Emilia beizustehen, und betete insgeheim, dass diese Ida mindestens eine Engelmacherin war, wenn nicht sogar eine Ärztin. Es sollte sie ja bereits geben, hier in der Stadt. Frauen, die es geschafft hatten, eine eigene Praxis zu eröffnen.
»Zu Ida Petersen? Hat sie das gesagt?« Offensichtlich wusste dieser Georg Bender sofort Bescheid. Wenn das mal kein gutes Zeichen war. »Na, dann verlieren wir besser keine Zeit! Und am besten kommen Sie mit!« Diesmal lächelte er Toni freundlich zu, und es war, als scheine die Sonne in ihr Herz, dabei regnete es unaufhörlich auf sie nieder. Toni griff sofort nach ihren Koffern, dann musste die Universität eben doch noch warten.
So liefen sie mitten im Regen durch die Straßen, eine ungewöhnliche Prozession, und das Schlusslicht bildete der Kater.
»Kennen Sie sich hier aus?«, rief Toni außer Atem und hätte sich diese Frage auch sparen können. Dieser Mann legte ein Tempo vor, dass sie kaum Schritt halten konnte, dabei war sie alpine Wanderungen gewohnt und konnte klettern wie ein Gamsbock. Kreuz und quer ging es durch die Stadt, durch das Gewirr kleiner Verkaufsstände, vorbei an einer antiken Tempelfront. Und immer wieder ratterten Fuhrwerke an ihnen vorbei.
Toni hatte jegliche Orientierung verloren, die Stadt schien ihr ein einziges Labyrinth. Immerhin schien Georg genau zu wissen, was zu tun war, was blieb ihr anderes übrig, als ihm zu vertrauen und zu folgen. Etliche Minuten später standen sie vor einer prächtigen Villa, deren grün getünchter Turm über die Baumspitzen ragte. Toni blieb keine Zeit, den sorgsam angelegten Vorgarten und das mit Ornamenten verzierte Portal zu bewundern. Der Kater schnupperte interessiert an den Büschen und schien sich sofort zu Hause zu fühlen.
»Schnell, sag Ida Bescheid. Wir brauchen Tücher und heißes Wasser«, rief Georg einer hageren Gestalt zu, die erschrocken die Holztür öffnete. Toni erschrak ebenfalls, denn die Frau trug zu ihrem schwarzen, langen Kleid kurze Haare. Wie ein Mann.
»Ich bin schon da … Um Himmels willen, was ist passiert? Kommt, hier entlang, wir bringen sie in den Turm.« Eine zierliche Frau kam ihnen entgegengeeilt und führte sie den Seitenflügel entlang eine geschwungene Holztreppe etliche Stufen hinauf in ein geschmackvoll eingerichtetes Zimmer. Toni folgte neugierig. Sie wagte kaum, sich umzusehen. Wie vornehm die Villa war: die fein gemusterten Tapeten an den Wänden, die eleganten Möbel, die mit Seide gepolsterten Stühle, dazwischen ein Schrank, der sich als Versteck für Arzttasche und medizinische Apparate entpuppte.
Unbehaglich zupfte Toni ihre nassen Sachen zurecht, Wassertropfen zierten ihren Weg. Ida in ihrem vornehmen Kleid zu den sorgsam hochgesteckten Haaren flößte ihr Respekt ein. So eine elegante Erscheinung hatte sie noch nie gesehen, selbst sonntags zur Kirchweih nicht, wenn die Frauen im Dorf ihre Trachten anlegten.
Georg bettete die Ohnmächtige vorsichtig auf das Bett.
Mit angehaltenem Atem verfolgte Toni, wie er sich sorgfältig die Hände wusch und seine Instrumente hervorholte. Er musste Arzt sein, kein Wunder, dass er sofort wusste, was zu tun war. Ida assistierte ihm während der Untersuchung, immer wieder betupfte sie Emilias Stirn mit einem Waschlappen und schien keine Scheu davor zu haben, ihr die Beine zu spreizen. Das machten die beiden nicht zum ersten Mal, ging es ihr durch den Kopf.
Langsam kehrte die Farbe in Emilias Gesicht zurück.
»Sie hat es verloren, oder?«, fragte Ida.
»Eine Ausschabung wird nicht nötig sein …«, meinte Georg mit Blick auf die Nierenschale in seiner Hand, er wirkte erleichtert. »Glück gehabt. Wer ist sie, ich habe sie bei dir noch nie gesehen?«
»Emilia Campos-Rivera, Studentin der Jurisprudenz. Sie wohnt seit letzter Woche bei uns in der Damenpension«, erwiderte Ida.
»Was hat sie genommen? Riechst du das?« Georg hatte sich über Emilia gebeugt und schnupperte.
»Ich glaube nicht, dass sie bei einer Engelmacherin war … Sie kennt hier doch niemanden. Das sind irgendwelche Kräuter …« Ida rümpfte die Nase.
»Das Bonbon war von mir!«, meldete sich Toni zaghaft zu Wort. Sie stand immer noch mit beiden Koffern in der Hand im Türrahmen. »Ich … ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sie helfen mir immer, äh … bei Frauenleiden.« Sie versuchte ein Lächeln. Hier hatte gerade jemand mit medizinischer Kompetenz eine Fehlgeburt begleitet – und sie kam mit Heilkundlerei aus den Bergen! Traditionelles Hebammenwissen ihrer Mutter, die Kräuter brachten Linderung und halfen. Egal ob bei einer zu starken Blutung, Schmerzen oder Kopfweh. Oder unter einer Geburt. Meistens.
»Wer sind Sie?« Überrascht drehten sich Georg und Ida zu ihr um, erst jetzt schienen sie Toni wirklich wahrzunehmen. Unbehaglich ließ sie die ausführliche Musterung über sich ergehen. Sie musste ein klägliches Bild abgeben, wie sie da so stand, tropfnass in ihrem Kleid und in den durchweichten Schuhen, der Hut längst verrutscht und der blonde Zopf aufgelöst.
»Toni Gruber«, stellte sie sich vor und streckte ihm entschlossen die Hand hin. »Ich bin in München, um Medizin zu studieren.«
»Eine künftige Kollegin also? Herzlich willkommen!« Lächelnd schlug Georg ein, noch bevor Ida reagieren konnte. Die Wärme seiner Haut ließ Tonis klamme Finger kribbeln. Dann fügte er noch hinzu: »Danke, dass Sie Emilia so umsichtig geholfen haben. Das hätte nicht jede gemacht.«
»Das war doch selbstverständlich. Die Kräuterbonbons waren das wenigste, was ich tun konnte.« Berührt senkte Toni den Blick, er sollte sie bitte nicht so ansehen, das schickte sich doch nicht. Doch sie ließ es gerne geschehen, dass er ihre Hand immer noch nicht losgelassen hatte.
»Ich glaube, Sie verwechseln da etwas! Naturheilkundlerei hat mit Medizin nichts zu tun …« Ida schüttelte skeptisch den Kopf, während ihr Georg einen anerkennenden Blick schenkte.
»Ich habe davon gehört! Bei Gelegenheit müssen Sie mir mehr darüber erzählen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Kräuterkunde die Medizin ersetzen wird.«, meinte er.
»Das ist es ja gerade.« Toni atmete aus und reckte das Kinn, bevor sie mit einem verschmitzten Grinsen hinzufügte: »Deswegen bin ich hier.«
Meine geliebte Tochter,
über ein Jahr ist es nun her, dass ich fort von dir bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, denn ich darf keinen Kontakt zu dir haben. Das Einzige, was mir bleibt, ist, in Gedanken bei dir zu sein, aufzuschreiben, was mir auf der Seele brennt. Ich musste dich verlassen, dich zurücklassen. Unbeschreiblich der Schmerz, die Sehnsucht nach dir. Deinem fröhlichen Lachen, deinen unbekümmerten Luftsprüngen, wie du immer zwei Stufen auf einmal die Treppe hinunterstürmst. Bewahre dir diese ungestüme Art, versprich mir das!
Und jetzt ist sie in meinem Leben gelandet. Warum sie, ausgerechnet sie? Warum schickt mir der liebe Gott ausgerechnet Toni in mein Leben? Sie erinnert mich an alles, was ich zu verdrängen suche, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde daran, dass ich nicht bei dir sein darf. Wärest du nur zehn Jahre älter, geliebtes Kind, du würdest aussehen wie sie. Diese gesunde Gesichtsfarbe zu deinen blonden Haaren. Und dieses Strahlen in deinen Augen, das nichts und niemand brechen kann. Weder Krankheit noch Tod noch die Scheidung deiner Eltern. Niemals im Leben, so hoffe ich.
Du bist und bleibst ein Teil von mir. Mein Fleisch und Blut, ich habe dich geboren. Monatelang bist du in mir gewachsen. Dann habe ich dich ins Leben geschickt, mit all meiner Kraft. Wie richtig sich das anfühlte. Du warst gesund, so fröhlich, eins der wenigen Babys, die schon im Wochenbett lachen. Welch Glück ich mit dir spürte, so unbeschreiblich. Sie wollten dich mir wegnehmen, damit ich schlafen kann, wie konnte ich ohne dich sein! Ganz nah bei dir, deinen zarten Körper spüren, deinen weichen Duft atmen.
Als wäre es gestern, so fühle ich es. Und jetzt bin ich so weit weg von dir.
Ich konnte nicht anders, ich hatte keine andere Wahl. Verzeihe mir. Wie hätte ich dieses Martyrium noch weiter ertragen können? Seine Küsse und gewaltvollen Aufdringlichkeiten? Du bist zu jung, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn ein Mann dich gegen deinen Willen nimmt, und wirst es, Gott sei mit dir, hoffentlich nie erfahren müssen.
Wie es ist, seine Küsse über dich ergehen zu lassen, die Beine geöffnet und die Augen geschlossen. Hoffend, dass es schnell vorbeigeht, er seine Erfüllung findet und endlich von dir ablässt. Nacht für Nacht. Und dann diese Erniedrigungen bei Tag. Wenn er dich spüren lässt, dass du ein Nichts bist, abhängig von ihm, er hat das Wissen, das Geld, das Sagen, er hat die Macht. Mit deinem Ja hast du dich ihm ausgeliefert. Alles, worüber vorher dein Vater bestimmt hat, bestimmt jetzt er. Keine Widerrede. Mit dem Unterschied, dass er gleichzeitig auch noch über deinen Körper verfügt.
Ich hätte das durchgehalten, dir zuliebe, bis an mein Lebensende. Aber dann.
Wer hätte ahnen können, dass ein Blick dieser funkelnden Augen mein ganzes Lebensgerüst ins Wanken bringt? Ich habe mich umschwärmen lassen, seine Aufmerksamkeit genossen. Mich hinreißen lassen zu diesem einen Kuss und noch mehr. Und plötzlich war alles anders, plötzlich ging es um mich! Jede Faser meines Körpers sagte mir, wie schön und jung ich bin! Ich wollte leben, Berührungen genießen, in seiner Umarmung verglühen. Er hat mein Herz berührt. Vergessen das Versprechen, das ich gegeben habe, ich habe mit ihm Dinge getan, die eine verheiratete Frau nicht tut. Und jetzt … Sie haben mich weggeschickt, ich darf dich nicht sehen. Eine geschiedene Frau, ohne Rechte und Ansprüche. Beinahe hätte ich mich aufgegeben, die Brooksbrücke schon auserwählt. Dann hat mich Cilli nach München geholt. Und jetzt ist Toni da, mit ihrer Wissbegierde und Begeisterung. Für Frauen wie sie lohnt es sich zu kämpfen, jeden Tag. Wieder und immer wieder. Und für dich, mein Herzenskind.
2
Villa Libertas
Man kommt sich auf dem Gebiet immer wie ein Wiederkäuer vor. Das liegt an der Taktik der Gegner.
HEDWIG DOHM (1831–1919)
Toni blinzelte gegen das Morgenlicht. Nur einen winzigen Moment wollte sie noch das wohlige Gefühl des Aufwachens genießen, sich genüsslich in den Kissen strecken und dann den Tag begrüßen. Ach was, Tag: ihr neues Leben! Toni konnte es immer noch nicht glauben, der Zufall hatte sie mit dem Regen in die Villa Libertas gespült.
»Was meinst du, Katerchen? Vielleicht hast du mir doch Glück gebracht«, murmelte sie und erntete zur Antwort ein wohliges Schnurren. Der kleine Kater hatte es sich zu ihren Füßen gemütlich gemacht und verfolgte aufmerksam Tonis Bewegungen.
Wie sich gestern noch herausgestellt hatte, waren Ida Petersen und Toni Cousinen, denn Ida war ebenfalls eine Nichte von Tante Cilli. Ida hatte nicht schlecht gestaunt, als Toni ihr erklärte, was eine Bauerstochter wie sie in München zu suchen hatte. Noch dazu in diesem jämmerlichen, durchweichten Aufzug. Die arme Cilli war im vergangenen Herbst an der Spanischen Grippe gestorben, die seit geraumer Zeit in der Region wütete. Als ob der Krieg nicht schon genug Unheil und Tote über sie alle gebracht hatte! Toni hatte nicht gewusst, dass Ida Cillis Vermächtnis zufolge die Villa als Damenpension weiterführen sollte. Niemand hatte mir ihr gerechnet, offensichtlich auch ihren Brief nicht erhalten. Jetzt waren alle sechs Zimmer an junge Frauen vermietet, und Toni musste mit der kleinen Kammer unterm Dach vorliebnehmen. In ihren Augen ein Geschenk, denn es war das größte Zimmer, das sie je ihr Eigen nennen durfte! Auf dem Berghof hatte sie sich das Bett mit ihren beiden Schwestern geteilt, und schon gar nicht hatte eine Waschschüssel mit einem Krug bereitgestanden. Von elektrischem Licht, weichen Daunendecken und Vorhängen mit Volants an den Fenstern ganz zu schweigen.
Mit einem Lächeln im Gesicht setzte sich Toni auf. Langsam tauchte die Morgensonne das Kämmerchen in helles Licht, der Spiegel über der Kommode zauberte funkelnde Reflexe an die Zimmerdecke. In ihrem Spitzennachthemd fühlte sie sich wie eine Prinzessin, so königlich gebettet hatte sie noch nie in ihrem Leben geschlafen. Ihr Zuhause war nun eine Villa so groß wie ihr Weiler, mit unzähligen Fluren zum Verlaufen und sogar einem Turm. Mit Bibliothek, Wintergarten und Gemeinschaftsküche. Und einem Park mit Blumenrabatten und Büschen statt Futterrüben und Weizen. Normalerweise wäre Toni um diese Uhrzeit längst im Stall, wäre mit dem Käsen beschäftigt und danach mit Holzhacken. Jetzt saß sie da und musterte ihre Hände. Wettergegerbte zupackende Hände waren das. Nicht so zarte und fein manikürte wie die von Ida.
»Sie kann mich nicht leiden, oder was meinst du?«, stellte Toni fest und zog den Kater in ihre Arme. »Dafür ist Emilia furchtbar nett! Wie sehr sie sich über unsere Hilfe gefreut hat.«
Am Abend hatte Emilia noch eine Suppe zu sich genommen, die Ida ihr persönlich ans Bett gebracht hatte. Sonst würde es in der Villa Libertas keinen Zimmerservice geben, hatte sie betont.
»Im Gegensatz zu anderen Damenpensionen«, sie hatte das Wort wirklich verwendet: »Damenpension«, »kocht und wäscht hier nicht jede für sich, sondern wir erledigen das alle gemeinsam. Meine Tante legte großen Wert darauf, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich will diese Tradition fortführen und dafür sorgen, dass die Freiheit einer Frau nicht auf Kosten der Unfreiheit einer anderen stattfindet.«
Daraufhin hatte sie Toni in die Küche geschoben, wo sie sich an dem Eintopf des Vortages bedienen durfte, und ausgehungert, wie sie war, machten ihr auch die Bohnen darin nichts aus.
»Was meinst du, Katerchen, die zwei Jahre halten wir durch, oder? Und dann werde ich nicht dabeistehen und zusehen müssen, wie ein Arzt die Frauen untersucht, sondern selbst wissen, was zu tun ist.«
Bei der Erinnerung an Georg Bender kribbelte ihre Hand. Wie aufmerksam er ihr gegenüber gewesen war. Ganz anders als Ida, die sich so abfällig über ihr Heilwissen geäußert hatte. Dabei wusste Toni doch selbst nur allzu gut um die Grenzen der Naturheilkunde.
Und wie umsichtig und einfühlsam Georg Emilia untersucht hatte, er schien zu den modernen Männern zu gehören und mit emanzipierten Frauen keine Probleme zu haben, schon gar nicht, dass sie Ärztin werden wollten. Im Gegenteil, er hatte sie geradezu ermuntert. Toni erinnerte sich an jeden seiner Handgriffe, seinen konzentrierten Blick und die angestrengte Falte auf der Stirn. Und an das Grübchen in seiner Wange, als er Toni zum Abschied anlächelte …
Alle in der Villa waren Georg dankbar dafür, dass Emilia nicht ins Krankenhaus musste, allen voran Ida, die ihn aufs Charmanteste umgarnt hatte. Dabei war sie so viele Jahre älter als er, die Fältchen um die Augen verrieten sie. Den Tisch hatte sie für ihn gedeckt und extra Wein aus dem Keller geholt, ganz bestimmt hatten die beiden eine Affäre. Bei dem Gedanken durchzuckte es Toni eifersüchtig, schnell drückte sie den Kater an sich.
»Auch wenn sonst keine Männer in der Villa geduldet werden, Hauptsache, du darfst bleiben«, murmelte sie in das schwarze Fell. Auch das hatte gestern Abend noch für Unmut gesorgt. Die Städter schienen abergläubischer als die Menschen in den Bergen zu sein. Ida wollte partout keine schwarze Katze im Haus haben. Das Katerchen schien ihre Abneigung zu spüren, fauchend hatte er sich gewehrt, als sie ihn packen und vor die Tür setzen wollte. Georg war es zu verdanken, dass er bleiben durfte, und deshalb verzieh ihm Toni, dass er sich von Ida so hatte verwöhnen lassen.
Von unten tönte nun geschäftiges Treiben. Höchste Zeit, aufzustehen und sich in die Gemeinschaft einzubringen, wie Ida es wohl wünschte. Toni konnte es kaum erwarten, die anderen Frauen kennenzulernen. Wenn sie nur alle so nett waren wie Emilia!
»Ja, mei! Du musst die Toni sein!«, wurde sie herzlich begrüßt, als sie die Küche betrat. Die kurzhaarige Frau von gestern streckte ihr beide Hände hin. »I bin Maria, das Mädchen für alles hier, auch wenn ich nicht mehr die Jüngste bin! Und wenn Ida gestern behauptet hat, sie bräuchte mich nicht, war das glatt gelogen. Denn ohne mi …«
»… wäre die Villa Libertas das reinste Irrenhaus!«, vollendete Emilia grinsend den Satz und winkte ihr mit dem Kochlöffel zu. Sie stand am Herd und rührte in einem großen Topf. »¡Cuidate! Pass auf! Maria entgeht nichts, sie ist der eigentliche Herr im Haus, auch wenn sie die perfekte Hausmutter gibt. Vor ihr kannst du keine Geheimnisse haben …«
»Lass das bloß nicht Ida hören!« Die beiden brachen in schallendes Gelächter aus. Die drei anderen jungen Frauen, die vor der Anrichte mit dem Kaffeegeschirr klapperten, fielen mit ein.
Unsicher blickte Toni zwischen ihnen hin und her. Emilia mit ihrer fröhlichen Art schien der Älteren an Witz und Gewandtheit in nichts nachzustehen. Und die anderen wirkten so erwachsen und selbstbewusst, obwohl sie wie Dienstmädchen mit dem Kaffeegeschirr hantierten.
»Jetzt lass uns erst mal frühstücken, und dann erzählst du mir alles. Was für ein Zufall, dass wir uns auf diese Weise kennengelernt haben!« Emilia gab den verführerisch duftenden Brei in eine Porzellanschüssel, die sie ohne Umstände Toni in die Hände drückte. Dann schob sie sie nach draußen in einen dunkel getäfelten Raum, in dem Ida und die anderen Frauen bereits am fein gedeckten Frühstückstisch saßen. Toni blieb keine Zeit, sich darüber zu wundern, dass Emilia nach dem gestrigen Vorfall schon wieder so frisch und unbeschwert umherwirbelte, das reinste Energiebündel. Sie spürte neugierige Blicke auf sich und fühlte sich angesichts des vornehmen Ambientes in ihrem wollenen Kleid mehr als unbehaglich.
»Darf ich euch Toni vorstellen! Sie ist wie wir alle in München zum Studieren«, rief Emilia in die Runde. »Und sie hat mich gestern vor der Sittenpolizei gerettet.«
Beschämt senkte Toni den Blick. »Das war selbstverständlich«, murmelte sie. Dabei war es eigentlich Georg Bender gewesen, der Emilia untersucht und in die Villa gebracht hatte.
»War es nicht! Du weißt gar nicht, was du mir alles erspart hast!« Emilia hatte unterdessen Platz genommen und den anderen die Teller gefüllt.
»Das ist Milchreis«, erklärte Ida, als sie Tonis fragenden Blick bemerkte.
»Daran wirst’ dich gwöhne müssen!«, lachte eine Frau mit blonden Zöpfen. »Ich bin übrigens Gerda!«
»Woran? Dass Emilia ständig mit der Sittenpolizei zu tun hat oder dass wir hier jeden Tag Milchreis essen müssen?« Das kam von der Braunhaarigen, die sich als Ilse vorstellte.
»Ich muss schon bitten!« Ida schenkte ihr einen mahnenden Blick, sie wirkte heute morgen übellaunig und unausgeschlafen. Die ganze Zeit über nestelte sie an ihrer Rüschenbluse und versuchte, die falsch geknöpften Knöpfe wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. »Andere wären froh, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekämen. Du weißt ja gar nicht, wie gut es hier in der Villa hat!«
Emilia ließ die Bemerkung nicht auf sich sitzen. »Ida kommt aus Norddeutschland, musst du wissen. Da ist Milchreis eine Art Nationalspeise«, konterte sie fix und rollte die Augen. »Bei uns in Spanien sagt man arroz con leche, und wir essen ihn als Nachtisch, niemals zum Frühstück. Was soll’s. Wer hungert, kennt kein hartes Brot.«
»In der Not frisst der Teufel Fliegen«, murmelte Toni, die sofort Emilias Anspielung verstanden hatte. Ein paar andere am Tisch kicherten und ernteten prompt einen strafenden Blick von Ida.
»Du kannst ja woanders dein Glück versuchen, wenn es dir hier nicht schmeckt, liebe Emilia! Du wirst in diesen Zeiten nirgends etwas Nahrhafteres finden …«, erwiderte Ida.
Toni hielt den Atem an, doch Emilia schien das Interesse an einer Auseinandersetzung mit Ida verloren zu haben. Stattdessen reichte sie Toni mit einem Zwinkern die eingelegten Zwetschgen. Die verstand sofort, dass diese eine Entschädigung dafür waren, dass das Gericht mehr aus Wasser denn aus Milch bestand, kaum mit Zucker und Zimt gesüßt. Bei allem Wohlergehen musste man offensichtlich auch in der Villa mit Lebensmitteln haushalten. Aber das gemeinsame Frühstück machte Toni jetzt schon Freude, es war ganz anders als zu Hause in den Bergen.
Mit jedem Löffel Milchreis fühlte Toni zum wiederholten Male an diesem Morgen, welch Glück sie mit allem gehabt hatte. Frohgemut erzählte sie den anderen, dass endlich ein langer Traum in Erfüllung gegangen sei und wie sehr sie sich auf ihr Studium freue. Deswegen hatte Tante Cilli Toni einen Privatlehrer auf die Alm geschickt, damit sie mit dem Abitur in der Tasche einen der begehrten Studienplätze für Frauen an der Universität bekäme. Toni sollte später frei von einem Mann entscheiden können, einen Beruf wählen und unabhängig sein. Wie konnte Cilli ahnen, wie unfrei Toni durch ihr Versprechen an ihre verstorbene Mutter war! Sie würde als Ärztin wieder zurück in die Berge gehen müssen, so viel stand jetzt schon fest. Und dort wäre dann alles so wie immer. Mit dem Unterschied, dass Toni eine eigene Praxis hätte – und Frauen und Kinder heilen konnte.
»Und, was willst du studieren? Warte, lass mich raten … Kunsthandwerk? Du bist bestimmt eine Künstlerin!« Ilse musterte neugierig Tonis Aufzug in dem wollenen Rock und der schlichten blauen Bluse dazu, die blonden Haare zu einem Dutt hochgezwirbelt, wie sie ihn immer trug. Sie deutete auf die filigrane Brosche, die an ihrem weißen Kragen steckte. Ein Vermächtnis der Mutter, ein Geschenk von Tante Cilli. Das einzige Schmuckstück, das Toni besaß.
»Mit diesen derben Händen? Das reicht höchstens für die Schlachterei. Halt, warte, ich hab’s: Lehrerin will sie werden und damit die Kinder ausschimpfen.« Gerda lachte und deutete auf Tonis Finger, die den Löffel umklammerten.
»Jetzt lasst doch das arme Mädel in Rua«, sprang Emilia ihr zur Seite. Es klang lustig, wie sie mit ihrem spanischen Akzent zwischendurch immer wieder bayrische Worte ins Hochdeutsch mischte.
»Schon gut«, beeilte sich Toni zu sagen und legte das Besteck beiseite, der Milchreis wärmte ihren Bauch. Gefüllt mit Dankbarkeit und Vorfreude prallten die Lästereien einfach an ihr ab.
»Ich will Medizin studieren«, antwortete sie so selbstbewusst wie möglich. »Und dann gehe ich zurück auf meinen Berghof.« Die wahren Hintergründe und dass sie sich für den Schwerpunkt Frauenheilkunde interessierte, verschwieg sie für den Moment. Mussten ja nicht alle wissen, auch wenn man in der Villa Libertas augenscheinlich einen sehr offenen Umgang mit Frauenthemen pflegte. Emilias Fehlgeburt schien auch niemand weiter zu interessieren, keine Fragen, keine Vorwürfe. Für Toni war es neu, sie musste sich erst daran gewöhnen. Zu Hause hätte man eine wie sie aus dem Dorf gejagt. Ein gefallenes, unehrenhaftes Mädchen.
»Hab ich’s gewusst!« Emilia griff nach Tonis Hand und drückte sie überschwänglich. »Du wirst bestimmt die beste Ärztin, die München, ach was: die Welt! je gesehen hat.«
»Das wird ein langer Weg!«, meinte Gerda weniger euphorisch. »Frauen in den Hörsälen sehen die Herren Professoren bekanntlich nicht so gerne, schon gar nicht in der Medizin. Ist ja auch sehr unweiblich.«
»Wieso denn das? Bei uns sind es immer die Frauen, zu denen die Menschen kommen, wenn sie Hilfe brauchen«, wunderte sich Toni und ging gar nicht weiter auf Gerdas Bemerkung ein. »Und was studiert ihr?«
»Wir studieren nicht«, erklärte Ilse wichtig, und Toni bemerkte, wie Maria die Stirn runzelte, denn offensichtlich handelte es sich bei den beiden um eine Ausnahme. Die anderen Frauen – Irmi und Anni, wie Toni lernte – am Tisch wollten Lehrerinnen werden, Berta war an der Hochschule für Bildende Künste eingeschrieben.
»Wir arbeiten beim Obermüller, Gerda im Verkauf und ich im Büro als Sekretärin.«
»… damit sie eines Tages einer der feschen Brüder heiratet«, neckte Emilia, und prompt lief Ilse rot an.
»Wie bitte?«, kam es missbilligend von Ida. »Wer will hier heiraten? Wieso denn das? Und sag jetzt bitte nicht aus Liebe!«
»Wir!« Das kam von Gerda, die aufgestanden war. »Das kannst du uns nicht verbieten, Ida! Immer diese Schufterei! Von wegen selbstbestimmt! Ich will dir was sagen, ich habe diese ganze Emanzipation so satt! Ich will endlich eine anständige Frau sein, mit Mann und Kind und einem Heim. Und nicht jeden Tag von früh bis spät für andere Kleiderbügel sortieren oder auf die Leiter steigen. Meinst du, mir macht es Spaß, mir unter den Rock gucken zu lassen? Dann geh ich lieber mit dem Loisel tanzen! Der ist ein ehrenwerter Kerl.«
» Und erzähl mir nicht, eigenes Geldverdienen macht uns unabhängig!«, machte Ilse weiter. »Von den paar Reichsmark kann ich mir nichts leisten. Außerdem haben wir selbst als Sekretärin keine Sozialversicherung oder andere Rechte, hast du uns selbst erklärt. Die behandeln uns wie Sklaven, wenn wir nicht aufpassen. Der junge Obermüller ist da anders, er weiß meine Arbeit zu schätzen. Ihm zuliebe mache ich gerne ein paar Überstunden und koche Kaffee …«
»Wenn ihr das so seht.«
Toni blickte erschrocken hoch. Was hatte Ida nur? Mit zusammengekniffenem Mund begann diese jetzt, die Teller zusammenzuräumen. Dann stand sie langsam auf, hob den Blick und sagte mit klarer Stimme: »Ich gebe euch eine Stunde. Dann sind eure Zimmer geräumt. Tante Cillis Wunsch war es ausdrücklich, dass unter diesem Dach keine Frau sich jemals wieder in die Abhängigkeit eines Mannes begibt.« Ida machte eine Pause und straffte würdevoll die Schultern, bevor sie fortfuhr: »Wollt ihr wirklich heiraten? Wenn das so ist: Es steht euch frei zu gehen! Also bitte: Packt eure Sachen und verlasst mein Haus.« Sprach’s und lief mit dem Geschirr in die Küche, wo man sie alsbald mit Maria lautstark diskutieren hörte. Ilse und Gerda wechselten einen erschrockenen Blick, blieben aber wortlos sitzen.
Mit offenem Mund hatte Toni zugehört. Idas radikale Haltung in Sachen Frauenemanzipation verunsicherte sie. Schließlich wollte sie selbst eines Tages Franzl heiraten und mit ihm Kinder kriegen.
»Komm!« Emilia zog Toni mit sich vom Tisch, nicht ohne Ilse und Gerda Lebewohl zu sagen. Die anderen Frauen hatten längst ihren Platz verlassen.
»Die müssen dir nicht leidtun«, meinte Emilia, als sie sich draußen auf der Veranda eine Zigarette anzündete. »Auch eine? Mädchen, Mädchen, du musst noch viel lernen, wenn du eine von uns emanzipierten Frauen sein willst«, fügte sie hinzu, als Toni dankend ablehnte.
Diese nickte abwesend, sie hatte etwas entdeckt. Fasziniert schaute sie in den parkähnlichen Garten, der sich hinter der Villa erstreckte. Die ersten Forsythien blühten, der Winterjasmin ebenfalls, hier und da streckten sich Tulpen, und am Fuße des Walnussbaumes zeigte sich neben der Bank ein Meer an Winterlingen. Noch wirkten Beete und Rabatten wie tot, bald würden sich hier die ersten Triebe zeigen und ihre volle Pracht entfalten, das spürte Toni ganz genau. Nicht mehr lange, dann würde in diesem Garten alles vor Farbe und Lebenslust explodieren. Wie zu Hause in dem Weiler. Endlich Frühling. Die Vorfreude zauberte ein Lächeln in Tonis Augen, sie konnte sich nicht sattsehen an der knospenden Natur.
»Mach dir nichts aus Ida, sonst ist sie nicht so«, meinte Emilia und pustete den Rauch in die Luft.
»Ida wirkt … einsam. Und verbittert.« Toni zuckte mit den Schultern. Sie verspürte wenig Lust, sich darüber Gedanken zu machen. Auf dem Berghof war es nicht wichtig, Fragen zu stellen. Ob man sich mochte, war auch egal. Man lebte, um der Gemeinschaft zu dienen, half und unterstützte sich gegenseitig, ohne Fragen zu stellen. Der Zusammenhalt der Dörfler war wichtiger als das Ansinnen eines Einzelnen, denn der Berg war mächtig und gefährlich, da hatte ein Einziger alleine keine Chance. Da hatten Animositäten keinen Platz.
»Ich weiß auch nicht, was mit ihr ist«, sagte Emilia und drückte ihre Zigarette aus. »Manchmal höre ich sie nachts weinen. Und dann wieder ist sie so froh und stark, organisiert unser Zusammenleben. Hat im Turm dieses als Grünen Salon getarnte Krankenzimmer eingerichtet. Lädt zu Frauenabenden ein, Lesungen, Diskussionen, Konzerte. Gemeinsam mit Maria verteidigt sie Cillis Erbe bis aufs Blut, als ob sie die Frauenrechte selbst erfunden hätte. Du hast es ja gerade selbst erlebt …« Sprach’s und umarmte dann Toni liebevoll. »Ich freue mich so, dass du hier bist, liebe Toni. Warte ab, dir wird es hier gefallen, da bin ich mir sicher. Du und ich, das wird famos.«
»Bestimmt«, antwortete Toni und wusste nicht, warum sie ausgerechnet in diesen Moment an Georg Bender dachte.