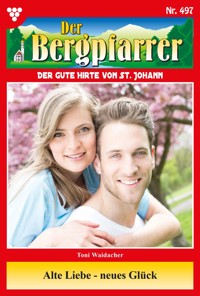Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. »Grüß Gott, Frau Maierhofer. Na, wie geht es Ihnen denn heute?« Lächelnd trat Julia Lembach an das Bett der älteren Frau mit dem grauen dauergewellten Haar. Die lag aber weiterhin reglos da und starrte gegen die Decke des Krankenhauszimmers. Julia unterdrückte ein Seufzen. Die 29-jährige Krankenschwester hatte schon von ihren Kolleginnen gehört, dass Frau Maierhofer, die zusammen mit dem erwachsenen Sohn den Hof des schon vor Jahren verstorbenen Mannes weiterführte, keine einfache Patientin war. Sie war am vergangenen Freitagvormittag stationär in der Bergklinik auf der Nonnenhöhe aufgenommen worden, kurz nachdem Julia sich nach ihrem Nachtdienst ins Wochenende verabschiedet hatte. Wie ihre Kolleginnen ihr berichtet hatten, hatte die Bäuerin im Rentenalter schon lange über Erschöpfung und Schwindelanfälle geklagt, war aber nie zu einem Arzt gegangen. Als es dann schließlich schlimmer geworden war, hatte sie sich auch noch mit Händen und Füßen geweigert, in die Klinik zu gehen, nachdem Dr. Wiesinger aus St. Johann eine schwere Blutarmut bei ihr diagnostiziert hatte. Am Ende hatte es des guten Zuredens von Pfarrer Trenker bedurft, um sie zur Vernunft zu bringen. Jetzt blickte Frau Maierhofer sie irritiert an. »Wo ist denn Ihre Kollegin?«, fragte sie. »Schwester Beate hatte nur Wochenenddienst«, erklärte Julia. »Jetzt bin ich für Sie da, Frau Maierhofer. Mein Name ist Schwester Julia.« »Na, wenigstens haben Sie gefragt, wie es mir geht. Diese Schwester Beate dagegen fragt immer ›Na, wie geht es uns denn heute?‹ Die grauhaarige Patientin schüttelte den Kopf. »Eine dämliche Frage. So redet man doch höchstens mit Kleinkindern!« Da musste Julia lachen. »Aber Schwester Beate ist doch auch sehr
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer – 438–
Wo viel Licht ist, ist auch Schatten ...
Rätsel um die neue Krankenschwester test
Toni Waidacher
»Grüß Gott, Frau Maierhofer. Na, wie geht es Ihnen denn heute?« Lächelnd trat Julia Lembach an das Bett der älteren Frau mit dem grauen dauergewellten Haar.
Die lag aber weiterhin reglos da und starrte gegen die Decke des Krankenhauszimmers.
Julia unterdrückte ein Seufzen. Die 29-jährige Krankenschwester hatte schon von ihren Kolleginnen gehört, dass Frau Maierhofer, die zusammen mit dem erwachsenen Sohn den Hof des schon vor Jahren verstorbenen Mannes weiterführte, keine einfache Patientin war.
Sie war am vergangenen Freitagvormittag stationär in der Bergklinik auf der Nonnenhöhe aufgenommen worden, kurz nachdem Julia sich nach ihrem Nachtdienst ins Wochenende verabschiedet hatte.
Wie ihre Kolleginnen ihr berichtet hatten, hatte die Bäuerin im Rentenalter schon lange über Erschöpfung und Schwindelanfälle geklagt, war aber nie zu einem Arzt gegangen. Als es dann schließlich schlimmer geworden war, hatte sie sich auch noch mit Händen und Füßen geweigert, in die Klinik zu gehen, nachdem Dr. Wiesinger aus St. Johann eine schwere Blutarmut bei ihr diagnostiziert hatte.
Am Ende hatte es des guten Zuredens von Pfarrer Trenker bedurft, um sie zur Vernunft zu bringen.
Jetzt blickte Frau Maierhofer sie irritiert an. »Wo ist denn Ihre Kollegin?«, fragte sie.
»Schwester Beate hatte nur Wochenenddienst«, erklärte Julia. »Jetzt bin ich für Sie da, Frau Maierhofer. Mein Name ist Schwester Julia.«
»Na, wenigstens haben Sie gefragt, wie es mir geht. Diese Schwester Beate dagegen fragt immer ›Na, wie geht es uns denn heute?‹ Die grauhaarige Patientin schüttelte den Kopf. »Eine dämliche Frage. So redet man doch höchstens mit Kleinkindern!«
Da musste Julia lachen. »Aber Schwester Beate ist doch auch sehr freundlich, net wahr?«
»Ach was!« Grimmig winkte die Patientin ab. »Die hat nur Mode und Schminke im Kopf, genau wie meine Schwiegertochter!«
»Sie hält net viel von ihrer Schwiegertochter, müssen S‘ wissen, Schwester Julia«, sagte Hildegard Hornung, die Dame aus dem Nachbarbett des hellen Zweierzimmers, die soeben aus dem Badezimmer kam. Frau Hornung war schon seit einer Woche in der Klinik. »Das ganze Wochenende hat sie nur auf das arme Ding geschimpft.«
»Das arme Ding, pah!«, gab Maria Maierhofer aufgebracht zurück. »Das arme Ding hat sich doch meinen Sohn nur um den Finger gewickelt, um sich am Ende den Hof unter den Nagel zu reißen!« Leiser fuhr sie fort: »Mein Thomas ist nämlich zu gutgläubig, müssen S‘ wissen, Schwester Julia. Und deshalb muss ich auch so schnell wie möglich zurück nach Hause. Einer muss doch nach dem Rechten dort sehen!«
»Na, na, Frau Maierhofer«, wandte Julia ein. »Vor allem müssen Sie zu allererst einmal gesund werden. Das ist jetzt das Wichtigste. Und danach können Sie weitersehen.«
»Aber …«
Doch da war Julia resolut. »Nein, kein Aber. Wie ich hörte, sind sie ohnehin viel zu spät zum Arzt gegangen, net wahr?«
»Was heißt zu spät?« Die alte Bäuerin, die sich inzwischen aufgerichtet hatte, wobei Julia ihr geholfen hatte, das Kopfkissen zu richten, zuckte die Achseln. »Zeit meines Lebens habe ich Ärzte gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Die einzige Medizin, die ich genommen habe, habe ich mir selbst verabreicht. Und zwar in Form von Kräutern und Heilwassern. Und soll ich Ihnen was sagen, Schwester Julia? Ich bin damit immer gut gefahren, jawohl! Und das wäre auch so geblieben, das sag ich Ihnen. Bloß hat man mich jetzt ja gedrängt, zum Arzt zu gehen, und wohin hat es mich gebracht? Hierher, ins Krankenhaus!«
»Na«, sagte ihre Zimmergenossin, »da möchte ich ja mal wissen, wie Sie sich selbst die Eisen- und Blutinfusionen verabreichen wollten, so ganz ohne Arzt. Und dass Sie die bitter nötig hatten, steht ja wohl fest! Du lieber Himmel, als Sie am Freitag zu mir ins Zimmer kamen, hab ich Sie ja kaum von der Bettwäsche hier unterscheiden können, so weiß waren Sie im Gesicht!«
Unwirsch winkte die Bäuerin ab. »Ach, papperlapapp! Jeden Tag einen Teelöffel Kräuterelixir, und ich wäre in drei Wochen wieder auf der Höhe gewesen! Stattdessen lieg ich nun hier, und daheim auf dem Hof geht alles den Bach runter.«
»Natürlich spricht nichts dagegen, wenn man bei gewissen Beschwerden auch auf die Heilmittel der Natur setzt«, erklärte Julia. Sie selbst vertraute auf die Schulmedizin, stand aber auch natürlichen Methoden offen gegenüber. Ihrer Meinung nach sollte man weder das Eine noch das Andere verteufeln; dass gerade ältere Menschen auf dem Land Ärzten sehr kritisch gegenüberstanden, wusste sie allerdings auch. Deshalb hielt sie es für das Beste, die Sorgen der Bäuerin ernst zu nehmen und die Frau keineswegs für ihre Ansicht zu verurteilen. Damit würde sie nichts erreichen. »Allerdings sollten wir auch die Möglichkeiten, die die Schulmedizin uns bietet, nutzen. Ich habe ja eben auch schon mit dem Stationsarzt gesprochen, Frau Maierhofer. Und ich kann Ihnen versichern, dass es mit ein bisschen Kräutersaft nicht mehr getan gewesen wäre. Ihre Blutwerte waren sehr schlecht. Ohne fachgerechte Behandlung wären Sie in spätestens zwei Wochen einfach umgefallen. Und was hätte Ihr Sohn dann gemacht? Stellen Sie sich doch bloß vor, wie groß der Schock für ihn gewesen wäre.«
Dafür hatte Maria Maierhofer lediglich ein skeptisches Schulterzucken übrig.
»Wichtig ist jetzt vor allem, dass Sie erst einmal wieder zu Kräften kommen«, fuhr Julia fort. »Dafür sorgen die Infusionen, die Sie in den nächsten Tagen weiterhin bekommen. Und dann muss geschaut werden, woher Ihre Blutarmut kommt, denn es bringt nichts, nur die Symptome zu behandeln. Vielmehr muss der Ursache auf den Grund gegangen werden.« Sie legte der Patientin eine Hand auf den Unterarm. »Und solange sollten Sie sich net zu viel Gedanken um den Hof machen«, riet sie. »Ich bin sicher, Ihr Sohn kommt auch mal eine Weile ohne Sie zurecht.«
»Das sagen Sie so leicht! Ich hab doch niemanden, der da mal nach dem Rechten schauen könnte.«
Julia dachte kurz nach. »Wenn Sie einverstanden sind, könnte ich ja mal mit Pfarrer Trenker sprechen«, schlug sie schließlich vor. Da sie wusste, dass es dem »Bergpfarrer«, wie er von den Leuten in der Umgebung liebevoll genannt wurde, immerhin gelungen war, die Bäuerin dazu zu bewegen, letztendlich doch zum Arzt zu gehen, schien er einen gewissen Draht zu ihr zu haben. »Sicher ist er bereit, ab und zu mal bei Ihnen auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen.«
Da fingen die Augen der älteren Frau an zu leuchten. »Das würden Sie für mich tun?«, fragte sie beinahe ungläubig.
Julia lächelte. »Aber sicher doch«, sagte sie. »Wenn ich Ihnen damit wenigstens ein bisserl helfen kann …
»Oh ja, das würden Sie«, erwiderte Maria Maierhofer und nickte ihr zu. »Da dank ich Ihnen recht schön, Schwester Julia.«
*
Als sie ihren Dienst am späten Nachmittag beendete, atmete Julia Lembach erleichtert auf. Der erste Arbeitstag nach einem Wochenende war immer besonders stressig, fand sie. Da musste man sich erst wieder in die Arbeit hineinfinden und war noch irgendwie im »Wochenend-Modus«.
Wobei von Stress in dieser Klinik, im Vergleich zur Klinik in München, in der sie vorher einige Jahre gearbeitet hatte, eigentlich keine Rede sein konnte.
Natürlich ging es auch hier mal turbulenter zu, und natürlich musste es auch hier bei Notfällen sehr schnell gehen, und manches war auch mal nicht perfekt organisiert, aber das war im Klinikalltag normal und ließ sich nicht ganz vermeiden.
Ansonsten aber war sie vom ersten Tag an überrascht darüber gewesen, wie menschlich es hier in der Klinik zuging. Jeder Arzt und jede Schwester kannte den Namen jedes Patienten, auf seiner Station, ohne in irgendwelche Akten blicken zu müssen, es wurde sich auch ungewöhnlich viel Zeit für Patienten genommen und auch einfach mal private Gespräche geführt oder sich über das Wetter unterhalten. Dabei wurde dann auch noch viel gelacht, es herrschte eine richtige Herzlichkeit.
Hier waren die Patienten keine Nummern, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, auf die man einging, und zwar auch auf die Sorgen und Nöte, die nicht direkt etwas mit der jeweiligen Erkrankung zu tun hatten.
Und das zog sich durch die gesamte Klinik. Der Leiter der Bergklinik Nonnenhöhe, Professor Bernhard, den Julia gleich an ihrem ersten Tag persönlich kennengelernt hatte, war nicht nur Experte im Bereich der internistischen Medizin – überall auf der Welt hatte er schon Patienten behandelt und zudem zahlreiche Studenten als Doktorvater begleitet. Aber trotz allem war er jemand, der sich auch für die persönlichen Belange seiner Patienten interessierte und zudem ein ausgesprochen freundlicher Mann.
Aus all diesen Gründen betrachtete Julia es auch als absoluten Glücksfall, dass sie vor knapp einem Moment hier in der Klinik angefangen hatte. Wobei man das, was sie letztendlich nach St. Johann gebracht hatte, alles andere als mit dem Wort Glück zu bezeichnen war. Eher das Gegenteil war der Fall.
Doch darüber wollte sie nicht nachdenken, als sie jetzt ins Schwesternzimmer eilte, nachdem sie sich im Umkleideraum ihre normale Freizeitkleidung angezogen hatte, die im Gegensatz zu ihren Arbeitsklamotten nicht schneeweiß war. Aber auch nicht wirklich bunt. Eine einfache graue Jeans und ein dunkles T-Shirt genügten ihr. Julia war nicht sehr modebewusst, und auch auf Schminke und aufgedonnerte Haare verzichtete sie für gewöhnlich. Ihr langes blondes Haar hing glatt herunter und brauchte eigentlich nur ordentlich gekämmt zu werden, um in Form zu kommen.
Gerade als sie nun ins Schwesternzimmer auf ihrer Station eintrat, kamen Marina und Andreas heraus, wobei sie ihr freundlich zunickten. Julia wusste, dass die beiden ein Paar waren und auch noch nicht allzu lange in der Klinik arbeiteten. Es hatte am Anfang wohl einige Schwierigkeiten gegeben, weil Andreas beschuldigt worden war, Diebstähle in der Klinik begangen zu haben, doch am Ende hatte sich herausgestellt, dass er unschuldig war, weshalb er auch weiter in der Klinik als Pfleger abreiten konnte. Marina war ebenfalls Krankenschwester.
Am großen Tisch im Schwesternzimmer saßen drei Personen: Die zwei Pfleger, Jannick Berger und sein Kollege Florian Erdmann, gingen zusammen mit Oberschwester Simone gerade ihre Dienstpläne durch.
Jannick Berger schenkte ihr ein freundliches, etwas schüchternes Lächeln, als sie zu ihnen an den Tisch trat. Julia mochte Jannick. Er war immer freundlich, vor allem aber auch angenehm zurückhaltend.
Ganz im Gegensatz zu seinem Kollegen Florian. Der hatte immer einen flotten Spruch auf Lager und hielt nie mit irgendetwas hinterm Berg.
»Ach, die Julia«, meldete er sich auch jetzt wieder gleich zu Wort. »Na, schon Feierabend? Wie schade, mein Dienst fängt gerade erst an. Sonst hätten wir etwas unternehmen können.« Jetzt grinste er breit. »Aber wenn du magst, kannst du mich ja heute Nacht, wenn ich Dienstschluss hab, besuchen kommen …«
»Danke, kein Interesse«, stellte Julia klar. Ganz gleich, ob das eher scherzhaft oder ernst gemeint sein sollte – auf solche billigen Sprüche reagierte sie allergisch.
»Immer lehnst du meine Angebote ab«, jammerte Florian Erdmann daraufhin gespielt. »Bei anderen Madeln geht mir das net so.«
»Und wie du siehst, bin ich net die anderen.« Kopfschüttelnd ging Julia hinüber zum Schreibtisch, wo eine Liste lag, in der sich jeder ein- und austrug, wenn er zum Dienst erschien oder nach Dienstschluss das Krankenhaus verließ.
»Jetzt lass doch mal die Julia in Ruhe«, meldete sich jetzt Jan Berger zu Wort. »Merkst du net, dass sie deine dummen Sprüche net lustig findet?«
Florian hob die Schultern. »Was kann ich dafür, wenn manche Leute zum Lachen in den Keller gehen?«
»Kinder, nun ist aber mal gut!«, sorgte Oberschwester Simone nun für Ruhe. »Über so was könnt ihr euch in eurer Freizeit unterhalten. Jan und Florian, wir gehen jetzt weiter eure Dienstpläne durch. Und Julia, dir wünsche ich einen schönen Feierabend. Komm gut nach Hause und mach dir einen schönen Abend.«
Julia lächelte. »Danke, das werde ich machen. Und euch noch eine angenehme Schicht.«
Damit verließ sie das Schwesternzimmer. Als sie schließlich die Aufzüge erreichte und den Rufknopf drückte, vernahm sie eine männliche Stimme hinter sich.
»Julia, wart‘ doch bitte einmal.«
Sie drehte sich um und erblickte den Kollegen Berger, der auf sie zugeeilt kam. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Nicht nur, weil sie erleichtert war, dass es sich nicht etwa um den Florian handelte, der ihr nachlief. Jannick war einfach ein netter junger Mann, und wenn sie ihn sah, freute sie sich immer, auch wenn sie nicht an weitergehendem Kontakt interessiert war.
Denn an so etwas hatte sie grundsätzlich kein Interesse. Nicht nach der Sache in München …
»Was gibt’s denn, Jannick?«, fragte sie.
Er blieb vor ihr stehen. Nicht zum ersten Mal fiel ihr auf, dass er nicht nur nett war, sondern auch ziemlich gut aussah. Groß und schlank, mit dunklem Haar, das einen kurzen, aber modernen Schnitt aufwies, und seine Augen waren von einem so strahlenden Blau, dass es an das herrliche Wasser eines Bergsees erinnerte.
›Die Madeln im Dorf liegen einem Burschen wie ihm mit Sicherheit zu Füßen‹, dachte Julia. Sie konnte es sich nicht erklären, aber aus irgendeinem Grund verspürte sie bei diesem Gedanken einen leichten Stich.
Aber warum? Das alles ging sie schließlich nichts an und sollte sie auch nicht interessieren.
»Ich … ich wollte dir nur sagen, dass du am besten nix um das Gerede vom Florian gibst«, sagte er und klang erst ein wenig unsicher. Dann nahm seine Stimme einen festeren Klang an. »Der redet einfach immer drauflos, ohne Nachzudenken, und will sich immer irgendwie wichtig oder groß vorkommen. Ist einfach seine Art.«
»Ich weiß«, erwiderte Julia lächelnd. »Ich arbeite zwar erst etwas über einen Monat hier, aber man lernt die Leute doch recht schnell kennen. Und keine Bange, ich geb schon nix um das Gerede. Heiße Luft und nix dahinter, sag ich immer. Aber danke schön, dass du mir extra nachgekommen bist. Das ist wirklich … nett von dir.«
Nun entstand ein etwas hilfloses Schweigen, und als schließlich der Aufzug kam, war Julia recht froh, sich verabschieden zu können.
Nicht nur wegen dem eigentümlichen Schweigen, sondern auch, weil ihr Herz auf einmal aus unerfindlichen Gründen wild zu hämmern begann.
»Also dann«, sagte sie rasch und drückte drinnen in der Kabine den Knopf für das Erdgeschoss. »Bis morgen, Jannick.«
»Bis morgen, Julia.«
*
»Na, wo hast du denn so eilig hin gemusst?«, fragte Florian, als Jannick das Schwesternzimmer wieder betrat.
In dem Moment meldete sich Oberschwester Simones Pieper, und ihre direkte Vorgesetzte eilte aus dem Raum.
»Das war … Ich hatte noch was in Zimmer drei vergessen«, antwortete Jannick schnell. Eigentlich schwindelte er nicht gerne, aber diese kleine Notlüge musste sein. Florian brauchte schließlich nicht wissen, dass er gerade mit Julia über ihn gesprochen hatte!
»Soso«, meinte der andere Krankenpfleger nur. »Aber sag mal, jetzt, wo wir unter uns sind …«
»Ja?«
»Findest du die Neue net auch komisch?«
»Die Julia? Komisch?« Jannick zog die Schultern hoch. »Wie kommst du darauf?«
»Na, fällt dir das denn net auf, dass sie sich total abkapselt? Seit sie hier arbeitet, kommt sie ganz kurz vor Dienstbeginn, und hinterher ist sie sofort wieder weg. Die redet doch mit kaum jemandem hier mal ein privates Wort!«
»Vielleicht ist sie einfach zurückhaltend«, gab er zu bedenken.
»Zurückhaltend, ach was!« Florian winkte ab. »Eingebildet ist sie, das sieht man doch gleich! Typisch für Frauen aus der Stadt, wenn du mich fragst.«