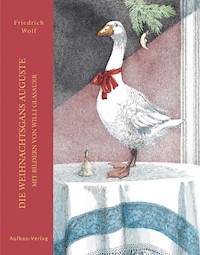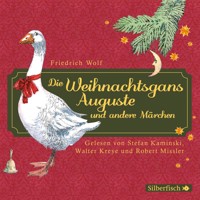9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Friedrich Wolfs „Zwei an der Grenze“ ist ein fesselndes Zeitdokument, das die Kämpfe und Hoffnungen einfacher Menschen im Schatten des Nationalsozialismus schildert. In einem kleinen sudetendeutschen Dorf in der Tschechoslowakei nahe der deutschen Grenze prallen die Widersprüche zwischen privatem Glück und politischem Engagement, zwischen Solidarität und Verrat mit voller Wucht aufeinander. Im Zentrum stehen Hans, Loni und Mutter Marie – Charaktere, deren Leben von Mut, Menschlichkeit und der Suche nach Gerechtigkeit geprägt ist. Wolf beschreibt in mitreißender Intensität die Herausforderungen des Widerstands, die inneren Konflikte seiner Protagonisten und die Mechanismen von Macht und Manipulation. Ob in den dramatischen Ereignissen rund um das solidarische Sirenenkonzert zur Beisetzung eines ermordeten Arbeiters, dem Streik der Arbeiter oder Hans‘ gefährlichen Missionen an der Grenze: Dieses Werk beleuchtet eindringlich, wie Vertrauen, Loyalität und Solidarität selbst in den dunkelsten Zeiten einen Funken Hoffnung bewahren können. Ein zeitloses literarisches Meisterwerk über die Würde des Einzelnen, die Stärke der Gemeinschaft und die Frage, wie weit der Mensch für Freiheit und Gerechtigkeit gehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Friedrich Wolf
Zwei an der Grenze
ISBN 978-3-68912-397-0 (E–Book)
Der Roman ist von 1938.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2024 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Erstes Kapitel: DER FLÜCHTLING
1. An Interessenten zu verkaufen!
Der Mann auf der groben Holzbank neben dem Ofen scheint wie tot. Sein Oberkörper hängt gleich einem Ballen Tuch in den Armen des Jüngeren, sein Kopf mit dem schweißverklebten Haar berührt fast den Tisch. Die Alte hat ihm grade die Stiefel heruntergezogen und die verdreckte, durchblutete Hose übers Knie gestreift.
„Besser ins Bein als ins Hirn!“, stellt sie fest und reinigt mit Leinenfetzen und Arnika die Wundränder. „Das Schlimme ist noch immer nicht das Schlimmste …“; mit kundiger Hand faltet die fünfzigjährige kräftige Bäuerin einige saubere Lappen zu einer Kompresse und drückt sie auf die durchschossene Wade. „ … grad droben am Golm herumturnen muss man.“
„Das nächste Mal kommen wir in einem Luxuswagen, Mutter Marie!“, meint der „Stummel“. (Er verlor zwei Finger der rechten Hand durch eine Kreissäge.)
Die Frau schweigt.
„Habt ihr den Schuss gehört?“
„Hörst eher den Satan husten in so ’ner Nacht“, brummt die Marie, „wo die Schloßen uns fast die Scheiben zertrommeln.“ Sie hat den Verband beendet und beginnt mit Hilfe des Jungen dem Verwundeten das völlig durchnässte Oberzeug auszuziehen. Rock, Sweater und Hemd wirft sie über die Stangen des mächtigen Bauernofens, dann schlingt sie ein grobes Handtuch um die Brust des Mannes, kniet hinter ihm, nimmt ihn wie ein Kind in die Arme und beginnt, den Halberstarrten mit aller Kraft zu reiben. Der hustet, stöhnt, schaut jetzt gradeaus auf den jungen Arbeiter. „Stummel …“
„Morgen, Hans!“ lächelt der ihm zu, „beinah könnt man zu dir sagen: gute Nacht!“
„Ist der Kaffee noch nicht fertig? Gieß Spiritus auf den Kocher, Mädel!“, ruft die Bäuerin ins Halbdunkel des Zimmers.
Hans schaut sich um, zur Mutter Marie und wieder zu seinem Kameraden. „Schon drüben?“
„Wo wir hinwollten.“
Er betrachtet sein Bein. „Ach so …“ Dann meint er zu der Frau: „Die Mutter vom Otto?“
„Die Mutter vom Otto“, wiederholt die Marie und betupft eifrig die Schrammen an seinen Händen mit Arnika; „war auch so einer.“ Sie streift jetzt dem Verwundeten ein frisches, grobes Hemd über, das man ihr aus dem Dunkel zuwirft, auch eine dicke Wolljacke, wie sie die Arbeiter im Steinbruch tragen.
Der Angeschossene sieht sich um. „Schon lange hier?“
„’ne halbe Stunde Vorsprung!“, erklärt der Stummel und nimmt seinen Kopf. „Über die ,kahle Wand‘ machen sogar die SS-Patrouillen nicht gern ’ne Himmelfahrt.“
„Hier, Mutter!“ Ein Mädel von vielleicht zwanzig Jahren bringt eine große Emaillekanne und zwei Tassen; sie verschwindet sofort wieder und trägt dann noch Brot und Schlackwurst hinzu. Dem Verwundeten geht’s nicht ums Essen. Gierig schlürft er den heißen Kaffee, eine Tasse, zwei … seine Hand zittert, die schwarze Flüssigkeit rinnt aus den Mundwinkeln. Das Mädel bringt frisches Wasser. Ja, das ist besser, aber auch das Wasser verschüttet er, obschon er den Becher mit beiden Händen umfasst wie einen Pokal.
„Was stehst du herum, Loni? Die Strümpfe runter!“
Das Mädel fährt zusammen, bückt sich und streift dem Mann die von Schneewasser und Lehm durchweichten Strümpfe von den Füßen. Der rechte klebt, das Blut vom Wadenschuss ist unten geronnen; sie löst vorsichtig die Kruste, sie kann ruhig fester ziehen .., der Hans merkt es nicht, erschöpft ist er zurückgesunken, in die Arme der Marie; schmal und kantig liegt sein Kopf an der hohen, vollen Brust der Bäuerin.
Was muss der Mann durchgemacht haben? Immer wenigeren gelingt es in letzter Zeit – da die Sperrketten des SS-Grenzschutzes mit ihren Meldehunden verdreifacht wurden –, den Gebirgskamm nachts zu überschreiten. Ein Glück, dass der Stummel ein so sicherer Führer ist, der jeden Spalt, jede schattenwerfende Wand des sonst kahlen Golms kennt; ein zuverlässiger, stets williger und lebensfroher Kamerad ist dieser zwanzigjährige Holzarbeiter aus dem deutschen Grenzort. Er stellt jetzt die kleine Petroleumlampe nach hinten, drückt den Laden etwas auf und späht in den Februarmorgen. Durch die teerdicke Nacht rinnt vom östlichen Horizont ein schmaler, feuriger Streifen, ein vorzeitiger Schimmer des Morgenrots.
„Wird Zeit für mich“, meint der Stummel und schlüpft in seine Windjacke; „Mutter Marie, haltet den Hans noch ein paar Tage hier, aber keinen zulassen, auch keinen Knochenflicker!“
„Denkst wohl, ich lass ihn hinmachen?“, knurrt die Marie, krempelt das Hemd über ihren muskulösen Armen auf und erneuert die Kompresse. Sie kann es nicht vergessen, wie im letzten Jahr ihr Junge, der Otto, bei einem Überfall durch die Faschisten von einem Stich in die Brust schwer verwundet wurde und wie der Bezirksarzt an ihm herumfuhrwerkte, bis er ganz verblutete.
Der Stummel hat eine alte Autohaube über seinen hellen Haarschopf gestülpt; das Mädel steckt ihm schnell den Rest der Wurst zu, er sträubt sich einen Augenblick. „Loni, die glauben daheim, ich hab geerbt!“
„Wegen ’ner Wurst?“
„’ne Wurst, du, das ist drüben was Kolossales, direkt ein Kapital! Hing da letzte Woche an unserm Arbeitsamt ’ne alte Bratpfanne, und auf die schwarze, rußige Platte war mit Kreide draufgemalt: ,An Interessenten zu verkaufen!“'
Hans hat sich aufgerichtet. „Seid vorsichtig, Stummel!“
„An Interessenten zu verkaufen!“, lachte der über beide Ohren weg. „Hunderte haben’s gesehn, bevor die SS-Wache die verrostete Schmalzkanone herunterholte; war das nicht prima?“
„Prima“, bestätigt der andre, und dann leiser: „Nur, möglichst wenige von uns sollen dabei kaputtgehn, Stummel …“
Der Stummel ist fertig.
Hans drückt ihm die Hand. „Grüß mir die Kumpels, Stummel, ich komme bald.“
2. Wie die Löffelmarie den Gendarmen bedient
Die Mutter Marie hat den Stummel nach draußen geleitet. Der junge deutsche Arbeiter muss noch vor der Morgendämmerung über die Grenze.
Die Loni wischt mit heißem Wasser den Boden auf. Überall sind Blutspuren. Plötzlich schaut sie nach dem Verwundeten; er stützt seine Arme auf den Tisch, sein Körper ist wieder vornübergesunken. Das Mädchen holt eine Decke, rollt sie, zögert einen Augenblick; dann tritt sie hin. „Leg dich!“ Sie bettet ihn auf die Bank und schiebt die Rolle unter seinen Kopf.
Er atmet tief.
Die Stille im Zimmer summt. Ganz leise geigt es in seinen Ohren. Sein Blut oder der hohe Wind im Kamin? So ruhig war’s seit Monaten nicht mehr. Keine schwarze Uniform wird hier auftauchen. Deutschland liegt drüben. Drei Kilometer weit. Mindestens! Jawohl, diese drei Kilometer sind wie dreihundert! Dazwischen ist die Grenze. Wie frei das Mädel sich bewegt; man merkt, sie musste noch nicht oft sich ducken, ihre Gedanken verschlucken, an die Wand gepresst lauschen. Sie ist nicht groß, aber ihre Schultern sind kräftig, ihre Bewegungen sind direkt und jungenhaft. Sie kniet nicht beim Aufwischen, sie macht das stehend, wie Matrosen auf den Flussschiffen, die Arme in die Seiten gestemmt, mit einem Fuß den feuchten Lappen über den Boden ziehend.
Hans schaut durch die Spalte der Läden. In braunroten Schleiern erhebt sich der Tag. Dort, im Norden, steht eine blauschwarze Wand, da muss der Rossberg liegen und die kahle Felswand des „Golm“ und dahinter …. Deutschland.
Die Bäuerin tritt ein. Sie riegelt hinter sich ab, geht auf den Hans los. „Schnell, in die Kammer!“
Das Mädel schaut sie an.
„Der Wachtmeister!“
Auf beide Frauen gestützt humpelt der Flüchtling die schmale Stiege nach oben. Ein kleiner, holzverkleideter Raum. Sie heben ihn auf ein Bett, werfen ihm eine Decke über und verschwinden. Er hört, wie nebenan sich jemand legt, wie die Stiege knarrt unter eiligen Schritten.
„Mutter Marie … ersuche aufzumachen!“
„Du?“, fragt die Bäuerin leise.
„Musst erst fragen?“
„Mitten in der Nacht …“, zieht die Marie das Gespräch hin, „… hab heut keinen Humor für Mannsleut.“
„Der Gendarmerie aufzumachen, dazu braucht’s keinen großen Humor.“ Der draußen drückt die Klinke nieder. „Vorwärts! Aufgemacht!“
Der Gendarmeriewachtmeister Josef Wirrba steht breit und dienstlich in der Stube, die nur von der kleinen Lampe erhellt ist. Einzelne Stellen des Fußbodens sind noch feucht.
„Wer hat denn hier grad aufgewischt?“, fragt er mit Bedeutung.
„Aufgewischt? Ich.“
„In der Nacht?“
„Seit wann kümmert sich der Herr Gendarm um Weiberkram?“ Mit einem Blick überfliegt die Marie die Stube, nichts liegt herum. Keine Unsicherheit zeigen! „Sepp, zwischen uns beiden ist’s – denk ich – aus; zudem sechs Uhr früh ist nicht Zeit für Späßchen.“
Wachtmeister Wirrba scheint heute ausnahmsweise wirklich keine Lust zu Späßchen zu haben; er nimmt mit seiner tulpenförmigen Nase Witterung, stakst auf den mächtigen Ofen los, öffnet mit seinem Säbel dessen Tür und stochert eine halbverkohlte Mullbinde hervor, an deren unversehrtem Ende noch braunrote Flecke sichtbar sind … „Späßchen?!“
Mit einem heftigen Griff packt ihn die Bäuerin an der Brust, stößt ihn gegen die Wand und drückt ihn dort auf die Bank nieder. „Als mein Otto von den Turnerbrüdern abgestochen wurde, da warst du nicht mit deinem Bratspieß hinterher und hast nach Flecken gespürt!“
„Sei verständig, Marie“, keucht der Wirrba, ohne seine repräsentative Stellung wiederzugewinnen, da die Bäuerin den schweren asthmatischen Mann an der Schulter niederhält, „es sind die Nacht wieder welche über die Grenze!“
„Salz dir deine Grenze ein! Hier ist hier! Wie steht’s mit dem Gedenkstein?!“
Diese letzte Frage ist ein höchst peinlicher Punkt im Leben des Wachtmeisters; sie lastet noch schwerer auf ihm als das massive Gewicht der Marie. Sie hat dem Gendarmen gutgläubig die Ermittlung des Mörders ihres Sohnes anvertraut. An sich war das Wirrbas verdammte Pflicht und Amtsobliegenheit. Doch sie gab ihm zweihundert Kronen als besonderes Handgeld. Der Wachtmeister Josef Wirrba – wegen seiner zahlreichen galanten Abenteuer im Dorf auch „der keusche Josef“ genannt – hat diese Summe restlos für seine „speziellen Recherchen diesseits und jenseits der Grenze“ verbraucht. Vergebens. Den Mörder fand er nicht. Die Marie aber bohrte sich immer mehr in den Gedanken hinein, dass ihr Sohn weder umsonst gelebt habe, noch auch umsonst gestorben sei:
„Ein Gedenkstein, an dem niemand vorübergehen kann“, ein ganz besonderer Stein muss aufs Grab!
Die Täler und Felswege auf und ab rennt mit ihrer Hucke selbstgefertigter Holzlöffel und Geräte die rüstige Kleinbäuerin und Händlerin Marie Fink, die „Löffelmarie“; bei jedem kleinsten Steinmetzen spricht sie vor wegen einer Gedenkfigur für ihren Sohn; doch etwas Besonderes, „an dem niemand vorübergehen kann“, findet sie ebenso wenig wie der Wachtmeister. Der weiß ganz klar, was es sein müsste, eine Statue aus Stein oder Bronze, ein Arbeiter, der nach rückwärts gesunken ist, während ihm ein Dolch in der Brust steckt.
Wieder ist die Marie Feuer und Flamme, wieder gibt sie dem Grenzgendarmen einen Auftrag und eine Anzahlung.
Am gleichen Abend liegt der Wirrba sinnlos betrunken im „Adler“. Da also bleibt das Geld, da endet seine Arbeit!
Wie er in einer der nächsten Nächte leis an ihr Fenster klopft, lässt sie ihn ein wie vor Jahren; aber das robuste, wütende Bauernweib bedient ihn diesmal auf eine besondere Art; es springt mit dem beleibten und im Grunde wehrlosen Wachtmeister derart um, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Wie eine Löwin, die einen Stier niedergerissen hat, wirft sie ihn zu Boden und setzt ihm zu: „Betrüger! Saufaus! Jagt die Spargroschen einer Witwe durch die Gurgel, das Genick soll man ihm brechen, jeden Knochen einzeln!“
Eine ganze Woche muss der Wachtmeister daheim die Stube hüten, sein Gesicht gleicht einem verbeulten Kupferkessel, seine Arme und Beine kann er nur mühsam gebrauchen, nachdem ihn in jener Nacht „Schmuggler von rückwärts überfallen und fast erwürgt haben“.
So macht denn auch in dieser heutigen Februarnacht das dienstliche Auftreten des Grenzwachtmeisters Wirrba auf die Löffelmarie keinen überwältigenden Eindruck, obschon sie wegen des unbekannten Verwundeten in ihrem Haus sich nicht recht wohl fühlt.
„Bin schon sechs Jahre Wachtmeister“, schnauft der Gendarm und nestelt seinen Kragen zurecht, „man müsste mal einen wirklichen Fang tun …“
„Und am nächsten Tag Herr Oberwachtmeister sein …“
Es klopft.
Die Marie hält den Atem an. Fährt der Satan diese Nacht Schlitten? Oder der Stummel … musste er an der Grenze umkehren? Oder ein zweiter Flüchtling?
Draußen dämmert der Tag. Wirrba drückt sich geräuschlos am Tisch hoch und zieht seine Pistole aus dem Leder; er schiebt die Marie hinter sich. Seine Stunde ist da! Jetzt wird er zeigen, was ein Mann ist!
Erneutes Klopfen.
Und von draußen eine Stimme wie ein sich dehnendes Gummiband: „Bitte die verehrten Landsleute zu öffnen, wobei sie gewiss nicht bereuen werden, von einer ebenso dringlichen wie akuten Sache Kenntnis genommen zu haben!“
Der Gendarm hat in wilder Entschlossenheit die Tür aufgestoßen und mit einem Raubtierbändigergriff ein Individuum in die Stube gezerrt …
3. Noch einer von drüben
Das Individuum – ein etwa fünfunddreißigjähriger Mann, mit einem ungemein zufriedenen, ungemein vertrauenerweckenden Mondgesicht – verneigt sich mit ruhiger Würde. „Sehr angenehm, Herrn Oberwachtmeister persönlich zu treffen … Arno Elster, Vertreter der Hygienezentrale ,Aurora'“; er übergibt dem Gendarmen einen Pass und Gewerbeschein. „… wobei ich mir erlauben werde, die verehrten Herrschaften aufzufordern, in dieser ungetrübten Morgenstunde die neuesten hygienischen, kosmetischen, antiseptischen und sanitären Produkte für Mensch und Landwirtschaft einer gütigen Inspektion zu unterziehen, ohne dass hierbei weder ein Importaufschlag noch der geringste Kaufzwang seitens der geehrten Käufer vorherrschen.“
„Wo haben Sie übernachtet?“
„Im ,Adler', Herr Oberwachtmeister; indes endet für Arno Elster die Nacht mit dem ersten Morgenrot! Mit den Hühnern zu Bett, mit den Hühnern steh auf, so verdoppelst du deinen Lebenslauf! Die Stunde nach dem ersten Hahnenschrei erweist sich als das beste Sprungbrett in den Arbeitstag; sieht man übrigens auch bei unsrer Mutter hier, stramm und drall wie eine Dreißigerin, wäre bloß nicht das Reißen im Kreuz; habe ich recht, Mütterlein?“
„Ich brauche nichts!“, lehnt die Marie ab.
„Ich brauche nichts … das ist ein schnelles Wort, Mutter, ein übereiltes Wort. Sind wir ein Negerweib mit einer Muschelschnur um die schlanke Hüfte statt eines Kleides? Nein, das sind wir keineswegs! Weshalb aber tragen wir um den rechten Fuß einen doppelten Wollstrumpf? Aha! Habe ich’s erkannt?“
„Das Reißen im Bein …“
„Wer sprach vom Reißen? Herr Oberwachtmeister – die Regierung selbst ist Zeuge – wer sprach vom Reißen?“
„Sie sprachen vom Reißen im Kreuz! Immer bei der Wahrheit geblieben!“
„Richtig, Herr Oberwachtmeister, aber die Wahrheit sitzt tiefer, als das äußere Auge reicht. Wo beginnen die Nerven des Beins?“, flüstert der Dicke wie ein gefährliches Geheimnis. „Im Kreuz! Ausgezeichnet! Im Rückenmark! Das Rückenmark aber ist der Zentralpunkt des Körpers; ist das Mark gestört, so geraten auch die sympathischen Säfte des Unterleibs in Unordnung, es gibt Stauungen“ – er neigt sich zur Löffelmarie – „grade im Wechsel der Frau, das bedeutet diese chronischen Frauenleiden, das bedeutet Krampfadern an den Beinen …“
„Oje …“ Die Marie zuckt wie unter einem Dolchstoß zusammen und greift wie überführt nach ihrer von dunklen blauen Strängen durchzogenen Wade.
„… das bedeutet Aderbrüche, Salzfluss, Weißfluss, Muttersenkung, Eileiterinfiltration, innere und äußere Bauchbrüche, das bedeutet Geschwüre, Hämorrhoiden, Abszesse, das bedeutet den Krebs!“ Wie ein feuriges Schwert hat der mondgesichtige Vertreter des Hygienezentralhauses „Aurora“ diese apokalyptische Verdammungsliste über dem Haupt der Löffelmarie geschwungen. Die durchaus nicht zimperliche Bäuerin ist auf einen Stuhl gesunken; sie fragt fast flehentlich: „Und dagegen gibt es nichts?“
„Dagegen gibt es nichts? Wieder ein schnelles Wort, ein viel zu schnelles Wort, Mütterlein! Man muss jedoch den Feind von innen und von außen angreifen!“, verkündet der Vertreter der „Aurora“ und öffnet seinen Handkoffer, der wie bei einer großen Hausapotheke in zwei bis drei Dutzend Fächer mit Medikamenten und Mixturen eingeteilt ist. „Hier das grüne Nervenfluid, um von außen her die Säfte in Gang zu bringen, und als zweites ein Anticancroid, ein innerliches Gegenkrebsgift, ein Pulver aus den Drüsen der kreuzkopfförmigen afrikanischen Brillenschlange, der Na ja tricupidans.“
„Und das hilft?“
„Wie das Amen in der Kirche, wie Schnaps beim Hundebiss.“
„Bei Hundebiss ist nach unsrer medizinalgesetzlichen Verfügung …“, will der Wachtmeister sich aufspielen.
Aber Arno Elster holt, während er der Marie seine „Komplexkombination“ verabreicht, mühelos zum Schlag gegen den Gendarmen aus. „Herr Oberwachtmeister sollten bei dem degenerierenden Dienst bei Tag und Nacht, in Frost und Sonnenhitze wohl doch ein wenig auf die eigene Konstitution achten!“
„Stimmt“, haut die Löffelmarie in die gleiche Kerbe, „er plustert sich auf wie ein Kapaun; aber blas ihn mal an, und er fällt um wie ein hohler Pilz.“
„Was gar nicht so leicht zu nehmen ist, Mütterlein! Denn man achte bei Herrn Oberwachtmeister auf die stark erweiterten Hautporen, was auf eine mangelhafte Herzfunktion schließen lässt, wozu sich gesellt die Bläue um die Lippen als ein Zeichen der asthmatisch apoplektischen Lungenerweiterung und Nierenasthenie …“
„Geschwätz!“, stöhnt der Gendarm und nimmt sein Käppi.
„Schnaufst du nicht wie ’ne verrußte Lokomotive, wenn du bloß die Treppe hinauf musst!“, hält ihn die Marie.
Der Sanitätsvertreter hat ihn von der anderen Seite und klemmt munter und ungeniert seine Hand zwischen Koppel und Leib des Gewaltigen. „Mit Verlaub, Herr Oberwachtmeister, ist diese Leibesvölle wohl normal, muss sie nicht die Leber abdrücken? Bitte nicht den Leib einzuziehen! Ausatmen, mein Herr, bitte sehr, ich habe Zeit – sehen Sie, sehen Sie“, triumphiert er, „muss das nicht das arme Herz zusammenpressen?“
„Alles Faxen! Das Alter …“
„Aber, aber, Herr Oberwachtmeister! Ein Mann in Ihrer Positur! Das Alter ist kein Fixum, sondern eine Folge von Unkenntnissen! Voll schlummernder ungekannter Kräfte ist der Kosmos! Voll schlummernder Kräfte … ,Erwache, Adam!‘ gebiete ich, und Adam erwacht!“ Er hat einen seltsamen Apparat hervorgezogen, einen Gürtel, an dem eine Anzahl kleiner elektrischer Batterien befestigt sind, er hält dieses Wunder hoch wie eine Fackel, wie ein siegverheißendes Palladium.
„Kraftgürtel ENERGOS! Mit galvanischen Batterien versehen, über Nacht zu tragen, lädt im Schlaf den Körper mit neuer Lebensenergie, stärkt die Herztätigkeit, erfrischt Lunge und Hirn, erneut die Manneskraft, Sie werden jeden Konkurrenten im dienstlichen und privaten Leben …“ Er hat ein Plakat entfaltet: Ein rosiger Jüngling steht auf der azurnen Erdkugel, er ist mit „Energos“ umgürtet, gelbe Kraftblitze zucken von seinen Lenden.
„Das kann doch kein Mensch bezahlen“, knurrt der Gendarm und schaut wie gebannt auf das Plakat.
„Wir sind ein humanes Institut, deshalb gewähren wir Ratenzahlung, dreißig Reichsmark in fünf Raten; leider habe ich bloß dieses Modell heute mit.“ Der Menschenfreund packt den Wunderapparat wieder ein.
Der Wachtmeister Josef Wirrba gibt dem Vertreter der Hygienezentrale „Aurora“ seine Papiere zurück. „Für öffentliche Märkte und Vorträge brauchen Sie eine besondere Genehmigung, verstanden!“, schnauzt er, und dann leiser und begehrlich: „Dieses Zeug da, dieses elektrische Kraftzeug müsste man erst probieren, ob’s auch kein Schwindel ist?“
„Herrn Oberwachtmeister gern zu Diensten – als einer Amtsperson, die keinen Unberufenen heran lässt. Habe sowieso die Absicht, eine Woche hier zu weilen, um unserm Kundenkreis … nur diese Unterkünfte, als Mann der Hygiene, dieser Gasthof zum ,Adler‘ …“
„Was haben Sie gegen den ,Adler‘?“, verteidigt der Gendarm sein Stammlokal.
„Nicht das geringste, Herr Oberwachtmeister, nicht das allerminimalste! Bloß, wir Spezialisten der Hygiene, Sie verstehen, heute schläft in dem Hotelbett ein Herr Müller, morgen in dem gleichen Bett ein Herr Meier. Können Sie wissen, wie diese Herren Müller und Meier gesundheitlich beschaffen sind, bezüglich gewisser unappetitlicher Krankheiten? Können die Hotels ihre Betten täglich mit Lysol sterilisieren? Nein, das steht nicht zu erwarten! Wenn ich mich aber zum Beispiel hier umsehe in dem spiegelblanken Zimmer unsres Mütterleins …“
„Wir haben keine Zimmer frei“, sagt die Löffelmarie schnell.
„Ich hörte im ,Adler‘, es war hier ein Unglück.“
Die Bäuerin steht breit auf der Treppe.
„Da ich Ihnen den gleichen Preis zahle wie im ,Adler‘, wo es hier so wenig saubere Quartiere gibt …“
„Weshalb bleibt Ihr denn nicht in Deutschland!“, platzt die Marie heraus.
„Aber, aber, Mütterlein, was sind das für Begriffe? Christoph Kolumbus – wissen Sie, wer das war? Er stammte aus Genua in Italien, segelte auf einem spanischen Schiff, entdeckte Amerika und kehrt heute in dem deutschen Kolumbiatabak wieder nach Europa. Sehen Sie, Mütterlein, auch dieses Köfferchen …“, er schwingt es hoch, „ist solch ein Kolumbusschiff!“
„Ein Schiff?“
„Ein Kolumbusschiff! Denn es überquert diese heut so stürmischen Grenzen und verbindet in humaner Konnektion die Menschen der verschiedensten Länder; habe ich recht, Herr Oberwachtmeister?“
„Im Falle, dass die Zollbeträge …“
Ich muss doch bitten, Herr Oberwachtmeister, sind wir Kulturmenschen oder Bantuneger? Versteht sich eo ipso! Und grade in Anbetracht unsres Sanitätsgewerbes, welches den reinsten Dienst am Menschen und am Kunden verkörpert – wer kauft, ist unser Freund; wer nicht kauft, der wird nicht unser Feind – was aber einem Menschen Gutes du getan …“
Der Wachtmeister zerrt den Bandwurmredner aus der Stube.
Weshalb hat der Gendarm den Reisenden so plötzlich ins Freie befördert? In Wachtmeister Wirrba brodelt wegen des Kraftgürtels „Energos“ ein ganzer Hexenkessel düsterer und geheimnisvoller Fragen. Denn der Sanitätsmann Arno Elster berührte mit nachtwandlerischer Sicherheit Wirrbas wundesten Punkt. Der Wachtmeister ist ein Bauchhypochonder. Er hat die fixe Idee, dass sein Bauch von Tag zu Tag gefährlich anwächst. Jeden Abend, sowie er das Hemd ausgezogen, kontrolliert er mit einem metallenen Bandmaß seinen Leibesumfang. Da diese Kontrolle aber öfters verschiedene Ergebnisse zeitigt, hat der Wachtmeister Wirrba sich eine Art astronomischer Messung seiner Bauchkuppel ausgedacht: Auf dem einen Pfosten seines Bettes wird eine brennende Kerze befestigt; ihr gegenüber befindet sich in etwa fünfzig Zentimeter Distanz die weiße Kalkwand des Zimmers. Nun tritt der Gendarm allabendlich in untrüglicher Nacktheit im Profil zwischen Kerze und Wand stets genau auf einen vorgezeichneten Fleck der Diele und fährt mit dem Bleistift den Schatten nach, den sein Bauch an die Kalkmauer wirft. Trotz dieser astronomischen Methode stellen sich bei dem Grenzwachtmeister Wirrba immer wieder Schwankungen ein, die ihn aufs schwerste beunruhigen. Deshalb erscheint ihm Arno Elster wie ein Abgesandter des Himmels.
Auch die Löffelmarie ist durch den Vertreter der Hygienezentrale „Aurora“ völlig aufgewühlt. Jene pompösen fremden Worte schießen noch wie ein bengalisches Feuerwerk durch ihren Kopf. Sakra! Schon hat sie völlig vergessen, wann und wie oft man das afrikanische Schlangenkrebspulver nehmen soll. Wenn der Wirrba den Reisenden abschiebt über die Grenze und sie dann dasitzt mit all ihren Herrlichkeiten, mit den vielen Krankheiten und der geheimnisvollen Arznei?!
Sie reißt ihr Kopftuch vom Haken und rennt hinaus.
4. Ein Mensch soll erzählen …
Die Tür knallt ins Schloss.
Ein Schuss?
Hans springt auf, eine Blutwelle fährt durch seinen Kopf: Was wollen die Stimmen drunten und jetzt der Schuss?
Sie sind hinter ihm, mit ihren Wolfshunden, haben ihn aufgespürt, er greift einen Schemel, klappt sein Messer auf, sich den Weg zu bahnen …
Auf der Treppe stößt er auf die Loni; sie kann den Fiebernden kaum halten; er will übers Geländer, hinunter, hinaus, hier ist’s schrecklich, ringsherum stehen SA-Wachen mit Stahlruten und mächtigen Parabellumpistolen … schon ist er unten, sucht die Tür aufzureißen. Die Loni stemmt sich davor. „Bin ich denn SA? Sieh mich doch an! Komm doch zu dir!“
Sie führt ihn zum Fenster, zur Bank. „Sei doch ruhig, Mensch. Schau doch, wo du bist – bei Freunden; meinen Bruder haben die Banditen doch auch so gehetzt und dann erstochen, war grad so einer wie du.“
Wo die Mutter bloß ist?
Sie wagt den Mann nicht allein zu lassen, seine Stirn und Backenknochen sind rot vom Wundfieber; er schaut sie an mit ernsten misstrauischen Augen. Wenn er jetzt lossaust in Hemd und Hose, ins Dorf, alles ist dann verraten. Er muss doch die Sache vom Otto kennen, ihrem Bruder? Sie drückt den Mann sanft auf die Bank, legt seine Beine hoch, lehnt seinen Rücken gegen die Wand. Und dann sitzt sie neben ihm und beginnt zu erzählen, bloß dass er ruhig bleibt, von dem Bruder, was der für ein Mensch war, ein Studierter, eine ganze Bibliothek hat er sich zusammengespart. Sie holt zwischen Fenster und Ofen von einem selbstgezimmerten kleinen Bücherbrett einen Band.
„In den Büchern hat er abends nach der Arbeit gelesen, oft die ganze Nacht, und auch andern hat er sie geliehen.“
Hans nimmt das Buch – Bücher haben für ihn stets etwas Freundschaftliches –, aber er kann in der Dämmerung des Zimmers nichts klar erkennen. „Was steht darauf?“
Das Mädchen tritt mit dem Buch zum Fenster. Der Mann beobachtet ihr Gesicht, ein junges, breites, bäuerliches Gesicht mit glattem, rötlichbraunem Haar und starken Backenknochen; jetzt buchstabiert sie beim ersten Tagesschein: „Die Mutter, von Max–im Gor–ki.“
„Hast du’s selber schon gelesen?“, fragt der Mann.
„Nein.“
„Aber deinen Bruder hast du gut verstanden?“
„Ja.“
„Und gern gehabt?“
„Komisch fragst du.“
„Otto hieß er?“
„Otto. Und du?“
„Hans.“
„Wie noch?“
„Ist nicht wichtig.“
„Hast recht. Ich heiße Loni, die Mutter ist die Marie, die ,Löffelmarie‘, weil sie im Gebirg mit Holzlöffeln und Küchenzeug handelt; ich schaffe in der Weberei von Keller.“
Der Mann schaut nach draußen, auf die Bergkette im Norden, die noch immer wie ein schwarzer Wall gegen den sich rötenden Himmel ragt. Hat er denn gehört, was sie sagte? Sie stellt das Buch wieder an seinen Platz, tritt zum Ofen und setzt das Essen für den Abend in die Röhre. Jetzt kniet der Mensch am Fenster und späht hinaus. Sie lässt ein Messer fallen; er wendet sich: „Wohin geht die Chaussee?“ Und als könne er die Antwort nicht abwarten: „Zur Stadt?“
„Ja.“
„Und dort ist der Rossberg – die Grenze?“
„Die Grenze. Komm jetzt!“ Sie hat ihm eine große Tasse Kaffee hingestellt, auch Brot und Butter. Wieder trinkt er, mit gierigen Zügen; sie füllt ihm nach.
„Ist’s weit zum Bahnhof?“
Sie tritt zu ihm, er spürt den Hauch ihres Atems. „Bring uns nicht ins Unglück, du! Ich muss zur Arbeit; ich denke, du bist ein rechter und vernünftiger Mensch.“ Aber kann man mit einem Fiebernden, Verwundeten so reden, mit einem Menschen, der immerzu nach drüben schaut? Sie versteht, dass er noch etwas jenseits der Grenze zurückließ, in dem Land da drüben. Sie legt ihre Hand auf seinen Arm. „Hast du Frau und Kinder dort?“
„Nein.“
„Eltern?“
„Die Mutter.“
Wenn sie jetzt an der sich vergreifen? Wieder flammt der rote Zorn in ihm auf. Luft! Hinaus! Er springt auf. Verdammt, sein Bein! Er wird ganz grau vor Schmerz.
„Wohin? Hör mich doch, sei doch gut, du bist ja krank!“ In ihrer Verzweiflung hat die Loni ihn von hinten umfasst und schleppt den Sichsträubenden wieder zur Bank. Sie kniet neben ihm, seitlich des Fensters, und hält den Mann, dessen Kopf erschöpft und schwer an ihrer Schulter lehnt, von rückwärts in ihren Armen. Lässt sie ihn los, so macht er bestimmt eine Tollheit. Wenn nur die Mutter käme! Draußen in den Tälern schäumt der milchige Nebel und knäult sich an den Bergwänden zu kleinen Wolkenkugeln. Auch in dem Zimmer hängt wie eine Wolke die Schwermut und hilflose Traurigkeit der beiden.
Was für ein Mensch? Wenn man ihm nur helfen könnte! denkt das Mädchen.
Nie wird man zurück können, nie! denkt der Mann. Und dieser Gedanke liegt wie ein Berg auf ihm. Eine Ewigkeit ist’s schon her, seit dieser Nacht, seit er sein Land hinter sich ließ. Weiß man denn, ob man es jemals wiedersieht, das Land, wo man geboren wurde, wo man die ersten Worte sprach, für das man blutete, in dem man die erste Freundschaft schloss, die erste Liebe kostete, und in dem man zertreten wurde wie ein leeres Schneckenhaus? Nie wieder zurück können? Mit jeder Sekunde Trennung gewöhnst du dich an diese Tatsache, errichtest du selbst Stein auf Stein zur Mauer. Noch einmal reißt er sich los, steht jetzt auf der Bank, als wolle er mit einem einzigen Hechtsprung durchs Fenster.
Auch Loni ist hochgefahren, auch sie steht auf der Bank, vor ihm, in heller Angst. „Was soll ich denn tun, du? Komm doch zu dir, Hans! Ist denn wirklich so etwas Besonderes da drüben?“
Diese letzte Frage scheint der Mann verstanden zu haben. Er lächelt, als sei es ganz unmöglich, etwas derart Selbstverständliches überhaupt zu beantworten. Das Lächeln und Schweigen aber ist noch unheimlicher; seltsam auch, wie die beiden Menschen voreinander dastehn, auf der Bank, wie große Holzstatuen, die mit ihren Köpfen die Deckenbalken der Stube zu tragen scheinen. Das Mädchen sieht in das abgemagerte Gesicht des Mannes, über dessen Stirn ein Büschel hellen Haares klebt wie nasses, welkes Gras.
Vielleicht sollte er sprechen, nicht bloß sich in seine Hirngespinste verbohren? denkt sie, legt den Arm um seine Schulter und sagt ganz ruhig: „Komm, sei gut, erzähl mir etwas von da drüben; man hört soviel …“
„Wenig hört ihr!“, wehrt der Hans ab, als habe man ihn angegriffen und kniet auf das gesunde Bein, während er das verletzte langsam ausstreckt, „wenig wisst ihr … Dass man mit den Tränen, die dort vergossen werden, vielleicht einen Fluss füllen könnte oder meinetwegen einen Ozean, stimmt, ein schreckliches, finsteres, undurchsichtiges Land, stimmt, und auch ein sanftes Land, ein helles Land, ein buntes Land. Wo gibt’s im Frühling solche Wiesen mit gelben Himmelschlüsseln, blauen Natterzungen und rötlichem Klee, alles auf einem einzigen Fleck und gleich darüber in den riesigen Buchenhängen den braunen ,Frauenschuh‘, das weiße Geißblatt, das einen ganzen Wald durchduftet, und das feurige Laub des wilden Weins.“
„Und die Menschen?“
„Ja, die Menschen …“
5. Wie der Hund „Bär“ den Hans rettet
Plötzlich zuckt es wie eine Stichflamme in ihren Augen auf. „Weshalb wehrt ihr euch nicht? Heimzahlen müsst man’s ihnen, alles, dreifach!“
„Schade, dass wir dich nicht drüben hatten“, meint er, während seine Pupillen sich spöttisch verengen, „wär dann wohl öfters eine solide Holzerei geworden! Nun, wenn du einen starken, bissigen Hund trittst, wird dadurch der Hund anders?“
„Und wie wird er anders?“
„Stimmt, es gibt tollwütige Biester, bei denen hilft nur eins.“
„Und bei den zweibeinigen?“
„Sprechen wir erst mal von den vierbeinigen; denn grade so ein Hundevieh hat mal ’ne Rolle bei mir gespielt, und ohne diesen Hund wäre ich jetzt kaum hier.“
„Hat dich wohl über die Grenze gehetzt?“
„Langsam, Loni! – Das war noch in der halblegalen Zeit, 1932, mitten im Juli, während der Wahlkampagne. Ich hatte Landagitation. War da so ein bärenfinsteres Nest, blutarme Zwergbauern, unter ihnen ein kleiner Pächter ohne eine Krume eigenen Bodens, der alte Herbst. Sein Ältester, der Willi, hielt zu uns; der Jüngere, der Herbert, lief mit den Nazis. Willi, der grade einen Kursus mitgemacht hatte, begann natürlich daheim seinen Alten zu bearbeiten: Der Pachtherr, Graf Dohna, habe für sich allein dreißigtausend Hektar Land, er aber, der alte Herbst und noch zweitausend andere Pächter hätten nicht ein Ar.
,Also abgeben soll der Graf?‘, fragt jetzt der Herbert.
,Klar.‘
‚Klar? Du teilst also mit dem Grafen, und das andere hunderttausend Lumpenzeug, das auch wieder teilen will, das kommt dann zu dir: Mir die Hälfte, dir die Hälfte! Und das geht dann so weiter, immer feste geteilt, Vater, erst das Äckerchen, nimm dir, Sozi! Dann das Haus, nimm dir, Sozi! Schließlich bekommt dann der Sozi den Kopf deiner Kuh und du den Schwanz!'“
Loni packt den Hans. „Solchen Blödsinn hat man geglaubt?“
„Grade solchen Blödsinn: Mir die Hälfte, dir die Hälfte, mir den Kopf der Kuh, dir den Schwanz! Das war verdammt einfach. Als wir eines Abends zusammensaßen, der Willi und ich, und ein paar Grammophonplatten laufen ließen, ‚Brüder zur Sonne' und die ‚Dubinuschka', plötzlich – peng – haut ein Schuss durch die Wand.“
„Nazis?“
„Der alte Herbst. Er steht im Flur mit seinem Jagdgewehr: ,Raus mit den Roten!‘ Hinter ihm der Herbert, die Hand in der Hosentasche, da, wo die Nazis den Mauser tragen.“
„Und ihr?“
„Ich überleg eine Sekunde, ob ich den Schemel gegen den Jungen schleudern soll, denn der scheint der Gefährliche. Aber der Willi packt mich am Arm. ,Gehn wir!‘ Mit unheimlicher Ruhe sagt er das.“
„Sei still, bist ja ganz glühend!“ Sie hat von hinten ihre Hand auf seine Stirn gelegt.
„Dann gingen wir, ich langsam rückwärts, immer den Herbert im Auge; aber der Willi ging geradenwegs hinaus, nichts nahm er mit sich, nichts. Im Hof sprang der Hund, den wir wegen seines dicken Pelzes ,Bär‘ nannten, an Willi und mir hoch; Willi nahm zum Abschied seine Pfote. Als wir schon auf der Straße waren, heulte das Tier furchtbar auf, wir hörten grausame Schläge. ,Bist wohl auch ein Roter, du Biest!' Willi fuhr herum, jetzt zog ich ihn weg.“
„Sogar den Hund haben sie darum gehasst?“
„Aber der Hund hat uns geliebt.“
„Doch damit war’s jetzt aus?“
„Scheinbar. Der Willi ging nicht mehr heim; er arbeitete in der Expedition unserer Zeitung. Eines Tages musste ich wieder mit Flugblättern und Wahlmaterial auf die Dörfer. Ich nahm eine Genossin mit, wir gingen als ,Pärchen‘ mit Rucksack und Gitarre; das war harmlos.“
„Sie war deine Freundin?“
„Eine Genossin – ach du, damals war man Tag und Nacht auf Achse, ein Privatleben gab es nicht. Wie es dunkel wurde, setzten wir bei einem Dorf von zwei Seiten an, das Malen und Kleben flutschte nur so. Rings am Himmel waren Gewitter aufgezogen, die Straßen leer, immer wieder flammten Blitze durch die Nacht. Grad wie wir in der Dorfmitte uns treffen, hat man unsre Plakate bemerkt. Ein Höllentanz bricht los, mit ihren Hunden hetzen sie hinter uns her, wir klettern auf den ersten besten Holzschober. Draußen gießt es jetzt wie aus Eimern, wir liegen auf den grade nicht sehr weichen Holzscheiten, das Mädel und ich, schauen durch eine Ritze auf die Straße, die unter den Blitzen und dem klatschenden Regen wie Quecksilber funkelt, und fühlen uns eigentlich ganz wohl. Gleich unter uns jagen die Nazis mit ihren Wolfshunden vorbei. Rufe, Fluchen, hier und da ein Schuss, ziellos, nervös. Ein paar Stimmen scheinen immer wieder um unsern niederen Holzstall zu kreisen. Was ist das? Ein Befehl dicht an unserer Holzwand: ,Such, Bär, such!‘“
„Der junge Herbst mit seinem Hund?“
„Wenn der mit seinem SS-Sturm mich findet, dann brauche ich mir kein Erbbegräbnis mehr zu suchen. Mit einem wütenden Knurren springt plötzlich eine mächtige schwarze Masse über mich – der ,Bär‘; sein heißes Schnauben ist direkt über meinem Kopf, jetzt muss er anschlagen, neben mir fallen Holzscheite um, die Genossin will auf das Tier loshauen, ich flüstere: Rühr dich nicht! Still! Da spür ich, wie eine breite Hundezunge mir weich und liebevoll übers Gesicht fährt. ,Bär‘ hat mich erkannt. Gewiss, ich habe ihm ab und zu eine trockne Speckschwarte zugesteckt, er hat mich auch stets mit dem Willi gesehen … ich ziehe ihn schnell zu mir herunter, denn schon brüllt der Herbert: ,Bär! Wo ist das Biest?‘ Er will auf, aber ich halte ihn fest, streichle ihn. Schließlich entfernen sich die Stimmen; nur der Regen trommelt in der unsichtigen Nacht.“
Der Tagesschein fließt langsam in die Winkel der Stube. Das helle Holz der gefirnissten fichtenen Türen, Balken und Bohlen leuchtet warm und honigfarben.
„Mit Hunden hat man uns gehetzt“, sagt der Hans leise.
„Aber grad der ,Bär‘ hat dir geholfen.“
„Ja.“
„Und dich beinah verraten.“
„Verraten?“
„Als das Mädel aufsprang – die Genossin.“
„Weil sie mich verteidigen wollte.“
„Ob man zu so was überhaupt Mädels mitnehmen soll?“
„Unbedingt!“
„Denn entweder rennen wir weg oder wir schlagen zu, aus Furcht.“
„Nicht alle.“
„Wahrscheinlich gibt es da drüben in Deutschland ganz besondere!“ Das Blut schießt ihr zu Kopf vor Scham, vor Zorn, ja vor Feindschaft gegen den Mann, der soviel erlebt hat, eine dumpfe Feindschaft auch gegen die Mädels und Frauen, die soviel mitmachen da drüben an der Seite der Männer. „Wahrscheinlich sind die Mädels bei euch alle furchtbar klug, lesen viele solche Bücher wie die da“ – sie weist auf das kleine Büchergestell des Bruders – „und können ihren Freunden deshalb besonders viel helfen?“
„Stimmt!“
„Und dann kommt doch der Hitler zu euch, obwohl ihr und eure Mädels soviel wissen und soviel gelesen haben, und aus ist’s mit allem.“
„Genauso, wie’s mit der Sonne aus ist, wenn der Nebel vor ihr liegt“, sagt der Hans ruhig.
„Die Sonne hat jetzt schon fünf Jahre bei euch Zeit gehabt.“
„Und wenn sie doch dann durchbricht …“
„Das glaubst du?“
„Allerdings.“
„Weshalb bist du dann hier?“
Erschrocken hält sie inne. Die Fragen sausten wie der Steinschotter einer Moräne nieder, unaufhaltsam; aber die letzte Frage trifft den Flüchtling wie ein Felssplitter an der Schläfe: Weshalb bist du dann hier?
Er humpelt zur Tür, greift nach seiner Mütze.
Loni steht vor dem Ausgang, mit erschrockenen Augen. „Nein, du, hab das gar nicht gewollt, gar nicht gesagt, bleib, bleib, ist doch Wahnsinn, du musst doch bleiben!“ Sie hält ihn umklammert, zieht ihn zur Bank, hebt ihn darauf, sinkt vor ihm hin und drückt ihren Kopf in seinen Schoß, während ein stummes Weinen ihren kräftigen Körper schüttelt.
„Still, Loni, still!“
Er streicht ihr über die Haare, die straff sind wie eine Pferdemähne. „Klar, hast es nicht so gemeint.“
Er will ihren verweinten Kopf aufrichten, doch sie presst ihn gegen sein Bein, gegen die durchschossene Wade, dass er fast aufstöhnt. Und wie er noch den Schmerz verbeißt, hat sie plötzlich seinen Kopf umfasst und beginnt mit ihren Tränen und ihren Lippen seine Augen zu bedecken, seine Wangen, seinen Mund, und als dürfe er niemals mehr sie ansehn, die das getan, drückt sie seinen Kopf an ihre Brust. „Bleib hier, du, bleib, für meinen Bruder, für alles, was hier fehlt! Bleib hier, Hans, hab mir’s vom ersten Augenblick an gewünscht, als ich dich sah …“
Und nun blickt sie auf ihn mit großen, ernsten Augen, mit ihrem breiten, guten Gesicht, mit ihren festen Händen seinen Kopf dicht vor ihre Augen führend. „Bleibst du?“
Immer noch heult die Sirene der Textilfabrik.
Die Loni streicht vor dem Spiegel neben dem Bücherspind ihr Haar zurecht, bindet das Kopftuch darum und nimmt ihren Korb mit dem Essen und der Arbeitsschürze. „Hier ist noch Milch und Brot; die Mutter kommt bald, und ich bin abends zurück; bleib still, Hans, und lass die Vorhänge zu!“
Sie küsst ihn zart.
Einsam liegt die Stube.
Er hört ihren Schritt auf der Straße. Er schaut seitlich des Vorhangs hinaus: da geht sie mit weit ausholender, robuster Bewegung, doch mit den weichen Hüften einer Frau.
Aus dem grauen Nebel zwischen den niederen dunklen Baracken erheben sich die feuerroten Ziegelschornsteine und das schwarze Kesselhaus der Fabrik wie eine Festung vor dem grünen Morgenhimmel. Die Sonne hat den Nebel durchbrochen. Einzelne weißgraue Schwaden flüchten noch in die Schluchten der Berge.
Der Tag steht wie ein Held über der Erde.
Zweites Kapitel: EINSAMKEIT
6. Der „Miezekater“ wird überwunden
Die „Anlaufstelle“ für Flüchtlinge besteht aus zwei Räumen: dem fensterlosen Vorraum, in dem ständig eine grelle elektrische Birne mit weißem Milchglas brennt, und dem Zimmer des Sekretärs, dessen einziges Fenster auf die Brandmauer des Nachbarhauses schaut. Diese Örtlichkeit ist unauffällig und zweckentsprechend.
In dem fensterlosen Warteraum stehen an den Seiten drei Bänke, die Mitte nimmt ein Tisch ein mit zwei Stühlen; auf dem Tisch befinden sich einige zerlesene Zeitschriften und ein Schachbrett. An der Wand hängt eine nicht mehr ganz zeitgemäße Karte Europas, eine Aufforderung zum Beitritt in die Arbeiterhilfe, je ein sehr farbenfrohes Plakat für Mundhygiene und das stolz ein azurnes Meer durchfurchende Schiff des Triester Lloyd. Der Sinn dieser beiden letzteren Affichen – den offenbaren Reliquien eines früheren Raummieters – besteht wohl mehr in der Aufheiterung des Beschauers durch die kräftigen blauen, weißen und roten Farben, als in der Absicht, einen der politischen Emigranten zu einer Mittelmeerreise aufzufordern.
Auch Hans studiert von neuem die beiden Blickfänger. Er ist schon acht Wochen in der großen Stadt, er kommt zum regelmäßigen Empfang seiner Essbons und des kleinen Handgeldes; wichtiger aber, er hofft von Woche zu Woche auf eine auch noch so geringe Arbeit oder lieber noch auf einen Auftrag. Doch immer wieder heißt es: warten, nicht fragen, warten.
Neben ihm sitzt der Bertl, ein junger Gärtner aus Süddeutschland. Er trägt Knickerbocker, Sportstrümpfe und Schillerkragen; er hat sich in der Stadt schon leidlich eingerichtet, hilft auf dem Gemüsemarkt den Bäuerinnen, manchmal fällt auch am Bahnhof etwas ab. Jetzt sitzt er mit Hans vor dem Schachbrett, dessen Felder immer wieder mit Tintenstift nachgezogen werden; die Köpfe der Springer fehlen, einige Bauern sind durch Hosenknöpfe ersetzt. Wie viel Emigranten haben auf diesem Brett die Zeit und ihr undurchdringliches Schicksal zu vergessen gesucht!
„Bekommst du mal Nachricht von drüben?“, fragt der Bertl.
„Wenig.“ Der Hans zieht jetzt den Königsbauern.
„Ob sie noch an uns denken?“ Aber dieser igelhaarige, blonde Gärtner ist nicht geschaffen, Trübsal zu blasen. „Kennst du die ,Heidenlöcher‘, wo sich das Volk damals vor den Hunnen verbarg? Nur auf handbreiten Felsstapfen geht’s da hinauf, verwachsen ist alles mit Ginster und Schlehbüschen, mit den langen, harten Dornen; aber dann liegst du oben, direkt im Blauen, ganz nah an der Sonne, auf den heißen Felsplatten, alles kannst du da vergessen, Menschen, Partei, die ganze Welt … und mein Mädel, geschickt war die, schafft jedes heran: Beeren, Brennholz, Zweige, Laub, Wasser. Da droben war am Samstag und Sonntag unsere Heimat, und wenn es nachts kühl wurde unter dem Steinhang und den Zwergkiefern, dann nahm sie mich zu sich, Brüste hatte die, rund und voll wie ein Bauernweib, das war allein schon ein Zuhause, und dabei war sie ein erstklassiger Kumpel“, fügt er schnell hinzu; „denn während der Wahlkampagne gab’s auch das nicht mehr. Was die wohl drüben jetzt machen?“
Hans ist diesen Redeschwall des lebenslustigen Jungen gewohnt; er zieht schweigsam seine Figuren.
„Woran denkst du?“, fragt der Bertl. „Und deine, war sie rund oder schlank?“
„Mittel.“
„Blond oder dunkel?“
„Fuchsig.“
„Jetzt sag nur noch: Lila mit Streifen!“, knurrt der Igelhaarige gekränkt und schlägt mit seinem Läufer den Königsbauern. „Meine stenografierte zweihundert Silben die Minute; aber wenn Not am Mann war, warf sie einen Zentnerballen Zeitungen aufs Lastauto wie nichts.“
„Meine trägt auf der Schulter einen Sack Mehl ins Haus, mäht wie zwei Männer und arbeitet im Betrieb gleichzeitig an vier Webstühlen.“
„Hast du ein Foto von ihr?“
„Hatt eins.“
„Zeig’s!“
„Sie hat’s selbst zerrissen, weil sie da ein ganz klein bisschen schielt mit dem einen Aug; doch bloß, weil sie zu sehr seitlich in den Apparat schauen musst“, fügt er rechtfertigend hinzu; „ich mag das übrigens.“
Diese Duelle, bei denen die Flüchtlinge ihre Erlebnisse voreinander übersteigern, sind an der Tagesordnung. Der Rausch der Erinnerung ist in manchen Stunden zu mächtig.
„Wie heißt sie denn?“
„…Lisa.“
Hätte er den richtigen Namen nennen sollen?
„Hans Döll!“
Er springt auf und tritt in das Zimmer des Sekretärs der Flüchtlingshilfe. Drinnen an der Schreibmaschine sitzt nur der Miezekater, die technische Kraft; es ist ein mittelgroßer Mensch mit kurzem, grauem Haar, zwinkernden Augen und dem „Krawattenblick“, der in allen Lebenslagen ausschließlich auf die Krawatte seines Gegenübers gerichtet ist. Wohl wegen dieses undefinierbaren Wesens und seines nur aus wenigen drahtartigen Haaren bestehenden Bartes belegten die Flüchtlinge ihn mit dem Spitznamen „Miezekater“. Miezekater hinwiederum versteht es, den Emigranten die Bedeutung seines Amtes ständig klarzumachen. Obschon die meisten Registrierten schon zwanzigmal bei ihm erschienen sind, beginnt er jedes Mal von neuem: „Der Name? – Geburtsort? – Jahr? – In welchem Betrieb zuletzt? – Arbeitslos? – Weshalb?“
Der Emigrant hat zu antworten.
Aber stellt nun der Emigrant unter Herzklopfen die alte, ewige Frage: „Gibt’s was Neues für mich? Arbeit?“, so beginnt sich Miezekaters Bart förmlich zu sträuben ob dieser verwegenen Worte. „Man wird dir das schon mitteilen!“
Dennoch nimmt Hans heute allen Mut zusammen. „Hat man noch nicht geantwortet?“
Miezekater schaut mit vernichtendem Krawattenblick auf den vorwitzigen Frager. „Nein, man hat noch nicht geantwortet!“
Hans weiß natürlich genau, dass Dutzende fragwürdige Elemente von drüben hier eintreffen, dass man auch über einst gute Genossen Erkundigungen einholen muss; könnte man aber diesen Weg nicht doch beschleunigen? Hans hat an der Westfront das schreckliche Jahr 1918 mitgemacht, die Tankschlacht bei Arras, am Kemmelberg, er hat gegen die mörderischen Baltikumer im Ruhrgebiet 1920 seinen Mann gestanden, aber vor dem Schicksalsgespenst da an der Schreibmaschine beginnt sein Herz zu zittern. Hier ist etwas, gegen das man nicht kämpfen kann, etwas Unwirkliches, Unmenschliches, er möchte wegrennen; es lässt ihn nicht los. „Wenn man vielleicht noch mal anfragen könnte?“
„Weshalb bist du so unruhig? Weshalb?“
„Weshalb …“
„Du willst also nach Deutschland zurück?“, forscht der Miezekater.
„Kann man denn hier leben ohne euer Vertrauen, ohne Arbeit?“
„Schwere Zeiten.“ Der Graukopf reinigt mit einer Stecknadel die Tastatur der Schreibmaschine.
„Mörderische Zeiten dies Herumsitzen, Warten, Festsitzen.“
„Und doch kannst du dich hier mehr bewegen als deine Kameraden, die drüben im Bunker sitzen“, meint eine ruhige Stimme.
Hans fährt herum.
Willi, der Sekretär der Flüchtlingsstelle, ist eingetreten; er packt Hans an der Schulter. „Müssen alle ein bisschen Geduld haben, Kollege, findest du nicht?“
„Er kommt jeden zweiten Tag gerannt!“, faucht der Miezekater. „Sag ihm, dass es keinen Sinn hat, oder wenn es einen Sinn hat, dann keinen guten.“
„Wie meinst du das?“, wendet Hans sich gegen ihn.
„Du verstehst genau, was ich meine.“
Eine Blutwelle schießt in dem andern hoch: Für wen hält man ihn? Darf man einem Kameraden, der drüben an der Basis arbeitete und täglich sein Leben riskierte, mit diesem Misstrauen begegnen? Er nimmt alle Kraft zusammen, um nicht aufzuheulen in dieser bitteren Einsamkeit.
Er geht schnell zur Tür.
Willi steht dort. „Wir müssen doch vorsichtig sein, Hans“, sagt er leise, „aber auch du hast recht, wir müssen zugleich schneller arbeiten.“ Er sucht in seinen Rocktaschen und fischt ein blaues Billett hervor. „Wir werden uns für dich bemühen, Hans, auch um ein Quartier, wo du lesen kannst, heut sieh dir mal das an!“ Er gibt ihm das Billett. „Soll ein guter Film sein.“
„Und du?“
„Hab keine Zeit.“
Hans weiß, dass Willi jetzt schwindelt, aber er nimmt das Billett, ihn freut die Liebe des Genossen.
Wie Hans draußen ist, sagt der Sekretär zu dem Miezekater: „Hör sofort nochmals wegen ihm nach!“
„Es kann einfach noch nichts da sein!“
„Es kann einfach noch nichts da sein, und damit basta! So bist du! Ein richtiger Staatshämorrhoidarius! Mit Hornschwielen am Arsch!“, platzt der Willi jetzt los. „Aber, hast du keine Augen im Kopf, wie der Mensch da eben aussah, dem das Herz fast zersprang, und du Holzkopf hast keine Antwort als ,schwere Zeiten‘! Ist das eine Antwort?!“
7. Er flieht vor seinen Gedanken
Wieder vergeht für Hans eine Woche Warten, und nochmals eine Woche, und immer wieder ein „überflüssiger Mensch“ sein. Es sind warme, kristallhelle Maitage. Er möchte früh um sechs Uhr auf Arbeit, die Jacke herunterstreifen, an der Drehbank mit den schweren Schraubenschlüsseln sich über einen Motor oder ein Getriebe hermachen. Einmal rennt er im Dauerlauf durch einen menschenleeren Park; aber da pfeift ein Parkwärter, es pfeift gleich ein zweiter und dritter.
Man verlangt seine Papiere.
Er geht an den Flusskai, sieht neidisch, wie die Transporter die schweren Fässer vom Dampfer über die Stege rollen; am Ende des Rollstegs ist ein Absatz, dort kippen die Tonnen aufs Pflaster und nehmen eine falsche Richtung. Hans stellt sich an diesen Platz und beginnt gelegentlich ein und das andre Fass zu dirigieren. Da keiner es ihm verwehrt, zieht er seine Jacke aus und steht als Zwischenmann in der Kette; er gibt zuerst den Fässern nur einen schüchternen Stoß, dann rollt er sie ein Stück. Die Arbeiter sind es gewohnt, dass die Erwerbslosen „nicht zusehen können“, sondern endlich wieder einmal anpacken. Plötzlich wird Hans am Hosenbund hochgerissen. „Was machen Sie denn hier? Wer hat Sie hier angestellt?!“
Hans sieht in das rote Gesicht des „Boss“; jede Antwort wäre hier dumm und sinnlos.
„Was Sie auf dem Arbeitsplatz suchen?! Ihre Papiere!!“
Er und Papiere! „Verzeihen Sie!“, sagt er und streift die Jacke wieder an. Aber der Boss zerrt ihn wie einen Haufen Lumpen nach vorn. „Lassen Sie sich nicht wieder hier sehn, Sie Strolch! Das nächste Mal landen Sie auf dem Polizeirevier!“
Ein überflüssiger Mensch.
Er flieht vor seinen Gedanken, muss von dieser Erbitterung loskommen: Wozu hat er gelebt, an sich gearbeitet, sich gebildet, gelesen, für die Sache gekämpft? Wozu das alles? Ein Blatt am Baum hat es besser.
Ein Menschengesicht fällt ihm auf, das gute runde Gesicht einer jungen Frau, sie trägt einen Marktkorb am Arm; er möchte das Gesicht noch einmal sehen, sich umdrehen; aber er bezwingt sich, er will nicht zurückblicken, nicht zurückdenken, in keinem Fall, auch nicht an sie. Ach, diese grauen Märzwochen an der Grenze waren wie ein Glück über der Erde, wie ein unwirklicher Traum. Und als die Apriltage mit der ersten weißen Sonne begannen, als die Loni vor dem Weg zur Fabrik im Schutz der Hauswand und der Scheune ihm ein bequemes Lager richtete, da er den ganzen Tag in der lichten Luft lesen und ruhen konnte, mit dem Rücken gleichsam gelehnt an seine Berge und an das Land, aus dem er kam. Und wenn dann abends ihre Schritte wie energische Hämmer draußen auf dem Backsteinweg klopften und er oben in der Kammer sie erwartete … kaum nahm sie sich Zeit, das Kopftuch abzulegen, so schnell zog sie ihn an sich, durstig, erhitzt von der Arbeit, dem hastigen Weg und von Liebe, sie presste ihn gegen die Wand der Kammer, als wolle sie ihn nie wieder aus ihren Armen lassen. Sinnlos daran zu denken. Nie wieder hatte sie geschrieben oder eine Botschaft geschickt. Schnell lieben die Mädels in ihrer harten Arbeit, schnell vergessen sie. Was konnte sie von ihm erhoffen? Er konnte nicht an der Grenze leben, und sie war an die Grenze gebunden, an ihre Arbeit, an den kleinen Bauernhof. Das ist im Grunde ganz einfach.
Aber gerade diese quälende Erinnerung kehrte mit der Regelmäßigkeit eines Uhrpendels immer wieder. Nie war das so. Auch das Herumstehen und Warten. Überall stehst du im Wege, stehst du daneben.
Auch jetzt in der billigen „Sportwelt“ unten am Fluss. Grelle Azetylenlampen werfen ihr Licht auf das Dutzend kleiner Automatenroulettes, in denen winzige Blechpferdchen „rennen“ und Aeroplane einen Alpenflug vollführen. Ein federnder Griff am Auslöser, und die Kugel saust in die Rinne, schlägt einen Kontakt, lässt hier ein blaues, dort ein rotes oder grünes Lämpchen aufflammen: über dem Montblanc, der Jungfrau, dem Monte Rosa, und das bedeutet 40, 20 oder 10 Punkte. Seltsam, wie man stundenlang diesem Spiel zuschauen kann! Da sind Lastträger, die eine Kiste wie einen Schulranzen auf die Schulter nehmen; sie haben die Taschen voll loser, klimpernder Münze, sie reißen den Griff einszwei und lassen die Kugel wie einen Blitz durch die Röhren und Ringe sausen, warten gar nicht das Resultat ab, sondern werfen schon eine zweite und dritte Münze in den Automaten zum Abzug, ein Mordsspaß, wenn drei Kugeln gleichzeitig durch die Glücksröhren jagen! Wieder andere „zielen“, sie können höchstens drei- bis viermal setzen. Eine dritte Gruppe kiebitzt. Dort hat man nicht die kleinste Münze im Sack, aber dafür gibt man Ratschläge. „Wer spielt hier, du oder ich?“, dreht sich der Spieler um, und der Habenichts verstummt.
Es kommen auch Mädels mit ihren Kavalieren; der Tipp dieser Huldinnen, schlanker und stämmiger, in grellfarbigen Jumpers besteht darin, dass sie den Griff gegen die Kugel schnellen, ohne überhaupt hinzusehen, während sie über zwei Automaten hinweg sich mit einer Freundin unterhalten.
„Könntest einem unglücklichen Vater auch mal ’nen Nickel spendieren!“, zwinkert ein verwitterter abgerissener Kiebitz.
„Bitte sehr!“, bläst ihm das Mädel den Zigarettendampf ins Gesicht und schießt, mit ihrem Kavalier schwatzend, die Kugel mitten in die komplizierte Gabel des Montblanc, also in den höchsten Gewinn. Der „unglückliche Vater“ heimst die Münzen ein, dankt mit einer tiefen Verbeugung der Fee und beginnt an einem andern System.
„Berufsspieler! Betrüger!“, brüllt es jetzt in der Mitte der Halle. Der Geschäftsführer hat ein Häufchen Mensch in seinen Fäusten. „Das Schwein hat einen Trick!“
„Kein Trick!“, windet sich ein kleiner Angestellter wie ein Korkenzieher in den gewaltigen Kofferträgerhänden des andern, „bloß Training, Herr Direktor … bloß trainiert.“
„Ich werde dich trainieren, du Bandit!“
„Ich kann das allen Herrschaften hier beibringen!“
„Wäre ganz interessant“, kommt es jetzt aus dem Publikum, „weiterspielen, loslassen!“
Aber der Geschäftsführer trägt sein Opfer schon zum Hinterraum; plötzlich brüllt er auf: „Das Biest beißt! Warte, mein Jungchen!“ Er schleudert ihn wie eine junge Katze über die Theke und schlägt ihm mit seinen Kindsmörderhänden mitten ins Gesicht, dass sofort das Blut aus den Lippen spritzt. Man will dazwischen. Aber der Bulle gibt einigen Stammgästen ein Zeichen. Hans sieht mitten im Gedränge, wie eine fleischige Faust mit einem großen Schlüssel immer wieder auf den Kopf des schon halb ohnmächtigen jungen Menschen niedersaust.
Draußen an dem Geländer des Kais kniet der Verprügelte, sich an einem der Stahlpflöcke haltend, die von den Ankertrossen der schweren Flusskähne umwickelt sind. Seinen Körper schüttelt immer wieder ein Krampf. Weint er? Will er sich in den Fluss gleiten lassen? Hans eilt zu ihm; er sieht, wie der junge Glücksschütze sich erbricht nach diesen furchtbaren Schlägen auf seinen Schädel.
„Willst du heim? Komm!“, hebt Hans seinen Kopf.
Der junge Mensch schaut ihn aus totenblassem Gesicht an, stemmt mit letzter Kraft seine schleimverklebte Hand gegen des Fremden Gesicht, rafft sich auf und stolpert davon.
8. Er befragt das Schicksal
Es ist schlimmer als im Krieg, wo selbst die feindlichen Verwundeten dankbar waren, wenn man ihnen den Kopf hielt. Die Furcht voreinander, das Misstrauen zwischen Mensch und Mensch macht jeden vor dem andern zum Pestkranken. „Scheintot im Massengrab“ hieß es Anno 1917; heute laufen die Scheintoten am helllichten Tag durch die Straßen.
Hans schaut über das Geländer in den dunklen Strom … ein schwarz-grünes seidenes Tuch, das man um sich schlagen könnte. Betrachte aus einer Entfernung von zweitausend Jahren diesen heutigen Moment, wer darf Einspruch erheben, wenn du dieses tote Leben abschüttelst? Deine Arbeit? Bitte, welche Arbeit? Die Partei? Sie wird einen nutzlosen Emigranten los sein.
Unten am Stadtgraben braust das Wehr. Ein Flussarm ist über die fünf bis sechs Meter hohen Zementterrassen geleitet. Eine Motorenstation. Hans rennt den schmalen Saumpfad am Ufer entlang. In einer leeren Kanalisationsröhre entkleidet er sich. Soll das Leben selbst entscheiden! Gewiss, es ist völlig unsinnig. Sein ganzes Denken sträubt sich dagegen. Aber er sucht eine Antwort, endlich eine Antwort auf all die unbeantworteten Fragen, diese „direkte Antwort“.
Ob genügend Wasser in dem Gefälle? Man sieht nur die Wolken schäumender Flocken, die alles verhüllen … und die Kanten der Zementterrassen, die ihm den Schädel zerschmettern werden? Aber darin besteht ja die Frage. Mit einem mächtigen Sprung wirft er sich in den brausenden Schaum.
Wie in einer Halle ist das, mit gewaltigen Blasinstrumenten und Pauken; es donnert, schmettert, zinkt und klingt von den Wänden, und gar nicht dunkel ist’s, das blitzt und spritzt in spitzen und langen Lichtern in den Saal, und mitten in dem Orchesterlärm wird es plötzlich so still wie im Hochgebirge, nur ein einziger hoher, leise giemender Ton: du gleitest in rasender Talfahrt mit den Skiern über eine dünne Decke Neuschnee, nichts dazutun, nur weich in den Knien federn, und zugleich siehst du sehr alte Erinnerungen, wie die Großmutter dir etwas vorsang, auf einer Treppenstufe saß sie und schälte Apfelschnitz, die Linden dufteten …was half es dir? Wozu hast du überhaupt gegessen? Es war am Ende doch alles sinnlos.
Jetzt schluckst du zum ersten Mal Wasser, man möchte husten, es ist nicht angenehm, aber du hast gelesen, beim zweiten- und dritten Mal verliert man das Bewusstsein, alles ist dann leicht und schmerzlos, ja, darauf kommt es an, nur darauf. Du hast in irgendwelchen Büchern einmal bei einem Antiquar geschmökert, darin stand, die altindischen Spiele begannen regelmäßig mit dem Spruch des Ansagers: „Alle irdischen Wesen mögen ohne Schmerzen sein!“ Das klingt wie ein Gebet. Weshalb betest du eigentlich nicht?
Au! Ein Stoß! Woher?
Da der Mund zum zweiten Mal Wasser schnappt, stoßen Arme und Beine sich wild von dem Unterstrom ab. Wie aus einer gewaltigen, schwarzblauen Höhle fällst du nach oben, graue Schaumflocken ringeln sich auf der schon wieder blanken Fläche, weit ab braust leise das Wehr. Du lebst. Und selbsttätig, ohne deinen Willen, rudern Beine und Arme zum Ufer.
Mit wunden Füßen kehrt Hans zur Kanalröhre zurück und zu seinen Kleidern; fast einen Kilometer muss er nackt über das steinige Uferpfädchen laufen. Wie er das Hemd überstreift, kann er seinen Arm kaum heben; unter der rechten Achsel tropft Blut. Dass es überhaupt so abging! Er setzt sich auf den Boden der mannshohen Zementröhre und schaut genau wie vor zwanzig Minuten in die Schaumflocken des Stroms. „Da hast du deine Antwort!“, meint er und lächelt. „Und weshalb bist du jetzt kein überflüssiger Mensch?“
Einsam fühlt er sich, einsam und leicht.
Bei dem nächsten Besuch der Flüchtlingshilfe zieht ihn Willi lebhaft zum Fenster. „Hans, Mensch, Glückspilz, ich hab was für dich!“
„Von drüben?!“
„Halb so wild! Sei froh, wenn du hier was findest!“
Hans sieht enttäuscht vor sich hin.
„Es ist eine interessante Arbeit, bei einem Doktor, einem Kinderarzt, er sympathisiert mit uns, will einen etwas gebildeten Menschen, der sich auch auf Technik versteht, eine Art Laboratoriumsgehilfen, fein, was?“
„Fein“, sagt Hans und gibt sich Mühe, ein möglichst frohes Gesicht zu zeigen, „die Hauptsache ist doch: endlich wieder Arbeit, nicht wahr?“
9. Dr. Pöntsch und das Grundphänomen
Das Haus des Dr. Pöntsch liegt am Rande des Parks. Es ist ein lang gestreckter heller Flachbau, an den sich im Winkel die kleine Privatklinik des Kinderarztes anschließt. Hans tritt durch den Vorgarten. Die ansteigenden Wege sind mit breiten Granitquadern ausgelegt, an den Seiten stehen hohe Zierstauden, japanische Johannisbeeren, Schwertlilien, Päonien, Stockrosen; dort erhebt sich ein Steingärtchen mit seltenen Moosen, mit Zwergkiefern, Arnika, Rhododendron. Das Haus selbst – ein länglicher heller Kubus – ist wie in einen sauberen, weißen Arztmantel gekleidet.
In der Sprechstunde warten zehn bis fünfzehn Mütter mit ihren Säuglingen und Halbwüchsigen, eine Geruchsorgie wie im Raubtierhaus des Zoo. Es riecht nach Leben, nach Milch, nach Windeln. Eine zweijährige, dickbäuchige, kleine Rotznase betrachtet das Bein von Hans als Kletterstange; schon sitzt sie oben und kräht triumphierend zur Mutter. „Der Onkel will dich nicht!“, sagt die junge Frau beleidigt, da Hans nicht sogleich die Geschicklichkeit des Wunderkindes rühmt. „Entschuldigen Sie!“ Und mit kämpferischer Ironie nimmt sie den sich sträubenden Balg von dem Schoß des Unwürdigen, nicht ohne vorher mit dem nackten Kinderpopo über das hilflose Gesicht des „Onkels“ versehentlich hinwegzufegen. Ein unbändiges Gelächter der Frauenkorona begleitet diesen Sieg der Mitschwester über den männlichen Eindringling.
In diesem Augenblick öffnet sich die Tür des Arztzimmers. Dort steht ein vierschrötiger, kahlköpfiger Koloss im kurzärmeligen Mantel, mit hellbrauner Wachstuchschürze, in seinen behaarten Armen hält er ein dickes, nacktes Baby, das heißt, er balanciert es wie einen großen rosigen Apfel auf der rechten Hand, während seine Linke die Brust des Säuglings gegen sein Ohr presst. „Vielleicht haben die Damen die Güte, ihren Stimmorganen etwas Ruhe zu gönnen?“, meint Doktor Pöntsch, ohne seine Auskultation zu unterbrechen; er nickt Hans, der ihm offenbar gemeldet ist, zu, und gegen den Hintern des Kleinen mit seiner gewaltigen Flosse plätschernd: „Ein bisschen Geduld, nichts Besonderes!“
Nachher sitzt Hans in dem von Metall und Glas spiegelnden Sprechzimmer; es ist hell wie in einem Aquarium. Der Doktor hinter dem Tisch beobachtet ihn aus pfiffigen, aber gutmütigen Augenschlitzen, die in der glänzenden Gesichtsmasse wie Messerschnitte in einem mächtigen, kugelrunden Edamer Käse wirken. „Bin im Bilde, nichts Besonderes, wir werden das schon einrichten …“, und des Hans Schlosserhände bemerkend: „Sie verstehen etwas von Motoren?“
„Etwas.“
„Auch Elektrotechnik?“
„Wenig.“
„Werden wir gleich haben.“
Der Zweizentnerberg schiebt sich durch den Raum zu einem völlig abgedunkelten Nebenkabinett. Er knipst das Licht an und zeigt Hans in einem Gewirr von Solluxlampen, Röntgenröhren, Blaulichtapparaten und bestrahlten Milchflaschenbatterien einen Kontakt, der nicht schaltet. „Nichts Besonderes, schauen Sie nach!“, schnauft der asthmatische Riese.
Hans fühlt sich nicht recht behaglich in dem Kabinett; aber dann schraubt er die Dose ab, findet sofort den durchgebrannten Kupferfaden, lockert mit dem Messer die eine Schraube, wickelt den Fadenrest ab und verbindet ihn mit der Leitung. Nach zehn Minuten kommt der Doktor, er knipst, eine mächtige Blaulampe flammt auf. „Na sehen Sie mal!“, blinzelt er. „Weshalb denn so kleinmütig?“
„Nichts Besonderes!“, erwidert Hans wie ein Echo.
Einen Augenblick sieht der Doktor sein Gegenüber prüfend an, ob der sich über ihn belustige; dann zieht er ihn wieder in das helle Sprechzimmer. „Es ist gut, dass Sie aus Ihrer Emigration keine große Sache machen, auch nicht aus Ihrer Handfertigkeit, so ist’s richtig … in nichts steckt etwas Besonderes, bloß die Menschen möchten das, sie blähen sich auf, ganz Kehlkopf und Heldenbrust, das beginnt schon bei den Säuglingen … bevor so eine Handvoll einen einfachen Schrei ausstößt, wirft das sich vorher richtig in Pose … Zeitlupenaufnahme: Schnauben, Augenrollen, genau beobachten, ob der Große auch erschrickt, und dann erst trompetet das los, als gälte es eine Festung zu erstürmen oder eine Wahlrede zu halten … haben Sie einmal die Heldenpose eines Säuglings beobachtet? Sehr lehrreich!“
Hans schaut offenbar recht hilflos drein bei diesen Reflexionen des Kinderarztes.
„Ich möchte Ihnen zu erklären versuchen, weshalb ich Sie bei mir aufnehme und weshalb mir die meisten eurer offiziellen Deutschen so ungenießbar sind“, fährt der Doktor fort; „da ist zum Beispiel euer Oberhäuptling, ein Musterexemplar, ganz Kehlkopf, die Bürste unter der Nase ist der Akzent zu dem Lautsprecher darunter, sogar die Haarlocke weist auf die kostbare Mündung, alles andere in dem Menschen aber ist hohl, muss einfach hohl sein, schon wegen der besseren Resonanz. Und nun legen Sie dem Imperator einen Löffelstiel in den geöffneten Mund und lassen ihn ,A‘ sagen, beobachten Sie ihn jetzt, er ist ein Nichts“, er fegt mit dem Handrücken über den Tisch, „,Nil mirari!“, sagt ein Sprichwort: ,Über nichts sich wundern!‘ Denn es gibt nichts Besonderes.“
Soll er – Hans – darauf antworten? Widersprechen? Dass der Mensch sogar weniger sein kann als ein Nichts?
„Wir werden uns verstehen“, meint der weiße Koloss, der ihn nicht aus den Augen lässt; er drückt auf einen der Knöpfe unter der Tischplatte. „Ein Mensch, der in die Welt kommt, muss wissen, dass alles Schein ist, dass es nichts Besonderes geben kann; dann wird er lebensfähig sein, leicht und unverwundbar wie die Luft. Verzeihen Sie, ich erzähle das sogar meinen Halbjährigen, wenn sie mit ihrem Hinterteil auf meinem Handteller sitzen.“
Die Tür hat sich geöffnet; ein kleiner Mann, der infolge seiner laufwarzenartigen Beine und des mächtigen Kopfes einem trippelnden Champagnerpfropfen ähnelt, geht, ohne Hans zu beachten, auf den Doktor zu.
„Unser neuer Hausgenosse“, stellt dieser Hans dem gnomenartigen Wesen vor. „Hans heißt er, Hans.“
„Hans Döll.“
„Bohle Fränkel Stundenmädchen“, vollendet der Champagnerpfropfen seinerseits den feierlichen Akt.
Bohle führt nach erhaltener Instruktion den neuen Laboratoriumsgehilfen in sein Zimmer: ein kleiner, sauberer Kubus mit zwei Betten an der Hinterwand, einem herabklappbaren Wandtisch und einem flachen, breiten Fenster auf den Garten.
„Da liegst du!“, weist Bohle auf ein noch unbezogenes Bett. „Und hier liegt Erich, der Gärtner!“
Hans scheint das alles wie ein Traum, dieses gepflegte, helle Zimmer, der Beginn wirklicher Arbeit, Menschen, die einem auf Fragen eine brauchbare Antwort geben.
„Bettzeug bekommst du noch“, sagte Bohle, wie eine Hausfrau sich gleichsam entschuldigend, „Bohle Fränkel Stundenmädchen“, er spricht das wie einen Namen, etwa wie Paul Schulze, „Bohle Fränkel Stundenmädchen ist selbst einmal so hereingeschneit.“ Damit rumpelte der Gnom aus dem Zimmer.
Die nächsten Tage stürzt sich Hans mit einem wahren Heißhunger auf die neue Arbeit. Er hält die Ordinationsräume und das Bestrahlungskabinett instand, macht sich über die Kartothek des Doktors und beginnt die Abschrift einiger Krankenjournale auf der Schreibmaschine. Gut, dass er in der Parteiarbeit manches so nebenher noch lernte! Abends müssen die Röntgenplatten entwickelt werden. Hierbei kommt es zwischen dem Arzt und seinem neuen Gehilfen oft zu seltsamen Gesprächen.
„Arbeiten Sie gern hier?“, fragt der Doktor.
„Gewiss …“
„Das ist gut“, tönt es aus dem Dunkel, „vergessen Sie, was war! Wir glauben oft, dies oder jenes ist wichtig; aber nichts ist wichtig, als dass man vergisst.“
Stumme Arbeit.
Dann spricht es ruhig: „Man kennt eigentlich Deutschland nicht, wenn man bloß so durchfährt oder ein paar Wochen in den Städten lebt.“
„Nein, man kennt es nicht!“, ergänzt Hans lebhaft.
„Sie meinen, es gibt noch viel dort kennenzulernen?“
„Sehr viel, man hat manches übersehen.“
„Aha, das alte Lied!“, brummt der Koloss. „Die alte Liebe! Aber ist nicht auch etwas anderes da, was Sie bereits wieder übersehen? Die Erinnerungen, die an Ihnen kleben, die Ihr Leben und Denken verunreinigen? Nie werden Sie sich davon befreien können, dass Sie mit den braunen Gesellen, die Ihre besten Kameraden ermordeten, noch tausend Rechnungen begleichen müssen. Nein, in denselben Strom kann man nicht zweimal steigen; es ist nicht dasselbe Wasser!“
„Aber Sie selbst fingen doch von Deutschland an?“
„Gewiss, das ist so wie eine Totenhand, die der Regen immer wieder aus dem Boden wäscht, das alles klingt konträr; aber alles, was ist, ist nur durch sein Gegenteil.“
„Und unser Wille?“
„Grade der.“
„Dann müsste man ja grade das Gegenteil tun von dem, was man will?“, sucht Hans den Unsichtbaren in sein Selbstmatt zu drängen.
„Richtig! Es tritt fast immer das Gegenteil von dem ein, was man erwartet und will; das ist sozusagen ein Grundphänomen.“
10. Ein Pfand muss man auslösen!
Solche Gespräche werden oft geführt. Es scheint kein Zweck damit verbunden. Nur, dass der dickblütige Riese im Arztmantel in dieser Reibung an dem nervengespannten Flüchtling seine eigene Depression entlädt. Es lebt sich nicht schlecht in diesem Zwielicht der Schwermut, in diesem sauberen, geordneten Haus. Droben in seinem Zimmer sitzt Hans, liest und schaut auf die abendlichen Bäume des Gartens. Sein Mitbewohner, Erich, ein achtzehnjähriger, hochgeschossener Junge, kommt meist erst spät. In diesen ersten Sommertagen fahren der Doktor und die Gnädige oft in ihr Landhaus, das dreißig Kilometer südlich der Stadt am Flusse liegt. Es ist ein alter Besitz mit einem großen Weinberg, der mehr und mehr in einen Obst- und Sträuchergarten verwandelt wird. Eines Abends ordnet der Doktor an, dass Hans draußen mithelfen soll; er selbst ist behindert. Hans sitzt vorn neben Erich. Bei einer Steigung setzt die Zündung aus. Die Kerzen sind verrußt, werden ausgewechselt; aber nach fünf Minuten steht der Wagen wieder.
„Was ist denn los, Erich?“
„Die Zündung, gnädige Frau.“
„Nun?“ Sie selbst gibt Gas, aber der Motor bockt. „Sieh doch, welche Kerze noch Strom hat?“
Erich hat den Zündkerzenprüfer zu Hause gelassen.
„Nimm die Finger! Er hat Angst! Ist das ein Chauffeur?“, wendet sie sich zu Hans.