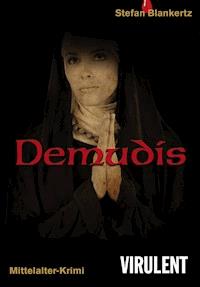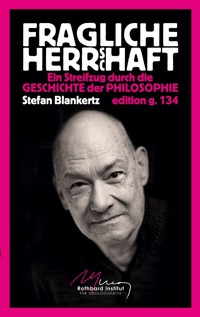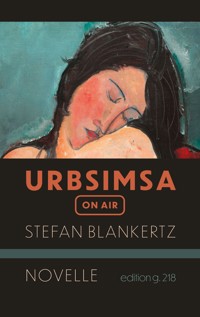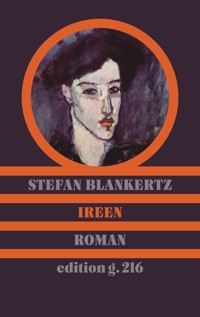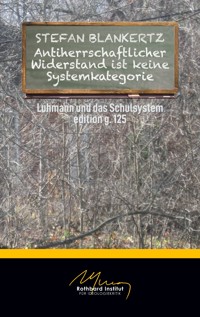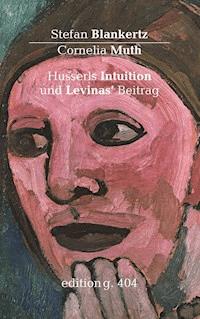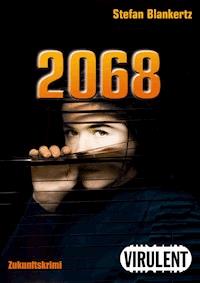
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zukunftkrimis
- Sprache: Deutsch
Ein Zukunfts-Roman in der besten Orwell-Tradition "Butter, Zigs und Vigs" Butter, Zigaretten und Viagra – das sind die begehrtesten Waren unter den Alten. Doch nur illegal können sie erworben werden. Denn das Gesundheitsministerium ist allmächtig und übt eine engmaschige Kontrolle aus. Wir schreiben das Jahr 2068. Und das vereinigte Europa hat sich mit China gegen Amerika verbündet. Nachdem der "graue Edgar", einer der unangepassten Alten, bei einer Operation stirbt, wird seine junge Geliebte zur Leitfigur des Widerstandes. Aber sie gerät zwischen die Fronten, als sie versucht, die mysteriösen Umstände von Edgars Tod aufzudecken. Eine beklemmend realistisch gezeichnete Zukunftsvision, lebendige Figuren und ein spannender Fall voll abgründiger Gefühle präsentiert Stefan Blankertz, der seine Erzählkunst schon in einer Serie eindrucksvoller Mittelalter-Krimis bewiesen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Blankertz
2068
Ein Zukunftskrimi
IMPRESSUM
Virulent ist ein Imprintwww.facebook.de/virulenz
ABW Wissenschaftsverlag GmbHAltensteinstraße 4214195 BerlinDeutschland
www.abw-verlag.de
© E-Book: 2014 ABW Wissenschaftsverlag GmbH
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-86474-090-9
Produced in Germany
E-Book-Produktion: ABW Wissenschaftsverlag mit bookformer, BerlinUmschlaggestaltung: brandnewdesign, HamburgTitelabbildung: istockphoto (Syldavia)
P110084
«Es gibt kein richtiges Leben im falschen.»Theodor W. Adorno 1968
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorbemerkung
1. Wir haben nichts zu verlieren als das Leben
2. Jung bis zum Tod
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Ruhe in Frieden
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Bilder einer Ausstellung
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Grün wie die Hoffnung
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Trau keiner unter 100
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. «Sie werden uns alle umbringen!»
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Von Harry. Mit Butter
Anhang: Kleines Chineutsch-Lexikon
VORBEMERKUNG
Sprache ist lebendig. Besonders nach der Großen Chinesischen Wende sind Anglizismen ausgemerzt worden. Stattdessen haben chinesische Lehnworte - «Chineutsch» genannt - Einzug gehalten. Zum besseren Verständnis finden heutige Leser im Anhang ein kleines Chineutsch-Lexikon.
1. WIR HABEN NICHTS ZU VERLIEREN ALS DAS LEBEN
Die Nachricht von Edgars Tod traf mich am Donnerstag, den 10. Mai 2068 um sieben Minuten nach elf Uhr. Die letzten Ausläufer des Frühjahrssturms rappelten laut in den Rollokästen der Fenster. Die Rollos hatte ich, soweit ich mich erinnern konnte, noch nie heruntergelassen. Sie waren meiner Meinung nach völlig überflüssig, genauso wie die Tatsache, dass ich jetzt über eine solche Nebensächlichkeit nachdachte. Beine trugen irgendeinen Körper im Zimmer hin und her, Füße stampften auf irgendeinen Boden, Fäuste ballten sich, bis sogar die abgekautesten Nägel irgendwelche Handflächen blutig gekratzt hatten. Was gehörte noch zu mir? Die Nägel? Die Handflächen? Das Blut? Befand ich mich weiterhin in der Welt? Offenbar ja, denn der Nebel im Hirn bestand aus einer Zusammenballung betäubter körperlicher Empfindungen. Unbestimmt fühlte sich das an, als sei ich es. Allem und jedem schwor ich Rache. Wen gab es, gegen den ich mich wenden konnte, wenn nicht gegen Gott und das Schicksal, das Er mir zugedacht zu haben schien? An Gott zu denken, entsprach allerdings nicht der vom Gesundheitsministerium empfohlenen rechten Verfahrensweise. Ich schrie hysterisch. Niemand antwortete. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Wer sonst hätte mir Aufmerksamkeit schenken können? Der Mensch, der mir in den letzten zwei Monaten am meisten auf der Welt bedeutet hatte, war nicht mehr. Noch einmal schrie ich. Ich wünschte mir Aufmerksamkeit und fürchtete zugleich, jemand würde kommen und mich in meinem beklagenswerten Zustand sehen. Wer sollte Verständnis für mich haben? Ein paar Mal schlug ich den Kopf gegen die Wand. Edgar ist tot! «Wir haben nichts zu verlieren als das Leben», hatte er immer gesagt, wenn es darum ging, ein Risiko auf sich zu nehmen. Und wir alle hatten dann böse aufgelacht, denn jedes Risiko galt der herrschenden Meinung zufolge als zu groß. «Risiko lohnt nicht», lautete schließlich die vom Gesundheitsministerium verbreitete Lehre. Ich betrauerte unseren leichtfertigen Hohn, der grässlich in meinem schmerzenden Schädel nachhallte. Nun war es so weit gekommen. Edgar ist tot! Er starb aber nicht als Held oder Märtyrer, wie er es sich vielleicht gewünscht hätte, sondern bei einer läppischen Operation. Edgar ist tot!
Um mich zu beruhigen, fingerte ich nach den «American Spirit»-Zigaretten, die ich mit Edgar so oft als Provokation in der Öffentlichkeit geraucht hatte. Mir quollen Tränen aus den Augen, als mich der Gedanke streifte, dass er es gemocht hätte, wenn ich mir auf seinen Tod eine anstecken würde. Erbost musste ich feststellen, dass das Päckchen leer war. Ich zerknüllte es und warf es auf den Boden. Es kullerte ein Stück weit unters Bett. Ich ließ es dort liegen. Sollte meine Mutter es doch finden! Sollte sie es doch wissen! War mir doch scheißegal! Ein Schauer schüttelte mich bei der vulgären Wortwahl. Es hatte nach wie vor den Zauber des Verbotenen, daran zu denken, wie Edgar sich ausdrückte. Aber Edgar war jetzt tot.
Als ich die Schmerzen und die Sturzflut von Gedanken nicht mehr aushielt, ging ich ins Bad, stellte mich auf die Zehenspitzen und nahm die Schachtel mit den Jaosinns aus dem obersten Regal des Arzneischranks. Ich schüttete mir eine der rosa Pillen auf die Handfläche, nahm sie in den Mund und spuckte sie sogleich verächtlich wieder aus. Edgar hätte das nicht gutgeheißen. Man reguliert seinen inneren Zustand nicht mit Chemie, lautete seine Überzeugung. Probleme mit Chemie zu bekämpfen, stellte in seinen Augen die verhasste Verfahrensweise dar. Mein Zwanjang am Handgelenk meldete psychische Überlastung und riet mir tatsächlich, es zunächst mit Jaosinn zu probieren und bei anhaltenden Beschwerden den zuständigen Psychologen aufzusuchen. Wütend drückte ich den Steuerknopf, um das Gequäke verstummen zu lassen, obwohl ich wusste, dass es sich unweigerlich wieder melden würde, wenn ich nicht tat, was mir fürsorglich empfohlen wurde. Sollte ich mir von der seelenlosen Verfahrensweise tatsächlich vorschreiben lassen, wie ich mit meiner Trauer umzugehen hatte? Bevor es wenigstens vorübergehend verstummte, teilte mir das Zwanjang noch gefühllos mit, dass ich für meine Uneinsichtigkeit einen Bing-Strafpunkt erhalten würde. Schließlich ertrug ich den Druck im Kopf nicht mehr, klaubte die rosa Jaosinn-Pille wieder vom Boden auf, befreite sie vom Staub, zerbiss sie und schluckte eine Hälfte. Das Zwanjang registrierte die Einnahme der heilversprechenden Chemie und erließ mir meiner Jugend wegen den Bing-Strafpunkt.
Das Jaosinn tat seine Wirkung. Mein Geist klarte auf. Da ich bloß die halbe Dosis Chemie genommen hatte, arbeitete die andere Hälfte meines Gehirns aber nach wie vor auf natürliche Weise. Ich betätigte das Zwanjang, um zuerst Ji und dann Mao anzurufen. Egal, was sie gerade taten, sie müssten alles stehen und liegen lassen und augenblicklich zu mir in die Piusstraße kommen.
Offenbar hatte ich überzeugend gewirkt, denn wenig später trafen sie ein, gemeinsam. Sie waren also zusammen gewesen. Das interessierte mich im Moment nicht weiter. (Falsch! Es interessierte mich; ich wollte es bloß nicht bemerken.) Sie wischten sich den Regen aus den Gesichtern, während ich ihnen eröffnete, dass Edgar bei der Operation gestorben sei. Ihre Bewegungen froren ein.
«Sie haben ihn umgebracht!» Mao artikulierte diesen entsetzlichen Verdacht, fast ohne seine schmalen, blau angelaufenen Lippen zu bewegen.
«Den Tod hat er nicht gefürchtet», sagte ich tapfer in seinem Geiste. Ich fragte nicht, wen Mao mit «sie» meinte. Der Vorwurf schien zu ungeheuerlich, um wahr sein zu dürfen. «Aber die ökologisch korrekte Verbrennung des ‹giftigen menschlichen Sondermülls› und das einheitsreligiöse Pseudobegräbnis verabscheute er. Er wollte eine richtige Beerdigung, also katholisch.»
Mao verzog den Mund. Er war Atheist und damit der herrschenden Verfahrensweise näher, als er zugeben wollte.
Ich hatte den Eindruck, dass auch Mao kurz vor einem inneren Zusammenbruch stand. Der graue Edgar war schließlich der Mittelpunkt auch seines Lebens gewesen, obwohl in einer ganz anderen Hinsicht. Weil sein Zwanjang nichts sagte, vermutete ich, dass er es manipuliert und illegal abgestellt hatte. Ich wunderte mich, dass Mao für seine Verhältnisse ungewöhnlich gut rasiert war, verweilte jedoch nicht lange bei dieser Beobachtung.
«Wie sollen wir das hinkriegen?», fragte Ji mit weit aufgerissenen, nassen Augen.
«Wir stehlen den Leichnam aus dem Bingdalu», erklärte ich. In Wahrheit hatte ich keinen Plan, sondern bloß den unumstößlichen Entschluss, Edgars letzten Wunsch zu erfüllen. «Auch wenn das nicht ganz leicht sein wird.»
«Und dann?» Ji wurde richtig böse und sprach vernünftig, als sei sie meine Mutter. «Sollen wir uns etwa mit einer Leiche in ein Taxi setzen, zur nächstbesten Ödfläche fahren und ihn dort verbuddeln? Wie stellst du dir das denn vor?»
«Könnte problematisch werden, weil du dein Zwanjang zipi hast. Es wird auf den Kontakt mit der Leiche ansprechen und ist nicht ausschaltbar.»
Ji hielt mir den linken Arm hin. Damit ich sehen konnte, was sie mir zeigen wollte, musste sie sich etwas zur mir hinunterbeugen, denn sie war fast zwei Köpfe größer als ich. An ihrem Arm prangte ein ebenso altmodisches Zwanjang wie Maos und meins. Sie hatte also ihr Implantat entfernen lassen und war jetzt ebenfalls in der Lage, ihr Zwanjang wie wir anderen ruhigzustellen. Dieses Hindernis war demnach abgehakt; trotzdem brachte uns das nicht sehr viel weiter. Ratlos schauten Ji und ich uns an. Auf einmal kam Leben in Mao.
«Wir treten als Kontrollärzterat auf, verlangen, den ... ähm ... Leichnam von Edgar obduzieren zu dürfen, und sagen einfach, es gäbe Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei seinem Tod, was ja auch durchaus wahrscheinlich ist. Dann packen wir ihn irgendwo rein und verschwinden. Wir fahren zum Melatenpark, das ist angemessen, auch wenn er seit Langem nur noch als Erholungspark dient. Immerhin war er früher mal ein Friedhof gewesen. Dort suchen wir einen geeigneten Flecken. Das wird nicht weiter auffallen.»
Ji sah Mao skeptisch an. «Werden Ärzte beim Betreten des Bingdalus nicht per Zwanjang identifiziert?»
«Ja, Darling», bestätigte Mao knapp. Er schien diese Schwierigkeit schon irgendwie gelöst zu haben. «Wir melden uns ganz normal an, als Besucher, die zu einem Kranken wollen ...»
«Zu welchem?», fragte ich.
Mao war ungehalten. «Lasst mich das machen. Ich muss ein bisschen zwanjangnieren und besorge die Klamotten. Schafft ihr beide einen Popen herbei. Wir treffen uns dann vor dem Uni-Bingdalu.»
Türschlagend verließ er die Wohnung. Ji schaute ihm nicht weniger verwundert nach als ich. Wir sagten zunächst nichts.
«Zwanjangnierst du mit Martin?», bat ich Ji. «Ich bringe das nicht fertig.»
Martin wohnte im legendären «1. Freien Altenkonvent», den Edgar gegründet hatte und dessen unangefochtener Anführer er gewesen war, auch wenn man dort keine formelle Hierarchie anerkannte. Martin spielte elektrische Violine in der Musikgruppe des Konvents, war jedoch früher einmal evangelischer Pastor gewesen. Er hatte nach der Großen Chinesischen Wende die Zwangsvereinigung zum alle Weltreligionen vertretenden Gesamtethischen Rat im Vatikan abgelehnt und war seines Amtes enthoben worden, während die Päpste seitdem im meiguischen Exil residierten. Ein katholischer Geistlicher, der in Frage gekommen wäre, fiel mir auf die Schnelle nicht ein. Edgar und Martin waren gute Freunde gewesen, sodass ich annahm, Edgar hätte nichts dagegen einzuwenden gehabt, von Martin unter die Erde gebracht zu werden, solange die mysteriöse «Auferstehung des Fleisches» nicht gefährdet wäre.
«Wissen es die Freunde schon?», fragte Ji beklommen.
«Nehme ich an», antwortete ich und erschrak über die distanzierte Sachlichkeit, zu der ich schon wieder fähig war. Verfluchtes Jaosinn! «Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich mit niemandem sonst gesprochen habe, seitdem ich vom Uni-Bingdalu informiert wurde.»
Meine Güte, wie kalt sich das anhörte - «informiert wurde». Ich biss mir so fest auf die Unterlippe, dass es heftig schmerzte, um nicht ungehemmt drauflosheulen zu müssen. Edgar war tot!
Erst vor ungefähr zwei Monaten hatte es begonnen. Bilder des legendären Konzerts in der Gereons-Kirche, als ich zum ersten Mal mit Edgar und den Schangsen zusammengetroffen war, erschienen mir wie lebendig vor dem inneren Auge.
2. JUNG BIS ZUM TOD
Dass etwas in der Luft lag, war zuerst in mein Bewusstsein getreten, als ich nach den Semesterferien am 8. März 2068 in die Donnerstagsvorlesung zur Einführung in die Preziologie von Professor Freund gekommen war. Wir alle verehrten Herrn Professor Andreas Freund, weil er einen überlegenen Geist mit menschlicher Wärme zu verbinden verstand. Behutsam unterstützte er uns dabei, die Wertelehre der rechten Verfahrensweise - die Preziologie eben - zu erkunden. Insgeheim wünschte ich mir nichts sehnlicher, als so zu werden wie er. In meinen kühnsten Träumen sah ich mich als seine Nachfolgerin.
Schon der Morgen hatte verquer begonnen. Wieder mal musste ich mich mit kaltem Wasser waschen. Die nachhaltige zentrale Wärmeversorgung war nämlich erneut ausgefallen. Wie immer scheiterte ich daran, mein langes Kraushaar zu bändigen. Ich streifte das blaue Uniformkleid der Studenten über und warf dann beim Frühstück vorsorglich eine braune Jaocao-Pille ein. Schließlich wusste ich, dass auch Mao Schmidt an Professor Freunds Vorlesung teilnehmen würde. Mao, der letztes Semester das Sinnfu gehabt hatte, in China an der Uni von Beijing Gaststudent sein zu dürfen, war, auf gut Chineutsch gesagt, sehr susching. Sehr, sehr susching. Um meiner ungebührlichen Lust Herrin zu werden, hatte ich also Jaocao genommen. Das galt als die angemessene Verfahrensweise. An jenem denkwürdigen Tag blieb ich aber trotz Chemie aufgekratzt, und mein Herz schlug merklich. Nachdem ich einige Schlucke Kaffee getrunken hatte, meldete sich das lästige Zwanjang an meinem Handgelenk.
Meine Eltern weigerten sich, mir ein Zipi-Zwanjang zu spendieren und dessen Implantation in die linke Handfläche zu erlauben. Damals ärgerte mich das. Ein unter die Haut implantiertes Zipi-Zwanjang war viel andingiger. Man musste nach dem Einkaufen nichts weiter tun, als an der Kassierstation vorbeizustolzieren, den Arm locker zu schlenkern, Daumen und kleinen Finger aneinanderzudrücken und damit die Abbuchung vom Guthaben zu bestätigen. Um das altmodische Zwanjang freizulegen, war es nötig, den Ärmel umständlich hochzuschieben, es an die Schnittstelle zu halten, die Summe durch Knopfdruck zu bestätigen und die Zahlung mit einem weiteren Knopfdruck auszulösen. Und dann erst die winzig kleine Bildfläche, auf der selbst junge Augen wie meine kaum etwas entziffern konnten! Das Zipi-Zwanjang erzeugte ein grellbuntes virtuelles Feld, das allein durch Gedankenkraft fast beliebig groß gestaltet werden konnte, je nachdem, wie es die darzustellenden Nachrichten erforderten. Ich ahnte nicht, dass ich schon bald meinen Eltern dankbar sein sollte, diesen neuerlichen Auswuchs der Überwachung nicht zu dulden, obwohl sie die Große Chinesische Wende kurz nach meiner Geburt vor zwanzig Jahren ohne erkennbaren Widerstand mitgemacht hatten und sich im Ganzen unauffällig verhielten.
Mein Handgelenks-Zwanjang regte sich also und empfahl mir mit seiner unpersönlich blechernen Stimme, wegen meines Blutdrucks auf weitere Zufuhr von Koffein zu verzichten. Morgens konnte ich die Ermahnungen des Zwanjangs am wenigsten ertragen. Erbost quittierte ich das Piepsen, indem ich den Steuerungsknopf drückte und damit zu erkennen gab, dass ich verstanden hatte. Eigensinnig trank ich weiter. Das Zwanjang teilte mir umgehend mit, dafür würde ich einen Bing-Strafpunkt erhalten. Mein Konto betrug damit, wie das Zwanjang ungerührt verkündete, gegenwärtig 173 Strafpunkte. Da erst bei 250.000 Strafpunkten «Bingo» war, also die Entmündigung drohte, machte ich mir wie die meisten meiner Freundinnen noch keine allzu großen Sorgen darum. Es war andingig, nicht allzu sehr auf die Strafpunkte des Bing-Kontos Acht zu geben. Das stellte keinen bewussten Widerstand dar, sondern bloß die normale jugendliche Unbekümmertheit.
Gleichgültig ließ ich die Nachrichten, die meine Mutter eingeschaltet hatte, an mir vorbeirauschen und nahm kaum auf, dass es im Baskenland wieder zu verlustreichen Kämpfen zwischen regulären chinesisch-europäischen Verbänden und der von den Meiguren unterstützten aufständischen sogenannten «Altenbrigade» gekommen war. Die «Altenbrigade» war völlig fenbing. Ich kannte niemanden, der auch nur annähernd verstand, worum es diesen durchgedrehten Terroristen ging. Sie setzten sogar hinterhältige Laser-Waffen aus Meigu ein, die die Menschen auf barbarische Weise verschmoren ließen.
«Keine Butter da?», maulte ich meine Mutter an - in der Zeit vor Edgar redete (und dachte!) ich tatsächlich noch so pubertär. Wenn schon nicht Mao, wollte ich wenigstens Butter haben. Man gönnte sich ja sonst nichts. Professor Freund fand es übrigens ziemlich unethisch, wenn wir solche abgedroschenen Reklamesprüche aus sinnfulicherweise längst vergangenen Zeiten im Alltag verwendeten. Aber immerhin konnte das Zwanjang keine Gedanken lesen, und die Gedanken waren weiterhin frei.
«Ach, Penelope», seufzte meine Mutter. «Ich muss doch schon auf mein Bing-Konto aufpassen. Oder willst du eine so früh entmündigte Mutter haben, die du dann im Zanfeidalu besuchen kommen musst?»
«Nee», grummelte ich trotzig, während ich das Butterbrot ohne Butter mampfte. Ungewollt rutschte mir heraus: «Lieber Mao haben.»
Meine Mutter nahm meine Hand und schaute mich ernst an. «Du hast ja erzählt, der Junge ist aus China zurück. Schlag ihn dir doch aus dem Kopf! Ein junges Mädchen wie du sollte eine geregelte Sexualität haben, das ist weisching, wie man auf Chineutsch heute sagt, sich aber nicht in Leidenschaft verzehren, das ist nun wirklich bing. Soll ich mal mit Doktor Müller reden? Er könnte dir sicherlich helfen. Es ist überhaupt nicht weisching, ständig dieses Jaocao zu schlucken.»
«Schmier dir diesen blöden Doktor Müller doch in die ergrauten Haare!», fauchte ich, ärgerlich auf mich selbst, dass ich das Thema überhaupt angeschnitten hatte. «Und kauf Butter auf mein Bing-Konto.»
«Dir sollte bekannt sein, dass das nicht die rechte Verfahrensweise ist.» Die Stimme meiner Mutter hatte nun einen leicht gereizten Klang. «Seitdem du vor zwei Jahren mit deiner Volljährigkeit vom Ortskomitee des Gesundheitsministeriums wegen deines Körpermasseindexes von mehr als 25 zur Übergewichtigen erklärt worden bist, kann ich dir keine Butter mehr besorgen. Willst du nicht endlich kapieren, was es heißt, dass auch mit Jaofan dein Appetit nicht zu zügeln ist?»
«Halt die Klappe, und nimm mein Zwanjang», knurrte ich dümmlich, obwohl ich natürlich wusste, dass es an ihrem Handgelenk nicht funktionieren würde. So von vorgestern, dass es genetisch nah verwandte Personen nicht unterscheiden konnte, war mein Zwanjang nun auch wieder nicht. Und sie hatte ja eigentlich recht: Die orangefarbenen Jaofan-Pillen, mit denen sich die schädliche Esssucht im Normalfall kontrollieren ließ, halfen bei mir nicht. Die Ursache dafür gab den Ärzten unsinnfulicherweise ein Rätsel auf. Gegen meine eigene bessere Einsicht setzte ich vorwurfsvoll hinzu: «Dann ist es wenigstens zu was nütze, dass ich es nicht zipi-implantiert bekommen darf.»
Meine Mutter erhob sich mit einem unwilligen Ruck. «Du bist undankbar, Penelope! Dein Vater und ich sind oft bis an die Grenze der rechten Verfahrensweise gegangen, um dir deine Wünsche zu erfüllen, so weit, dass manchmal nicht viel gefehlt hätte und uns vom Amt die Erziehungsberechtigung aberkannt worden wäre. Wenn es dir schlecht ging und wir dich haben fernsehen oder am Diannao spielen lassen, anstatt dir Chemie zu geben, wie es die rechte Verfahrensweise gewesen wäre, haben wir einiges riskiert. Verstehst du? Riskiert! Obwohl ‹es das Risiko nicht lohnt›, wie man so sagt. Aber wir fanden, dass es sich für dich lohnen würde. Wir haben dabei die Grenze nie überschritten und dir die Einweisung in ein Zanfeidalu erspart. Mach uns das Leben bitte nicht schwerer als nötig.»
«Steinalt wie ihr will ich schon gar nicht werden!» Ich war aufgebracht. Meine Mutter hatte über die Jahre etliche Eingriffe an Gesicht und Körper vornehmen lassen, um ihr jugendliches Aussehen zu erhalten. Inzwischen war allerdings auch die fortschrittlichste plastische Chirurgie ziemlich am Ende, was sie betraf. Dieses Jahr würde sie ohnehin fünfzig werden, und dann bezahlte das Gesundheitsministerium die Operationen sowieso nicht mehr. Mein Vater verfügte sicherlich nicht über genügend Guthaben, um es ihr zu ermöglichen, in China, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, eine private Behandlung durchführen zu lassen. Warum also weiterleben?
Heute Morgen war meine Laune schlicht grässlich. Wieder einmal war ich an dem Punkt, wo ich mich selbst nicht ausstehen konnte.
«Der Sinn des Lebens ist das Leben.» Meine Mutter drehte sich weg. Ihr musste bewusst gewesen sein, dass sie eine dieser Leerformeln unkritisch wiederholte, die die Doktor Müllers, das Gesundheitsministerium und die anderen Vertreter der rechten Verfahrensweise immer benutzten. Ich sah, wie sie sich einen Ruck gab und mich wieder anschaute. Ihr Ausdruck war hart. Mit gefährlich drohendem Unterton fragte sie: «Soll ich Doktor Müller einschalten und ihm sagen, du hättest Selbstmordgedanken?»
Das brachte mich auf den Boden der Tatsachen zurück wie eine kräftige Dosis intelligenzförderndes Jaoschild. Wenn schon das Zwanjang keine Gedanken lesen konnte, so doch meine Mutter. Mir wurde wieder schmerzlich bewusst, wie demütigend es für den menschlichen Geist war, dass die von ihm ersonnene Technologie ihm immer noch unterlegen war, wie Professor Freund manchmal mit einem feinem Lächeln vorbrachte - fast möchte ich sage: mit einem ironischen Lächeln; Ironie allerdings verabscheute er, zumindest theoretisch betrachtet.
«Das würdest du tun?», fragte ich wütend, bekam jedoch keine Antwort. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Zwangsbehandlung wegen Suizidgefahr. Das bedeutete einen Aufenthalt im Zanfeidalu von unbestimmter Länge. Hastig warf ich meinen für die Jahreszeit viel zu warmen Wintermantel über und steckte meinen klobigen Elektrobuch-Bildschirm ein, den man brauchte, wenn man über kein Zipi-Zwanjang verfügte, und machte mich auf den Weg.
3. KAPITEL
Beim Verlassen des Hauses grüßte ich still die steinernen Löwenköpfe über dem Eingang und den Fenstern des Erdgeschosses, wie ich es mir als eine Art Ritual zur Gewohnheit gemacht hatte; ein privatistisches Ritual, also laut Professor Freund gesellschaftsfeindlich! Auf dem Weg zur Venloer Straße, auf der sich die Bushaltestelle befand, kam ich an der tristen schmutzig-grauen Mauer vorbei, auf die ein Schmierfink mit leuchtend grüner Farbe «Young Until I Die» gesprüht hatte. Jemand, der sich besser mit der unguten Meigu-Sprache auskannte, hatte mir gesagt, dass dies so viel hieße wie: «Jung bis zum Tod». Was für ein herrlicher Gedanke! Warum aber musste er im barbarischen Idiom des menschenverachtenden Feindes formuliert werden?, hatte ich mich damals gefragt. Es gab trotz aller Anstrengungen des Gesundheitsministeriums noch viele ewig Gestrige, klagte ich in mich hinein.
An der zugigen Bushaltestelle warteten zwei Mädchen, die ich von früher kannte. Sie trugen noch die grauen Schuluniformen, weil sie den Abschluss nicht geschafft hatten. Ich war nicht zur Unterhaltung aufgelegt, darum vermied ich den Blickkontakt. Ich zog den Mantelkragen fester ums Gesicht und schaute die Straße rechts und links hinunter. Meine Mutter erinnerte sich noch daran, dass hier früher ein andauerndes Gewühle geherrscht hatte. Ein türkisches Geschäft hatte sich neben dem anderen befunden, darunter auch der schmuddelige Lebensmittelladen ihrer Eltern. Doch seitdem die Türkei Mitglied im Vereinigten Alleuropa war, konnten auch die türkischstämmigen Mitbürger effektiver an der gesundheitsgefährdenden Selbstausbeutung gehindert werden, und ihre Weischingheit hatte deutlich zugenommen. Nicht auszudenken, wie steinalt Oma und Opa heute aussehen würden, wenn sie gezwungen gewesen wären, weiterzuarbeiten. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich nicht so um mich hätten kümmern können. Immerhin hatte es bei ihnen immer genug Butter für mich gegeben, bis für sie Bingo gewesen war und sie keine mehr kaufen konnten. Seitdem waren harte Zeiten des Verzichts für mich angebrochen. Reden wir nicht mehr davon. Meine Großeltern jedenfalls wurden langsam etwas lästig. Wenn ich mit ihnen zum Altenspielplatz im Reich-der-Mitte-Park weiter oben ging, wollten sie sich meist nicht mehr lieb an den physiologisch optimierten Geräten ertüchtigen, sondern rückten mir auf den Leib und ließen mich nicht in Ruhe die neuesten Studien von Professor Freund auf dem Elektrobuch-Bildschirm lesen oder mich mit den anderen unterhalten, die hier auch ihre Alten ausführten. Ich schüttelte den unangenehmen Gedanken ab, dass sie wohl bald in ein Zanfeidalu kommen würden. Gut, dass der total heruntergekommene Bus gerade angerumpelt kam. Seine einzige Zierde waren die obligatorischen, strahlend roten chinesischen Fähnchen links und rechts der Fahrerkabine.
Dem Gesundheitsministerium sei Dank war der Bus nicht überfüllt, und ich konnte mich setzen. Das hatte ich nach der ungesunden psychischen Belastung dieses Morgens auch bitter nötig. Außerdem war es sicherer, denn wegen der vielen Schlaglöcher auf der Inneren Kanalstraße holperte der Bus fürchterlich. Die Scheiben waren vom Kondenswasser der regenfeuchten Körper beschlagen. Gedankenverloren malte ich mit dem Finger eine Raute auf die Scheibe, wie damals in der Schulzeit, als wir Mädchen dieses Geheimzeichen für Verliebtheit benutzten. Ich bemerkte den peinlichen Rückfall und wischte das Zeichen hastig mit dem Ärmel weg. Der Bus stammte wie die meisten Fahrzeuge, Straßen und Gebäude noch aus der barbarischen Meigu-Zeit, der Zeit, als man noch «Amerika» oder «Vereinigte Staaten» gesagt hatte.
Ich will nicht behaupten, dass ich damals schon die Zusammenhänge begriff; ich fragte mich aber durchaus, wieso wir in all den Hinterlassenschaften der angeblich so verabscheuungswürdigen Meigu-Zeit lebten. Nach der Großen Chinesischen Wende war noch weniger Neues geschaffen worden als in den vorausgegangenen Jahrzehnten der «Übergangszeit», während der Kriegswirren, Terrorismus und Wirtschaftskrise Europa im Griff hatten. Die alten Dinge wurden seitdem bloß noch repariert. Meine Oma hatte mir jedoch erzählt, früher habe es sogenannte Konfektionsgrößen bei Kleidungsstücken und Schuhen gegeben, gestufte Einheitsgrößen, die eigentlich für niemanden angemessen waren. Heute dagegen konnten sie praktischerweise mit Hilfe der Zwanjang-Daten automatisch von Nähmaschinenrobotern individuell angepasst werden. Die Zwanjange waren insgesamt hochtechnologische Wunderwerke, das wusste jeder. Obwohl ich in jener Zeit noch recht unbedarft war, empfand ich sie allerdings bereits damals manchmal schon eher als unangenehm anstatt als große Errungenschaft.
Nein, so durfte man das nicht sehen, besonders nicht, wenn man davon träumte, in die Fußstapfen von Professor Freund zu treten: Das Zwanjang warnte einen vor übermütigen und anderen ungesunden Handlungen. Es sorgte für lückenlose Sicherheit durch seine Identifikationsfunktion. Es rief in Notfällen selbstständig Hilfe. Es ermöglichte auf problemlose Weise basisdemokratische Abstimmungen. Es diente zur einfachen Zahlung und zur gerechten Steuererhebung ohne die früher üblichen Schlupflöcher. Außerdem integrierte es alle sinnvollen Kommunikationsmöglichkeiten. Laut Gesundheitsministerium gab es kaum eine Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, die eine derart allumfassend segensreiche Wirkung hatte wie das Zwanjang. Es führte eben zur rechten Verfahrensweise. Und was die vernünftigen Warnungen etwa vor gefährlichen Genussmitteln und risikoreichem Verhalten betraf: Wenn einer zu ungesund lebte, stellte er ja tatsächlich eine Last für die Gemeinschaft dar, die dann die erhöhten Krankheitskosten und andere Folgeprobleme tragen musste. Mein Vater hatte mal erwähnt, dass das Gesundheitswesen rund zwei Drittel unseres gesamten Bruttosozialproduktes verschlang. Das Gerücht, mehr Menschen würden mittlerweile in geschlossenen Zanfeidalus leben als in Freiheit, war vielleicht etwas übertrieben, aber eben nur etwas. Die Hinfälligkeit des Alters war schlechthin sozial unverträglich, also nicht «schechi», wie Professor Freund es ausdrückte. Irgendwo musste die Toleranz auch der tolerantesten Gesellschaft wie der unsrigen enden, wie der Professor mit messerscharfer Logik noch in der letzten Vorlesung vor den Semesterferien dargelegt hatte. Das Beste an der rechten Verfahrensweise des Gesundheitsministeriums: Anders als in tyrannischen historischen Zeiten mussten wir dank der Zwanjang-Überwachung nicht mit dem Verbot ungesunder Risiken reagieren. Es wurde behauptet: Nichts sei verboten, alles erlaubt. Allerdings in einem angemessenen Rahmen, der durch die Bing-Strafpunkte abgesteckt wurde. Eine geradezu geniale Verfahrensweise, wie jeder zugeben musste, der über einen funktionierenden Verstand verfügte. Naiv, wie ich damals war, glaubte ich das alles auch.
An diesem Tag wollte ich jedoch nicht den Verstand gebrauchen. Was sollte die ganze Logik? Ich wollte Mao oder wenigstens Butter. Warum also weiterleben?, fragte ich mich verbohrt schon zum zweiten Mal heute Morgen. Jetzt sogar auf meinen eigenen Körper bezogen! Schon allein damit, solche Überlegungen anzustellen, beging ich den größten aller denkbaren Verstöße gegen die rechte Verfahrensweise: In der ganzen Gesellschaft herrschte Einigkeit darüber, dass das oberste aller Ziele in der Erhaltung des eigenen Lebens bestand. Ich war übel drauf und haderte mit aller Welt. Dachte ich wirklich an Selbstmord, wie meine Mutter gesagt hatte? Das Jaocao hatte zwar nachhaltig gewirkt. Es gab kein Kribbeln mehr im Bauch und kein Ziehen im Unterleib. Gleichwohl wollte mir Mao nicht aus dem Kopf gehen. Irgendwie sollte man meinen, dass es möglich sein müsste, eine besser wirksame Chemie zur Gefühlskontrolle zu entwickeln, jammerte ich zerknirscht in mich hinein und hatte etwas Weiteres, auf das ich wütend sein konnte. Für eine effektive Gefühlskontrolle zu sorgen, war schließlich die Aufgabe des Gesundheitsministeriums!
Ich kramte Kopfhörer aus meiner Manteltasche und steckte sie mir in die Ohren. Mein Zwanjang versorgte mich automatisch mit beruhigender Musik, die laut der vom Gesundheitsministerium anerkannten und verbreiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse fast so weisching war wie die Chemie.
4. KAPITEL
Trotz der Berieselung mit andingiger Musik betrat ich mit weiterhin ausgemacht schlechter Laune den Hörsaal. Er war für die wenigen Studenten viel zu groß. Die neuen bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Gesundheitsministeriums, die nach der Erfindung von Jaomu zur Regelung des Wunsches nach Elternschaft eingeleitet worden waren, würden erst in paar Jahren greifen. Dann allerdings rechnete man fest damit, dass es wieder Zeiten geben würde, an denen die Universitäten so überfüllt sein würden wie damals, als diese Gebäude errichtet worden waren. Mir blieben noch fünf Jahre bis zur Jaomu-Behandlung. Richtig vorstellen konnte ich mir noch nicht, wie das werden würde. ... Ich erschrak, als ich Mao erblickte. Er war alles andere als susching. Überhaupt kein bisschen susching mehr! Wie heiß ich auch auf Schingsching gewesen wäre, es hätte zu rein gar nichts kommen können. Seine Studentenuniform hatte er durch lumpige Freizeitkleidung jidaitet - wie die Alten. Statt eines ordentlichen gestärkten Hemdes trug er ein schlecht sitzendes buntes Kwanta. Die Schläfen seiner vollen schönen schwarzen Haare hatte er, man höre und staune, grau gefärbt. Grau! Ungepflegt zottig waren sie obendrein! Einen ebenso ungepflegten Eindruck machten seine Drei-Tages-Bartstoppeln. Und trotz rundum weischinger Augen verunzierte eine historische runde Nickelbrille sein schönes junges Gesicht und ließ ihn steinalt aussehen. Alt! Wie schrecklich!
Dass Maos Augen völlig gesund waren, wusste ich von Ji. Ji war eine Freundin von mir. Sie hatte was mit Mao. Darum wäre es ja auch ungehörig gewesen, mit ihm zu schingschingen. Warum um alles in der Welt ließ er sich alt aussehen? Ich blickte mich nach Ji um und setzte mich zu ihr. Sie hielt sich natürlich nicht in der Nähe von Mao auf, denn es war verpönt, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten auszutauschen oder auf andere Weise seine Verbundenheit zu zeigen.
«Hei Ji. Was ist denn mit Mao los? Hat er seine Andingigkeit in China vergessen?» Ich eröffnete das Gespräch, ohne Zeit auf andere Äußerungen der Wiedersehensfreude zu verschwenden.
Ji schaute unverhohlen verliebt zu Mao hinüber und kicherte albern.
«Ist er völlig fenbing geworden?», stichelte ich weiter. Ich war erschüttert.
Ji wurde ernst. «Nein. Wieso sollte er verrückt sein? Sieht er nicht total geil aus, Penelope?»
«Geil?» Das Wort kannte ich nicht und wunderte mich immer mehr.
«Das hat man vor der Großen Chinesischen Wende gesagt», erklärte Ji leichthin. «Es heißt das Gleiche wie ‹susching›, nur ganz anders.»
Das war eine in sich widersprüchliche Aussage, also ziemlich fenbing. Ich fragte mich, ob Ji vielleicht vergessen hatte, ihre Dosis an blauen Jaoschilds zu nehmen, um in ihrem Kopf alles richtig zu regeln. Das musste es sein. Darum war sie so albern.
Mao hatte sich schnaufend wie ein krankes Walross zu uns gesellt und sich auf die andere Seite von Ji gesetzt. Er nahm sie in den Arm und küsste sie auf den Mund. Dazu musste er seinen Kopf nach oben recken, denn er war ein ganzes Stück kleiner als die lange Ji. Ich glaubte zu erkennen, wie Ji erblasste. Sie ließ diese überhaupt nicht zulässige Verfahrensweise jedoch ohne deutliche Gegenwehr über sich ergehen. Ich fragte mich, ob die Bartstoppeln beim Küssen nicht geradezu ekelhaft kratzen würden.
«Hei kleine Penelope», begrüßte Mao mich danach aufgeregt. Er neckte mich oft, indem er auf meine Kleinheit hinwies, obwohl er selbst auch nicht so viel größer war als ich. Ich kicherte verlegen, was natürlich etwas ganz anderes war als die Albernheit der langen Ji. «Steht mir das edle Grau nicht vortrefflich, Penelope?» Selbstgefällig strich er sich über seine Schläfen.
Wie konnte man bloß die Worte «grau» und «edel» miteinander kombinieren, fragte ich mich abgestoßen.
Die unter uns Studenten damals als altertümlich geltende Zurschaustellung von Zärtlichkeit war allgemein aufgefallen, und die Blicke der Kommilitonen richteten sich auf Ji und Mao. So etwas erlaubten sich doch nur die Alten, die noch von historischen Sitten geprägt waren! Mao hatte in geradezu barbarischer Weise den Arm um Ji gelegt, und sie schmiegte sich an seine Seite. Es wurde ganz still und war noch immer außerordentlich ruhig, als Professor Freund schließlich den Hörsaal betrat. Nur ein ganz leises Wispern hinter vorgehaltenen Händen war noch zu vernehmen.
Professor Freund warf einen befremdeten Blick auf das Paar, begann dann jedoch umstandslos seine Vorlesung zur Einführung in die Preziologie, um uns die logische Ableitbarkeit der Grundwerte unserer Gesellschaft deutlich zu machen. Er war dabei, den notwendigen Zusammenhang zwischen den Begriffen Freiheit und Sicherheit zu entwickeln, als Mao plötzlich aufsprang. Er wurde feuerrot im Gesicht und musste sich erst räuspern, bevor er ausstieß:
«Herr Professor Freund! Warum verneinen Sie die Erfahrung im Katalog Ihrer Werte? Eine solche altenfeindliche Haltung ist unterdrückerisch!»
Ganz im Gegensatz zu seinem «alten» Aussehen klang seine Stimme hoch und piepsig, so erregt war er. Völlig fenbing, dachte ich. Da würden auch keine blauen Jaoschilds mehr helfen. Er würde tatsächlich wie die Alten (oder Trauernden) rosa Jaosinns brauchen, damit er sich entspannen und der Welt mit Wohlgefallen begegnen konnte. Dass es mir selbst heute Morgen schlecht gegangen war, hatte ich ganz verdrängt. Ich war bloß erleichtert, dass ich mir keine Sorgen mehr zu machen brauchte, jemals wieder von Mao zu träumen. Es blieb also bloß das Laster, hinter Butter her zu sein. Ich hatte noch etwas Guthaben auf meinem Zwanjang und würde mir nachher welche kaufen, um den Tag der Befreiung von der einen meiner beiden ungebührlichen Leidenschaften zu feiern. Gegen die andere half, wie gesagt, nichts, keine Jaofan-Chemie, keine Psychotherapie eines Dr. Müllers, kein gar nichts. Schande über das Gesundheitsministerium!
Professor Freund zögerte einen Augenblick. Ich glaubte zu spüren, wie er um sein inneres Gleichgewicht rang. Schließlich brachte er heraus:
«Setzen Sie sich bitte, Herr Schmidt. Über alles lässt sich reden, und ich bin dazu selbstverständlich stets bereit. Das Thema, das Sie angeschnitten haben, passt allerdings an dieser Stelle noch nicht in die Diskussion. Ich versichere Ihnen aber, dass wir Zeit und Raum finden werden, um es nachzuholen. Scharf muss ich mich hier jedoch dagegen verwahren, dass Sie von ‹meinen Werten› sprechen; es handelt sich nachgewiesenermaßen um den gemeinsamen Bestand unserer Kultur.»
Mao zuckte bei der Zurechtweisung zusammen. Sehr umständlich nahm er wieder Platz. Er schaute sich unsicher um. Einige Kommilitonen grinsten vor sich hin. Ich sah, dass Maos Hände leicht zitterten.
Eine Studentin, die ich nicht kannte, rief halblaut: «Schmier’s dir doch in die grauen Haare, Mao!»
Da konnte ich ihr nur aus tiefster Seele zustimmen. Professor Freund streifte das Mädchen mit einem vielsagenden Blick und hob ganz leicht, fast unmerklich, die linke Augenbraue. Ohne weiteren Kommentar setzte er die Vorlesung fort. Es kam zu keinen Zwischenfällen mehr. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht an irgendwelche Inhalte. Als die Vorlesung vorbei war, winkte Professor Freund Mao zu sich.
Im Aufbruch sagte ich zu Ji: «Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ist ihm in den Semesterferien das Gehirn jidaitet worden?»
Heute kann ich es mir kaum noch vorstellen, doch ich war damals unbestreitbar eine dumme Gans, die keine Ahnung davon hatte, was um sie herum vor sich ging. Sogar die - zugegebenermaßen plötzliche - Veränderung meiner Freundin Ji war mir entgangen. Jedenfalls lud mich Ji freundlich zu einem Konzert des «1. Freien Altenkonvents» ein, und so sollte ich an diesem Wendepunkt meines Lebens zum ersten Mal in Berührung mit den Juschangsen kommen. Zwar wusste ich, dass sich manche Alte in Chineutsch als «Schangsen» bezeichneten: Sie nahmen ihre Chemie nicht oder schädigten sich auf andere Weise selbst. Sie liefen aus ihren Zanfeidalus weg. Sie bettelten auf der Straße um Nahrungsmittel, denn aufgrund ihres Bing-Kontostandes waren sie entmündigt und konnten nichts mehr ohne Wissen und Zustimmung des die Vormundschaft ausübenden Amtes kaufen. An ihren Zwanjangen wurde die Zahlungsfunktion gesperrt, und Bargeld war ja schon lange aus dem Verkehr gezogen. Genug Chinesisch, dass ich erschließen konnte, die Vorsilbe «ju» würde die Juschangsen zu Freunden solcher verwahrloster Alten machen, war mir allemal geläufig, obwohl ich den Chinesisch-Unterricht in der Schule eher missmutig an mir vorbeirauschen gelassen hatte. Dass man sich freiwillig als Freund von derartig abstoßenden Alten bezeichnen konnte, war mir jedoch unverständlich.
5. KAPITEL
Gegen Abend holte Ji mich ab. Meine Eltern mochten Ji, und ich hörte, wie sie ein paar Worte mit meiner Mutter wechselte, bevor sie an meine Zimmertür klopfte. Ich selbst hatte, nachdem ich von der Uni zurückgekehrt war, kein Wort mit meiner Mutter geredet. Vielmehr hatte ich mich auf dem klapprigen Stuhl vor dem Schreibtisch mit meinem völlig überalterten Diannao gesetzt, ihn aber nicht hochgefahren, sondern das Päckchen Butter ausgepackt, das ich mir geleistet hatte. Dazu hatte ich mir ein Brötchen aus unweischingigem weißen Mehl besorgt, was mich einen Bing-Strafpunkt extra kostete. Die bunte Plastikkarte, die als Mitgliedsausweis für den Gesundheitsklub diente, benutzte ich, um die Butter dick, sehr dick auf ein Stück des Brötchens zu verteilen und gierig in meinen ohnehin üppig gepolsterten, gegen jeden Therapieversuch resistenten Leib zu schlingen. Diese Plastikkarten waren ganz und gar überflüssig, denn man wurde ja mit dem Zwanjang identifiziert, der Klub hielt jedoch aus mir damals unverständlicher Traditionsverbundenheit an ihnen fest. Professor Freund nannte so etwas eine unethische Verschwendung von gesellschaftlichem Kapital, die eine Hinterlassenschaft der längst überwundenen Meigu-Zeiten darstelle. «Schechi», wie er die soziale Nützlichkeit in Chineutsch nannte, war für ihn der Wert, der alle anderen unter sich barg. Nun war wenigstens dieses Plastikkärtchen zu etwas nütze, dachte ich befriedigt, wenn es wohl auch nicht ganz im Sinne von Herrn Professor Freund war, was ich hier im stillen Kämmerlein trieb. Wenn etwas Recht sei, sagte er gern, brauche es das Licht der Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Dann klopfte Ji. Ich brummte ...
«Hei Penelope.» Ji trat fröhlich ein.
Beim Gesundheitsministerium, war sie beneidenswert schlank! Bei einer Größe von 1,95 Meter und noch fünf Kilo weniger als ich brachte sie es auf einen Körpermasseindex von unter 19. Nachdem ich mich unvernünftig an der Butter verlustiert hatte, stieß mir das nun besonders auf. Schnell wischte ich mir mit dem Handrücken einen letzten Rest aus dem linken Mundwinkel und nickte bloß.
Ji kam zu mir an den Schreibtisch und drückte mir wortlos einen eigenartigen Zettel in die Hand. Er sah so aus, wie ich mir eine alte, inzwischen längst überflüssig gewordene Geldnote vorstellte. Ich selbst hatte noch nie eine gesehen, denn das Zwanjang hatte ja, wie gesagt, alle Zahlungsfunktionen übernommen, und dies war bereits Anfang der 50er Jahre geschehen, kurz nach meiner Geburt.
«Du musst hier deinen Namen eintragen», erklärte mir Ji und deutete auf eine freie Stelle auf dem Zettel. Sie gab mir einen historischen Zeichenstift.
Ich zögerte.
«Keine Angst, es ist kein Bargeld wie früher», beruhigte sie mich. «Das darf man ja nicht mehr verwenden. Nein, hierbei handelt es sich um einen Schuldschein. Der graue Edgar hat diese Gesetzeslücke ausfindig gemacht. Schuldscheine zu besitzen, ist vom Gesundheitsministerium nicht verboten.»
Ich schaute mir den Zettel genauer an und las: «Unterzeichnete/r __________ schuldet Edgar 1 Gefallen.»
Mir war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, die rechte Verfahrensweise hinterlistig zu umgehen. «Was für ein Gefallen könnte das denn sein?»
«Wenn die Scheine erst einmal personalisiert sind, zirkulieren sie wie früher das Geld, nur anders herum. Wenn du etwas für mich tust, zum Beispiel für mich eine Semester-Arbeit verfasst, bekommst du einen Edgar-Schein von mir, vielleicht sogar deinen eigenen, wenn ich vorher dem grauen Edgar einen Gefallen getan habe, und so weiter.»
«Und das funktioniert?» Ich konnte das nicht glauben.
«Hervorragend. ‹Für Edgars kannst du fast alles bekommen, außer Bing-Strafpunkte›, wie der graue Edgar witzelt. Sogar Eier und Glimmstängel.» Ji holte eine Schachtel «Camel» hervor, die ich aus historischen Abbildungen kannte. «Ehrlich, hergestellt in America.»
Ich schauerte und fürchtete, Ji könnte sich eine der todbringenden Zigaretten anzünden.
«In Meigu, bei den Barbaren?», fragte ich entsetzt.
«In America», beharrte Ji und «kaute» das Wort so eigenartig wie in der unguten Sprache üblich.
Mich überfielen Zweifel, ob ich mich überhaupt auf diesen Abend einlassen sollte. Vielleicht wurden bei dem Ereignis, das Ji ein «Konzert» nannte, sogar Tabakwaren öffentlich konsumiert! Das Passivrauchen würde meinem ohnehin überspannten Gehirn sicherlich Schaden zufügen. Unsere ganze Familie war vom Ortskomitee des Gesundheitsministeriums als genetisch «suchtdisponiert» klassifiziert worden. Unsere Zwanjange hatte man entsprechend mit engen Toleranzgrenzen programmiert.
«Aber das Nikotin im Körper wird vom Zwanjang festgestellt, und das gibt echt viele Bing-Strafpunkte», wandte ich ein, als ob Ji mich zum Qualmen aufgefordert hätte. Andingigkeit hin, Andingigkeit her, etwas musste man ja schon an seine Zukunft denken.
«Scheiß auf’s Zwanjang», schimpfte sie. So derb hatte ich sie noch nie reden gehört. In ihr schien sich auf unerklärliche Weise eine Wandlung zu vollziehen. Das machte mir zusätzlich Angst. «Bing-Punkte sind einfach kacke! Dir steht der andingigste Abend deines Lebens bevor. Ich schwöre! Komm.»
Tatendurstig nahm Ji mich beim Arm, wohl weil ich einen einigermaßen phlegmatischen Eindruck machte, der auch den Tatsachen entsprach. Sie zog mich nach draußen und rief meiner Mutter einen Gruß zu, während ich es vermied, sie auch bloß anzusehen.
Vor dem Haus schaffte ich es dann doch noch, von mir aus aktiv zu werden.
«Wo müssen wir eigentlich hin, Ji?» Ich fröstelte in der Abendkälte.
«St. Gereon. Das Konzert findet in St. Gereon statt.»
«In der Ruine?» Das war eine abwegige und ungemütliche Vorstellung. «Wie bedrückend! Ist dort denn überhaupt geheizt? Es wird entsetzlich kalt sein!»
«Nein, das wird ein heißes Abenteuer», widersprach Ji zuversichtlich. «So heiß war dir sicherlich noch nie.»
«Kostet es Eintritt? Oder spare ich mir den mit diesem komischen Fetzen ...»
«Dem ‹Edgar›», half Ji mir aus. «Ja, damit wird der Eintritt abgegolten. ‹Edgars› sind sehr wertvoll, du wirst schon sehen.»
«Dann können wir uns ein Taxi leisten. Ich hasse diese nasskalten Schrottbusse. Du bist eingeladen.» Natürlich hätte man die kaum mehr als zwei Kilometer auch zu Fuß gehen können. Ich war jedoch ausgesprochen faul und gab fast ebenso viel Guthaben für bequemen - und warmen! - Transport wie für Butter aus. Wenn ich wegen unüberwindlicher Trägheit den Besuch im Gesundheitsklub ausfallen ließ, handelte ich mir auch dafür Bing-Strafpunkte ein. Die sportliche Ji war da ganz anders.