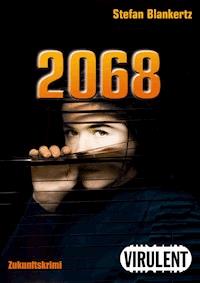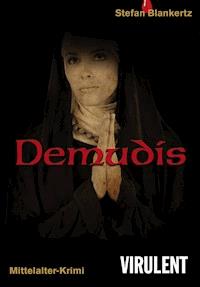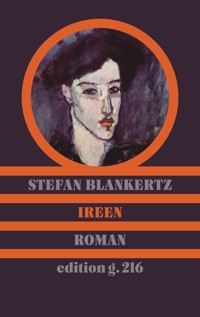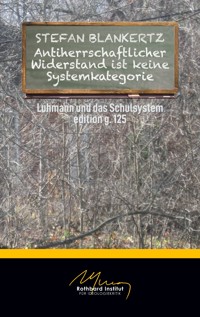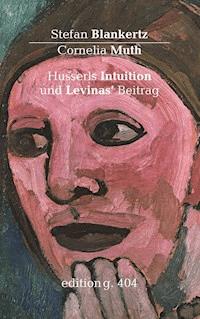Abb. 1: Highschool-Abstimmung 1860
Abb. 2: Tabellen 1 und 2
Abb. 3: Bruttosozialprodukt und Bildungsausgaben
Abb. 4: Bruttosozialprodukt und Bildungsausgaben (19. Jh.)
Abb. 5: Genotyp/Umwelt-Interaktion
Abb. 6: Gene oder Umwelt?
Abb. 7: IQ-Werte eineiiger Zwillinge
Abb. 8: Variabilität
Abb. 9: Heritabilität
Abb. 10: Die ethnische Frage
Drei Einläufe
[1]»Ein SS-Kommandant sagte, daß er sich besser auf die Lagerwache als auf seine SS-Leute verlassen könne.«1 Durch Erziehung, begehrte Theodor W. Adorno 1966 gegen die|seine Resignation auf, könne nach Auschwitz doch etwas getan werden, um zu verhindern, dass die Knechte
bei der Verewigung ihrer Knechtschaft mithelfen.2 Er dachte dabei an Aufklärung, nicht an Schulpflicht, Curricula, Lernziele, an Stundenzeichen,
Hausaufgaben, Prüfungsangst, oder an Beruhigungspillen, Unterrichtsbeamte,3 Pausengewalt und all die anderen Kennzeichen derjenigen Institution, in der
Erziehung stattfindet und die ein junger Mensch zu »überleben« lernen muss. Erziehung ist, wie zuvor auch schon die Politik, dem sozialen
Kontext entfremdet und durch den Staat okkupiert worden. Indem sie Widerstand
lehrt, bricht sie ihn.
[2] Ein Symbol, wie tot der klassische Anarchismus ist: Barcelona, Ende September
2012. Demonstration von Lehrern gegen Privatisierungspläne. An sich nichts Ungewöhnliches. Im Spätetatismus4 ist die Identifikation der Unterdrückten mit den Unterdrückern weit fortgeschritten, so dass sie meinen, ohne Staat würden sie Not leiden (in der Verteidigen-wir-den-Staat-Manie wird ja immer
vergessen und verdrängt, dass die Not schon da ist – und zwar durch die [un?]sichtbare Hand des Staats). Aber dies war dann doch wie
ein Schock für mich: Sie demonstrierten unter der schwarz-roten Flagge des
Anarcho-Syndikalismus, und das Banner war mit »CNT«5 unterzeichnet … Buenaventura Durruti (1896-1936) & Francesc Ferrer (1859-1909) mögen sich als Anti-Kapitalisten bezeichnet haben, Etatisten waren sie keineswegs.
Jene Aktion der CNT ist um so blamabler, als Francesc Ferrer, Märtyrer des spanischen Anarchismus und Pionier der Alternativschulbewegung, klar
gegen jede Staatlichkeit von Schule Stellung bezog:
»Regierungen haben es immer vermocht, ihre Hand auf die Bildung der Menschen zu
legen. Sie wissen besser als alle anderen, dass ihre Macht fast vollständig auf den Schulen beruht. Darum monopolisieren sie sie mehr und mehr.«6
In seiner Einleitung zu der englischen Ausgabe von Ferrers La Escuela Moderna, Modern School, schrieb der Übersetzer Joseph M. McCabe (1867-1955): Francesc Ferrer »believed that liberty was essential to the development of man, and central
government an evil«. – Am Rande: Dem »Modern School«-Movement von Voltairine DeCleyre (1866-1912) in den USA gehörte später, im Übergang zu der »Summerhill Society«, Paul Goodman (1911-1972) an. Beide, Voltairine DeCleyre und Paul Goodman,
sind, trotz ihrer Schwächen in puncto Ökonomie, unverdächtige Anti-Etatisten.7
Die heutige Form des linken »Anarchismus« hat mit jenem klassischen Anarchismus nichts zu tun: Diese Form ist bar jeder
Kenntnis der Geschichte des Anarchismus einfach ein Reflex auf die
Zuschreibung, »Anarchismus« stünde für einen besonders militanten linken Etatismus. Denn selbst wenn man es ablehnt,
dass Schulen als privatwirtschaftliche Veranstaltungen organisiert werden,
folgt daraus doch noch lange nicht, dass man vehement oder sogar militant für die Beibehaltung »öffentlicher« (= Staats-) Schulen eintreten müsse.
Und seitdem ganz allgemein die vermeintlichen Sprecher der 1968er-Rebellion, die
ja immerhin damals unter freien Schulen staats-un-abhängige verstanden, zu gnadenlosesten »Konservativen« geworden sind, die die Staatlichkeit der Schule mit Zähnen und Klauen verteidigen, droht radikale Schulkritik in Vergessenheit zu
geraten: Das Häuflein Restliberaler vertritt, wenn überhaupt etwas zur Bildungspolitik, höchstens eine private Produktion von Bildung im Rahmen strikter staatlicher
Vorgaben. Dies ist eine Idee, die auf John Stuart Mill zurückgeht, der sie in »On Liberty« (1859) entwickelte und meinte, damit Humboldts Freiheitsgedanken aufzunehmen.
Dass eine privat produzierte Bildung, deren Ziele durch staatliche Prüfungen festgelegt sind, kaum als »frei« benannt werden dürfte, konnte schon er nicht mehr verstehen. Der Freiheitsbegriff war bereits
beschädigt.
[3] Hartnäckig hält sich dies Gerücht: »Die Medien« verdürben »unsere Jugend«. Mit diesem Gerücht schützen wir uns davor zu fragen, welche Gemeinschaft wir unseren Kindern präsentieren: Es ist eine Gemeinschaft, in der zum einen die perfekte Organisation
jede Handlung des Individuums programmiert, und in der zum anderen gleichsam
naturwüchsig Brutalität unprogrammgemäß und unorganisiert zurückschlägt – eine Brutalität wohlgemerkt, die sich aller Mittel der politischen Infrastruktur bedient. Der
durchgeplante Schulunterricht und die aus ihm unmittelbar folgende Brutalität auf dem Schulhof sind eine Vorübung zum Überleben in dieser Welt. Die social media bilden sie ab. Aus ihnen lernen die Kinder von der »Realität« mehr als aus harmonistischer Wohlfahrtsideologie, die ihnen in der Schule
beigebracht werden soll. Erst viel später begreifen sie die Heuchelei, dass sie das eine tun müssen und das andere sagen. Dann sind sie erwachsene, »mündige Bürger« der verwalteten Welt. Es wäre aber nicht besser, für die Freiheit eher schlechter, würde im öffentlich-rechtlichen Funk oder in der Schule deren Sache das Wort geredet. Das smartphone ist die Botschaft. Das Medium des Zwanges verwandelt das Richtige in Falsches.
Schulpädagogik, ein Trauerspiel
[1] Als ich meinen Sohn Ende der 1980er Jahre in Bonn auf einer Gesamtschule
anmelden wollte, weil ich diese Schulform für ihn unter den gegebenen Möglichkeiten als die Beste erachtete, ging das nicht. Die Schule hatte eine lange
Warteliste. Durch die CDU-Schulpolitik, die die Gesamtschule im Namen des
Rechts auf elterliche Wahlfreiheit bekämpfte, wurde dieser erfolgreichen Schule es versagt, der Nachfrage entsprechend
zu expandieren.
In kaum einen Lebensbereich muss der Begriff der Freiheit sich solche
dialektische Verdrehungen gefallen lassen wie im Schul- und Bildungswesen. Für die einen besteht Freiheit darin, sich dem Zwang zu beugen, unter drei
Kategorien der staatlichen Vorsortierung von Chancen zu wählen. Für die anderen besteht sie darin, sich durch staatliches Einheits-angebot zu »Freiheit und sozialer Verantwortung« erziehen zu lassen. Unter »pädagogischer Freiheit« ist zu verstehen, dass Lehrer gegen den ausdrücklichen Willen betroffener Schüler und Eltern ihre Vorstellungen durchziehen. Den Lehrern dagegen die Freiheit
einzuräumen, den Unterrichtsstoff den Bedürfnissen ihrer Schüler anzupassen, führte dann allerdings doch zu weit. Sie müssen sich an den staatlichen Lehrplan halten, sonst ginge ja die
Vergleichbarkeit von Schul-Abschlüssen verloren und »unsere« (sic) Wirtschaft bräche zusammen. Schließlich wüssten die Personalchefs dann nicht mehr, wen sie für welche Arbeit einstellen sollten. Obgleich empirische Studien über nun fast hundert Jahre zeigen, dass Schulnoten nie »vergleichbar« machen, selbst wenn standardisierte Tests eingesetzt werden, stören sie kaum die absurde Argumentation. Es geht um Höheres. Da kann man ruhig ums Goldene Kalb mal tanzen, selbst wenn jeder weiß, dass es aus Scheiße besteht.
Aber auch bei den Gegnern der jeweils gerade vorherrschenden Schulpolitik
besteht meist wenig Neigung dazu, einen freiheitlichen Standpunkt einzunehmen.
Da ist man sich beispielsweise (ohne jeden Beleg) ganz gewiss, dass Mengenlehre
zur Schwangerschaft von minderjährigen Mädchen und anderen Perversionen führt. Oder dass die Sexualkunde Kommunisten produziert, die das Eigentum nicht
achten. Vor allem weiß jeder gestandene »Schulkritiker«, dass die Ganzwortmethode beim Lesen- und Schreibenlernen in der Grundschule
Schuld an der Arbeitslosigkeit ist – strotzen denn nicht die Bewerbungsschreiben vor orthografischen Fehlern? Und
eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Jeder Bewerber bekäme einen Job, wenn er nur keine orthografischen Fehler im Bewerbungsschreiben
machen würde. Sogar für den Anarchisten Michael Bakunin, »seit dem es« laut Walter Benjamin »in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben« habe,8 fängt das, was er die »absolute Freiheit« nannte, erst mit der »Großjährigkeit« nach der »vollständigen [¿zwangsweisen?] Ausbildung« an. Die eigene Schulerfahrung und die Jahrhunderte lange Propaganda der
Staatsschule haben es fest in unseren Köpfen verankert: Das, was er fürs Leben (und vor allem Arbeiten) braucht, lernt der junge Mensch einzig durch
Zwang. Ein sozialverträgliches Verhalten lernt der junge Mensch einzig durch Zwang. Und auch die
Bewahrung einer freiheitlichen Ordnung lernt der junge Mensch einzig durch
Zwang. Einen leider nur kurz aufglimmenden Lichtblick hat es einmal im »Spiegel« gegeben, als 2006 über die Phorms AG berichtet wurde, die Privatschulen im Pflichtschulbereich
(also unter strengster staatlicher Aufsicht) betreibt.
»›Es ist unanständig, sich auf dem Rücken [sic] der Kinder zu bereichern‹, sagt Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Die Phorms-Kinder machen nicht den
Eindruck, als hätten sie den Schutz der Lehrerlobby nötig.«9
Was für eine andere Schulwirklichkeit, auf die der Kapitalismus da einen Ausblick
gibt!
[2] Das Verhängnis nahm seinen Lauf, als man das pädagogische Engagement eines sehr individuellen und eigenwilligen Menschen wie
Pestalozzi nahm und mit der Preußischen Schulreform Anfang des 19. Jahrhunderts zur verbindlichen
Unterrichtspraxis des ganzen Landes machte. Besonders verwirrt hat mich immer, dass derjenige, der die sogenannte
Pestalozzische Methode flächendeckend eingeführt hat, kein geringerer war als Wilhelm von Humboldt, der doch eigentlich als
liberaler Theoretiker auf bildende Wirkungen von »mannigfaltigen« sowie selbstgestalteten Situationen setzte. Da haben wir nun auf der einen
Seite einen wilden Erzieher, der sein Leben zwischen schwererziehbaren und
verwahrlosten Kindern zubrachte, dabei die mannigfaltigsten Situationen
sicherlich erlebte, aber gern eine feste, einheitliche und verbindliche »Methode« schaffen wollte, und auf der anderen Seite einen vornehmen Philosophen, der die
staatliche Regelungswut vorausgeahnt hatte und eindämmen wollte, aber in der praktischen Schulpolitik die Uneinheitlichkeit nicht
ertragen konnte. Das Wilde, Individuelle, Lebendige, das beide je auf ihre
Weise verkörperten, blieb Geschichte. Das Ordnende, Bürokratische, Uniformierende, das sie, wenn nicht gewollt, so doch gewirkt haben,
wurde zur Gegenwart.
Ende des 18. Jahrhunderts lösten die liberale Evolution in England und die Revolutionen in Nordamerika und
Frankreich die alte ständische Ordnung auf. Mit beginnendem 19. Jahrhundert wurden die Weichen dann so
gestellt, dass gegen den staats-begrenzenden Liberalismus von Adam Smith,
Thomas Jefferson und Wilhelm von Humboldt ein Nationalliberalismus obsiegte, in
dessen Rahmen autoritäre Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie selbst Imperialismus durchaus
koexistieren konnten.
Pestalozzi wäre heute nur eine Fußnote, nicht bekannter als etwa Basedow, wenn nicht ein gewisser Humboldt dafür gesorgt hätte, dass die Pestalozzische Methode gleichsam zu der staatlich verordneten
Unterrichtungsdidaktik in der Elementarschule der Preußischen Reformen geworden ist. Die Entscheidung für »Pestalozzi« war bereits getroffen worden, bevor Humboldt 1809 das Amt des Kultusministers übernahm. Humboldt stellte diese Entscheidung nicht, wie viele der vorgefundenen
Entscheidungen, ernstlich in Frage.
Mit den »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen« hatte der junge Humboldt 1793 allerdings das klassische Manifest des ursprünglichen, staats-kritischen Liberalismus verfasst. Der Staat habe im Leben der Bürger nichts verloren als nur das eine zu leisten, nämlich den inneren und äußeren Frieden zu sichern.
Als Humboldt dann das Glück – oder das Pech – hatte, zum Preußischen »Kultusminister« berufen zu werden, folgte er dem Ruf widerstrebend und zögerte kaum ein Jahr später nicht, seinen Posten unverzüglich aufzugeben, als ihm klar wurde, dass der Regierung um Stabilisierung der
staatlichen Ordnung es ging und nicht um Verwirklichung des liberalen
Programms.
Ausgangspunkt der didaktischen Überlegungen Pestalozzis war, dass er bei seinen verwahrlosten Schülern nicht auf eine in dem Elternhaus bereits grundgelegte bürgerliche Bildung zurückgreifen konnte. So forschte er nach ganz elementaren Konzepten, mit denen die
Welt zu »begreifen« sei. Diese Konzepte wollte er den Kindern beibringen, um sie für ein menschenwürdiges Leben auszustatten.
Pestalozzi stieß bei seiner Suche nach dem Elementaren auf Form, Zahl und Wort. Form und Zahl
enthalten in seiner Auffassung die formalen Bedingungen der Erkenntnis. Das »Wort« steht Pestalozzi zufolge für die »Kategorien«, die menschliche Erfahrung erst möglich machen. Auf diese Weise sah er die Welt sowohl in ihrer Mannigfaltigkeit
als auch in ihrer inneren Zusammengehörigkeit abgebildet. Das subjektive Vorgehen bei der Aneignung entspricht nach
der Meinung Pestalozzis in den elementaren Konzepten von Form, Zahl und Wort
ihrer objektiven Bedeutung für das Verständnis der Welt.
Die didaktische Umsetzung dieser Überlegung gestaltete Pestalozzi in einer Weise, die er selber mit dem eher
unerfreulichen Wort »mechanistisch« benannte. Er zerlegte alles Wissen in die kleinsten Einheiten, die dann durch
Nachsprechen und ständiges Wiederholen auswendig gelernt werden mussten.
Die Faszination der Pestalozzischen Methode für die aufgeklärten Zeitgenossen lag in zwei Aspekten: Zum einen war es eine Methode, die von
bestimmten Standesbedingungen losgelöst allen Menschen gleichermaßen angemessen war. Zum anderen, und dazu hatte Pestalozzi selber kaum etwas
beigetragen, korrespondierte seine Didaktik in etwa mit der Erkenntnistheorie
von Immanuel Kant, und das, obwohl Pestalozzi seine Methode weitgehend unabhängig von den philosophischen Strömungen seiner Zeit entwickelte. Form und Zahl konnten Kants reinen Formen der
Anschauung, nämlich Raum und Zeit, zugeordnet werden. Dies fiel bei dem Pestalozzischen
Elementarkonzept »Wort« schwerer, da Kants Kategorien nicht aus elementaren Lauten bestehen
– (wie es für die Methode Pestalozzis erforderlich gewesen wäre) –, sondern aus Logik. Dieser Schönheitsfehler störte jedoch kaum jene Euphorie, mit welcher das intellektuelle Europa meinte, die
fortschrittliche Erkenntnistheorie und Volkspädagogik seien durch Pestalozzi zu einer Sache zusammengefügt worden.
Einer allerdings teilte diese Euphorie nicht – Humboldt. Er äußerte sich 1804, also nur wenige Jahre vor der Ernennung zum Preußischen Kultusminister, in einem Brief an Goethe voller Verachtung über Pestalozzi:
»Sagen Sie mir einmal selbst, was aus dem Menschengeschlecht würde, wenn alle Kinder nun 30 Jahre hintereinander nachbeteten: das Auge liegt
unter der Stirn, 2 mal 2 ist 4, ein Quadrat hat 4 gleiche Seiten usf. […] Auch der Bauer und Bettler hat eine Phantasie […] auch in ihm kann und muss etwas Höheres geweckt werden, und bisher wurde es geweckt. Man las in allen Schulen
kapitelweise die Bibel. Da war Geschichte, Poesie, Roman, Religion, Moral alles
durcheinander; der Zufall hatte es zusammengefügt, aber die Absicht möchte Mühe haben, es gleich gut zu machen.«10
Humboldt argumentierte hier sozial: »Auch der Bauer und Bettler hat eine Phantasie.« Dagegen gilt es in der pädagogischen Geschichtsschreibung als Merkmal von Humboldt, sozialen Fragen gegenüber unempfindlich gewesen zu sein, während Pestalozzi das pädagogische Engagement für die Armen in den Vordergrund gestellt habe. Das hat er natürlich getan. Immer wieder betonte Pestalozzi, wie »mitten im Schlamm der Rohheit, der Verwilderung und der Zerrüttung die herrlichsten Anlagen und Fähigkeiten« sich entfalten ließen. Was Humboldt ihm allerdings als Fehler ankreidete, ist, dass nicht »etwas Höheres geweckt werden« würde durch die mechanistische Didaktik der Wiederholung. In der Tat kann es einem
kalt über den Rücken laufen, wenn Pestalozzi beschreibt, dass in seinem Unterricht Mengen
sinnloser Buchstabenkombinationen »von den Kindern vollkommen gelernt« werden mussten, oder wenn er stolz vermerkt, die Kinder könnten »ganze Reihen von Ländernamen richtig auswendig« aufsagen. Humboldt hatte nicht einmal bezogen auf Pestalozzis Absicht unrecht,
ihm ein mangelndes Interesse daran vorzuwerfen, »etwas Höheres« in den armen Kindern zu wecken. So schrieb Pestalozzi ausdrücklich zu Beginn des Berichts über die Armenanstalt in Stanz, dass die Kinder »durch ihre Erziehung nicht aus ihrem Kreis gehoben, sondern durch dieselbe
vielmehr fester an denselben angeknüpft« werden sollten.11
Humboldt verteidigte die damals gültige Praxis gegen die Methode Pestalozzis: »Bisher wurde es [d.i. das Höhere] geweckt. Man las in allen Schulen kapitelweise die Bibel.« In der pädagogischen Geschichtsschreibung wird hingegen gern behauptet, Humboldt habe
zwar von »Mannigfaltigkeit der Situationen« geträumt, in der Praxis aber derart schlimme Verhältnisse vorgefunden, die ihn dazu zwangen, erstmal einen gewissen
Mindeststandard zu gewährleisten. 1804 war Humboldt jedenfalls der Meinung, dass die Schulrealität in Preußen der durch die von der Pestalozzischen Methode befürchteten Verblödung überlegen sei. Das sind harte Worte. Aber sie zeigen, dass nicht innere
Folgerichtigkeit Humboldt dahin führte, seine Kritik an der Pestalozzischen Methode aufzugeben, sondern dass er
die Auffassung änderte.
Humboldt unterstellte eine Methode: »Die Absicht möchte Mühe haben, es gleich gut zu machen [wie die Bibel].« Die geistlosen Nachsprech-Übungen hielt Humboldt demnach für das Zentrum der Pestalozzischen Methode, in der durch Absicht das Natürliche oder das Gewachsene nachgebaut werde. Dies ist eine Unterstellung, weil
Pestalozzi selber weitaus weniger sicher war, ob überhaupt etwas völlig Durchstrukturiertes und Geplantes der richtige Weg sei. In seinen Ausführungen zum Sportunterricht finden sich zum Beispiel zwei völlig widersprüchliche Aussagen. Einerseits: Im Spiel des Kindes »mit seinem eigenen Körper hat die Natur den wahren Anfangspunkt der körperlichen Kunstbildung« gegeben. Diese Wertschätzung des Spiels hört sich organisch an. Andererseits empfahl Pestalozzi körperliche »Gelenkbewegungen«,12 die den mechanistischen Sprechübungen nachempfunden zu sein scheinen.
Ein weiteres Beispiel: Über die Entstehung seiner Armenschule von Stans sagte Pestalozzi, sie sollte »statt [sic] eines vorgefassten Planes vielmehr aus meinem Verhältnisse mit den Kindern hervorgehen« und er wolle »die die Kinder umgebende Natur, die täglichen Bedürfnisse […] selbst als Bildungsmittel« benutzen.13
Der kritischen Anmerkung Humboldts zur Methode Pestalozzis möchte ich eine Passage aus dem Stanser Brief gegenüberstellen. Zunächst scheint diese Passage mit Humboldts Einwendungen gar nichts zu tun zu
haben, denn sie befasst sich mit der Frage der Schulorganisation und nicht mit
der der Unterrichtsdidaktik:
»Auch bin ich mehr als je überzeugt, sobald die Lehranstalten jemals mit Kraft und Psychologie mit
Arbeitsanstalten verbunden werden, so wird notwendig ein Geschlecht entstehen,
das einerseits durch Erfahrung lernet, daß das bisherige Lernen nicht den zehnten Teil der Zeit und Kraftanwendung bedürfe, die gewöhnlich darauf verwendet wird; andererseits, daß dieser Unterricht der Zeit, der Kräfte und der Hülfsmittel halber mit den häuslichen Bedürfnissen so in Übereinstimmung gebracht werden könne, daß die gemeinen Eltern allenthalben sich selbst oder jemand von ihren gewöhnlichen Hausgenossen dazu geschickt zu machen suchen werden, welches durch die
Vereinfachung der Lehrmethode und durch die steigende Zahl vollendet geschulter
Menschen immer leichter werden wird.«14
Die Verbindung von Leben, Arbeit und Bildung, die Pestalozzi vorschwebte, war
Humboldts Sache nun freilich nicht. Humboldt hielt dafür, dass Bildung den Menschen von der reinen Zweckhaftigkeit erlösen sollte. Das hat etwas für sich, weil die enge Bindung der Bildung an die Nützlichkeit das Lernen auf die bestehenden Verhältnisse fixiert. Gleichwohl zeigte eine traurige Erfahrung, wie blutleer und
letztlich unkritische am Bestehenden vorbei ein auf Schulorganisation beschränkter Bildungsbegriff der Humboldtschen Prägung werden kann.
Und genau im Zusammenhang mit dieser historischen Erfahrung wird die zitierte
Passage besonders brisant: In ihr drückte Pestalozzi zwischen den Zeilen ja auch aus, dass er seine Didaktik
keineswegs dazu gedacht hatte, den Unterricht in der Institution »Schule« zu bestimmen. Vielmehr schwebte ihm vor, wie er an einer anderen Stelle sagte,
die Schule »beinahe überflüssig zu machen«. Von den Lehrern in der Schule meinte Pestalozzi: »Diesen mangelt das Fundament von tausend das Herz der Kinder anziehenden und
festhaltenden Umständen, deren Mangel sie den Kindern fremd […] macht.«15 Obwohl die von Pestalozzi angestrebte Verbindung des Lernens mit der Arbeit
nicht in Humboldts Konzept passte, entsprach der Grundtenor des Gedankens
jedoch der ursprünglichen Auffassung Humboldts: Bildend sei die »Mannigfaltigkeit der Situationen«, die durch einen zu hohen Grad an staatlicher Reglementierung gefährdet werde. Darum dürfe der Staat auch in Sachen Erziehung und Unterricht nicht ordnend eingreifen.
Als man Humboldt 1809 zum Preußischen Kultusminister machte, wurde er allerdings mit einer Realität konfrontiert, von der er nicht viel wusste. Und für diese Realität fand er kaum eine Handlungsanweisung in seinen vorher gefassten Überlegungen. Denn es gab eine sehr wohl reglementierte Schulwirklichkeit; die
Reglementierung ging jedoch nicht von einem zentralen Staat direkt aus, sondern
gleichsam indirekt von staatlich privilegierten Partikularmächten wie den Ständen, den Zünften oder den Kirchen.
Diese Realität im Visier, erlag Humboldt den Verlockungen der Macht, wenn auch bloß für sehr kurze Zeit. Humboldt wollte die Macht des zentralen Staats benutzen, um
den Unterricht den Klauen der Partikularmächte zu entreißen. Die Idee bestand darin, im ersten Schritt eine humanistisch und liberal
gesonnene Lehrerschaft in einer einheitlichen, keiner Partikularmacht
unterstehenden Schulorganisation herauszubilden, um dann den »geläuterten« Bürgern ein wahrhaft befreites Bildungswesen zur Selbstverwaltung zu überlassen. In Humboldts Worten hieß das, die Schulen »in die Hände der Nation« zu legen: das Kultusministerium, die sogenannte »Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts«, gleichsam unnötig zu machen.
Die für Humboldts Plan notwendige Lehrerschaft allerdings konnte man offensichtlich
nirgendwo antreffen. Die Lehrer waren im damals bestehenden System sozialisiert
worden. Für den Zweck, relativ schnell eine einheitliche Methode durchzusetzen, schien
Pestalozzis Volksbildungsvorstellung geeignet zu sein: Pestalozzi präsentierte eine Didaktik, die bestechend einfach war und dennoch auf dem Boden
der fortgeschrittensten philosophischen Grundlage stand, nämlich der von Immanuel Kant.
Mit dem Einsatz von der Pestalozzischen Methode, um eine rasche
Vereinheitlichung einer Lehrerschaft in einem viel-gestaltigen Bildungswesen zu
erreichen, verkehrt sich, so die These von mir, ihr Sinn: Während die Methode für einen Kontext geschaffen wurde, der Humboldts ursprünglichen »mannigfaltigen Situationen« entsprach, bekam sie nun die Funktion der Nivellierung und zentralen Kontrolle
von Situationen, in diesem Fall von Unterrichts- und Bildungs-situationen.
Heute wird gesagt, Humboldt habe als Kultusminister einen Praxis-Schock
erlitten, als er sah, wie übel die Elementarschulen gewesen seien, um deren Zustand er sich vorher nicht kümmerte. Im Brief an Goethe rechtfertigt er allerdings ohne Zweifel die damals gängige Praxis gegenüber der Pestalozzischen Methode. Die These von der Übelkeit der Schulen vor Errichtung zentralstaatlicher Schulen ist in allen
westeuropäischen Industrieländern im 19. Jahrhundert bemüht worden, um die Verstaatlichung voranzutreiben. Für England und Amerika gibt es inzwischen Untersuchungen, die nahelegen, es
handele sich um Ideologie.16 Für Preußen steht eine solche Untersuchung nach wie vor aus.
Neben der Verkehrung der Volksbildungsfunktion der Didaktik Pestalozzis findet
durch Humboldts Bildungsreform auch eine Verkehrung der sozialen Perspektive
statt. Oben habe ich Humboldt zitiert mit der Aussage, Bildung müsse den sozial Schwachen in seinen humanen Möglichkeiten entwickeln und ihn aus seiner Misere herausholen. Dies klang gegenüber Pestalozzis scheinbar konservativem Ziel, den Armen in seinem Kreise zu
belassen, sehr fortschrittlich. Im Kontext des Preußischen Schulwesens allerdings begegnet uns dann eine völlig andere Umsetzung. Denn das »Herausheben« des Armen aus seinem sozialen Verband bedeutete nicht, ihn zu einem anderen
Leben in der tatsäch-lichen Gesellschaft zu befähigen, vielmehr Abstinenz der Bildung vom Bezug zur Arbeit und zum
Zusammenleben. Die Beschäftigung mit den Kulturleistungen hieß nicht, dass der Arme an den Privilegien der Wohlhabenden beteiligt wurde,
sondern dass ihm der Unterricht nicht nützen sollte, einen besseren Status zu erreichen.
Dagegen stellte sich Pestalozzi vor, dass die von ihm unterrichteten Kinder
nicht ihren sozialen Kreis verließen, sondern in ihm ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weitergäben. Auf diese Weise sollte eine Gemeinschaft entstehen, die selbstbewusst in
der Lage ist, ihren eigenen Unterhalt mit Würde zu erarbeiten, ohne auf Maßnahmen der Wohlfahrt angewiesen zu sein. Eine solche Gemeinschaft wäre nicht abhängig von der Obrigkeit und brauchte sich dann auch von ihr nichts mehr gefallen
zu lassen.
So möchte ich behaupten, dass die Preußische Schulreform, die das Paradigma des Bildungswesens für die ganze Welt gesetzt hat, das Schlechteste aus Humboldt und Pestalozzi
realisierte: den Wunsch nach Einheitlichkeit und Homogenität. Dagegen bleibt das Bessere ihrer Gedanken, die Selbstbestimmung der Lernenden
und Lehrenden, bloß als utopischer Überschuss das Vermächtnis, welches uns daran erinnert, dass wir als Menschen dazu aufgerufen sind,
mehr zu sein als Marionetten staatlicher Organe. Allerdings ließe kein Gedanke sich verkehren, der das Verkehrte nicht schon als Keim in sich trüge.
1. Obwohl Pestalozzi »seine« verwilderten Kinder aufs höchste idyllisierte, schenkte er in seiner Methodenlehre dem Kind als
teilnehmendem und handelndem Wesen keine große Beachtung. (Heutige an Sozialisations- und Milieutheorien orientierte Lehren
tun das übrigens auch nicht.) Für ihn reduzierte der Unterricht, wie er selber bemerkte, sich auf »Gedächtniswerk«.17 Katharina Rutschky hat in ihrem Schreckenskabinett »Schwarze Pädagogik« die zunächst harmlos wirkende Einlassung Pestalozzis aufgenommen, »wer noch lernt, darf nicht urteilen«.18 Dass Lernen immer ein aktives Annehmen und damit auch Urteilen ist, kam
Pestalozzi nicht in den Sinn. Das macht den theoretischen Hintergrund aus, auf
dem er seine mechanistische Methode aufbaute. Humboldt verurteilte diesen Mechanismus. Aber für den Kontext der Staatsschule war er einfach unwiderstehlich ideal.
2. Das uneingeschränkte Engagement Pestalozzis für seine Kinder ist auf der einen Seite rührend, geradezu heroisch. Im Stanser Brief heißt es: »Meine Tränen flossen mit den ihrigen, und mein Lächeln begleitete das ihrige. […] Ich war am Abend der letzte, der ins Bett ging, und am Morgen der erste, der
aufstand«. Diese absolute Aufopferung konnte jedoch auch in ein Allmachtsgefühl umschlagen: »Alles, was ihnen an Leib und Seele Gutes geschah, ging aus meiner Hand«, behauptete Pestalozzi. Daraus leitete leicht sich die Vorstellung ab,
seinerseits alles zu dürfen. So findet sich im Stanser Brief eine unglaubliche Bemerkung: »Ich forderte unter anderem zum Scherz, daß sie [die Kinder] während dem Nachsprechen dessen, was ich vorsagte, ihr Auge auf den großen Finger halten sollten.« Ich frage mich, was den Erzieher berechtigt, etwas »zum Scherz« zu »fordern«, d.h. etwas, das sich nicht begründen lässt.19
3. Die Stellung Pestalozzis zum Staat ist von tiefen Widersprüchen durchzogen. Einerseits verfolgte er gern das Bild vom Staat als Verlängerung des Hausvaters oder als ein Stellvertreter von dem Vatergott,
kritisierte er den Liberalismus, »der die Gewalt schwächt« und »den schwachen Staat notwendig an die äußersten Abgründe führt«. Andererseits findet Pestalozzi, dass sich »Macht und Sittlichkeit widersprechen«, und betont bisweilen, dass der Staat als Staat »in seinen wesentlichsten Einrichtungen bestimmt wider das Christentum« handelt.20 Da Pestalozzi auf systematische Ausarbeitungen keinen Wert legte, hat er diesen
Gegensatz nie überbrückt. Humboldt konnte sich durchaus in den staatskritischen Äußerungen Pestalozzis wiederfinden. Die preußische Lehrerschaft jedoch verehrte in Pestalozzi den Vorreiter einer Auffassung
vom Staat als den »großen, wohltätigen Erzieher«.
Pestalozzi hat die Bedeutung der kindlichen Aktivität für den Lernprozess nicht eingesehen. Das macht den Erzieher zu einer Instanz, die
geschickt die Kinder auf gewünschte Ziele hinlenken, ja sogar manipulieren solle und auch dürfe. Diese Vorstellung, dass der Erzieher genau wisse, wie die Kinder und die späteren Erwachsenen sein sollten, erzeugt nahezu unweigerlich den Wunsch, dass das
gesamte Leben durch die Instanz des Staats in angeblich richtige Bahnen gelenkt
werde. Und in seinen sexualpädagogischen Schriften träumte Pestalozzi von »Gewissensbeiräten« und »Sittengerichten«, die alle schwangeren Mädchen in ihre Obhut nähmen.21 Die Erfahrung jedoch lehrte Pestalozzi, dass der Staat nicht die hehren Ideale
der Aufklärung oder die des Christentums verwirklicht, sondern reinen Machtinteressen
folgt. Am Ende steht dann Kulturpessimismus: Die Menschen verhalten sich nicht »von allein« im Sinne des Volkserziehers, sie können aber auch nicht durch den Staat dazu gebracht werden, weil der Staat nur
seine eigenen Interessen wahrt. Darum scheint die Menschheit verloren zu sein.
Wenn wir nicht in dem Pestalozzischen Kulturpessimismus münden, aber ebensowenig uns der Kritik an bestehenden Zuständen entsagen wollen, müssen wir die entscheidende Voraussetzung bei Pestalozzi korrigieren. Dies können wir mit dem frühen Humboldt tun: Die Aufgabe des Aufklärers und des Volkspädagogen ist es nicht, genau zu bestimmen, wie die Menschen zu sein haben, um in
Freiheit ein gutes Leben zu führen. Vielmehr ist es die Aufgabe, diejenigen Behinderungen aufzuheben, die die
Menschen erfahren, wenn sie ihre Vorstellungen vom guten Leben verwirklichen
wollen – diese Behinderungen aufzuheben, um eine soziale Situation herbeizuführen, in der durch »Mannigfaltigkeit« sich das Beste herauszubilden vermag.
Dies freilich formulierte, unübertroffen, der alte Kant 1793:
»Ich gestehe, daß ich mich in den Ausdruck, dessen sich auch wohl kluge Männer bedienen, nicht wohl finden kann: ein gewisses Volk […] ist zur Freiheit nicht reif. […] Nach einer solchen Voraussetzung aber wird die Freiheit nie eintreten; denn
man kann zu dieser nicht reifen, wenn man nicht zuvor in Freiheit gesetzt
worden ist (man muß frei sein, um sich seiner Kräfte in der Freiheit zweckmäßig bedienen zu können). Die ersten Versuche werden freilich roh, gemeiniglich auch mit einem
beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande verbunden sein, als da man noch unter den Befehlen, aber
auch der Vorsorge anderer stand; allein man reift für die Vernunft nie anders als durch eigene Versuche (welche machen zu dürfen, man frei sein muß).«22