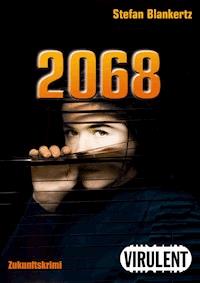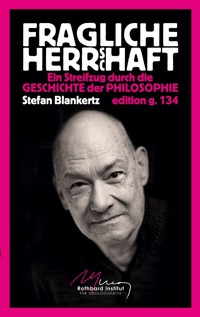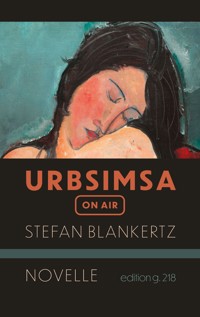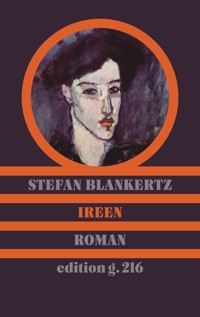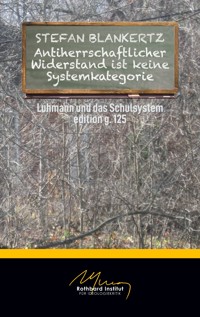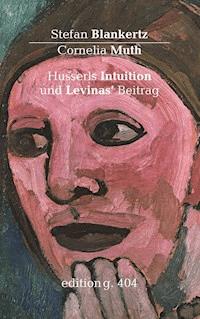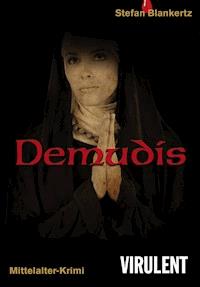
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Mittelalter live miterleben – von junger Liebe bis zur Inkontinenz des greisen Magisters Albertus, von tief empfundener Barmherzigkeit bis zu brutaler Verfolgung Andersgläubiger, vom opulenten Fressgelage bis zum kargen Fastenmahl, von großer Heilkunst bis zu gefährlicher Quacksalberei: Der genau recherchierte und detailliert nachgezeichnete Alltag des Hochmittelalters im 13. Jahrhundert bildet den Hintergrund für Stefan Blankertz' Mittelalterkrimis. El Arab ist der Spitzname für Sultan Ibn Rossah. Er ist arabischer Gelehrter, Arzt, Erzieher und Abenteurer. Seiner Herkunft nach Jude, ist er zum Islam übergetreten, aber verehrt auch herausragende christliche Philosophen. In seinem verzweifelten Kampf um ein "Land der Sonne", in welchem alle Religionen friedlich nebeneinander leben können, verschlägt es ihn bis nach Köln. Dort nehmen die Kriminalfälle ihren Ausgang. El Arab bleibt freilich ein Held zum Anfassen: Er ist keineswegs ohne Fehl und Tadel. Alle Kriminalfälle werfen die Frage nach dem Verhältnis von Toleranz und Recht im Umgang miteinander auf. Eine Frage, die heute nicht weniger wichtig ist als ehedem. BAND 4: DEMUDIS … Meister Eckhart … Ketzer?… Mörder? … die Beginen … Heilige? … Huren? Himmlische Visionen … irdische Leidenschaften … höllische Intrigen … Ist der verehrte Meister Eckhart, ein weiser Dominikanermönch, in Wahrheit ein Lüstling, der sogar vor Mord nicht zurückschreckt? Schwester Demudis aus dem Beginenkonvent Bela Crieg in Köln steht im bitterkalten Jahresanfang 1327 vor einer ebenso unangenehmen wie schier unlösbaren Aufgabe, die ihr von ihrer Magistra übertragen wurde. Was hatte die Ermordete auf dem Weg nach Riehl zu suchen, wo sie ihr Schicksal ereilte? Die Ermittlungen von Schwester Demudis führen sie durch Tiefen und Höhen des Lebens und des Glaubens im beginnenden 14. Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Blankertz
DEMUDIS
Ein Krimi aus dem Mittelalter
Köln im 13. Jahrhundert
Von Köln nach Mainz Anno 1327
PERSONEN
Die zwölf Beginen im Hause Bela Crieg, Stolkgasse
Angela, Witwe
Beatrix Jude, Witwe, geschäftstüchtig
Godelivis, Jungfrau
Guta, entlaufene Braut
Demudis, Witwe
Dideradis von Falkenburg, Witwe
Hardrun von Aren, entlaufene Ehefrau, asketisch
Jutta von der Mühlengasse, Witwe
Lora Overstolz, Witwe
Mentha von Kastilien, Halbschwester von *Eleonore von Kastilien .(1240–1290), Kreuzfahrerin, Witwe, ehemalige »Schwester des freien Geistes«
Sela Kone, Witwe des Juden Baruch Levi, Magistra .(Vorsteherin des Konventes)
Sophia von Limburg, Witwe
Brüder im Predigerkloster, Stolkgasse
Ansgar, Physikus
*Eckhart, Johannes .(1261–1328), von seinen Brüdern »Meister«, von seinen Schwestern »Hechard« genannt
Einhard, Torwächter
Frulof, Torwächter
Johannes von Köln .(1252–1329), Mönch mit Schweigegelübde
*Hermann de Summo, Student der Theologie, Zeuge der Anklage bei der Inquisition
Hinkmar, Torwächter
*Nikolaus von Straßburg .(† nach 1331), Verteidiger bei der Inquisition
Norbert, Abt
*Seuse, Heinrich .(1295–1366), Schüler von Eckhart
*Tauler, Johannes .(1300–1361), Schüler von Eckhart
*Wilhelm Nidecke, Student der Theologie, Freund von Hermann
Brüder im Barfüßerkloster, Rorengasse
Agelomus von Luxenil, Ankläger bei der Inquisition
Dirolf von Michelsberg, Stellvertreter von Hanß, Ankläger bei der Inquisition
Dudo, Begleiter von Hanß
Hanß von Mondorf, Abt
Ruotger, Bote von Dirolf
Thietmar, Torwache
Weitere Personen
Anna, Magd in Katzenelnbogen, Nennschwester von Martin
Ellikint, Hure auf dem Berlich, ehemalige »Schwester des freien Geistes«
Engelradis von Berg, Witwe Adolf von Riehls
*Heinrich II. von Virneburg .(1244–1332), Erzbischof von Köln
Irmgard, Magd auf der Burg von Katzenelnbogen
Jakob, ein Schyssfeger
Liutprand, Predigermönch in Koblenz
Lucgard, Begine in Koblenz
Martin, Knecht in Katzenelnbogen
Mathilde von Berg, Begine in Koblenz, Base .(Kusine väterlicherseits) von Guta
*Matthias von Bucheck .(1275–1228), Erzbischof von Mainz
Paul, Abt des Barfüßerklosters in Andernach
*Walter von Ketwich, Notar
Walram von Katzenelnbogen, Graf mit Bürgerrechten in Köln
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, einige sind es nicht. Schriften damaliger Autoren werden sinngemäß, nicht wörtlich zitiert. Der Anhang enthält ein Glossar. Historische Personen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Darstellung ihres Verhaltens und ihres Charakters im Roman entspricht jedoch nicht in jedem Fall der Überlieferung.
»Je heißer die Seele bleibt, umso schneller schlägt sie Funken:Je mehr sie brennt, umso herrlicher leuchtet sie.«
Mechthild von Magdeburg
»Hüte dich vor dir selbst, so hast du wohl gehütet.«
Meister Eckhart
Inhalt
Köln im 13. Jahrhundert
Von Köln nach Mainz Anno 1327
Personen
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Nachwort
Glossar
Impressum
E-Books von Stefan Blankertz
Weitere Mittelalter-Krimis
Urban-Fantasy-Roman
KAPITELI
»Die freie Minne muss stets das Höchste am Menschen sein.«
Mechthild von Magdeburg
Ihrem Herrn, ja vielmehr Vater!Ihrem Friedel, vielmehr Bruder!Seine Magd, nein, seine Tochter!Seine Buhle, nein, seine Schwester!Ihrem Ein und Alles!
Der neuerliche Ruf, den du mir über deinen getreuen Knecht hast überbringen lassen, ehrt mich mehr, als ich es verdiene, und rührt mich tiefer, als ich es ertragen kann.
Wenn es dich, wie du schreibst, nunmehr reut, dass du mich hast gehen lassen und mir diesen Ort bei den Beginen in Köln anwiesest, und mich um dessentwegen dringend aufforderst, in deine mir ach so vertrauten Arme auf immer zurückzukehren, die für mich weit offen stünden, aber nicht als Buhle, sondern als deine dir rechtmäßig angetraute Gattin, so verschweigst du, dass ich es selbst war, die es so bestimmt hat. Und klingt es auch befremdlich, dass das Weib, nein die Magd, dem Manne, nein dem Herrn, den Weg weiset, so verstoßen wir dergestalt nicht minder wider die natürliche Ordnung der Dinge als mit unserer verbotenen Liebe schlechthin.
Dass ich dir von den Gründen, um derentwillen ich dein Eheweib nicht werden kann, wie ich dir oftmals schon unter Sturzbächen heißer Tränen beteuern musste, den durchaus wichtigeren Teil nicht offenbaren kann, nimm selbst als weiteren Grund, denn ein Eheweib darf kein Geheimnis gegen ihren Ehemann in ihrem Herzen tragen.
Aber sollten wir uns unsere Minne nicht bewahren, anstatt dass ich unter deiner Eifersucht zu leiden hätte und du unter meiner Streitsucht, so wie es nach aller Erfahrung unvermeidlich zu sein scheint, wenn zwei Menschen von der Minne zur Ehe schreiten? Ist es vermessen, wenn ich von dir verlange, dass du mich lieben sollst, ohne jedoch dabei irgendein Recht zu beanspruchen, außer dem der Gunst und der Freiheit? Sollte es dir nicht als Zeichen meiner übergroßen Liebe und Sehnsucht nach dir gelten, dass ich wünsche, du seiest und bliebest dein eigener Herr, völlig frei, ohne dich zu binden? Willst du nicht glauben, dass ich unmissverständlich daran festhalte, die Minne könne ihre Kräfte nicht bei einem Ehepaar entfalten, weil das, was es sich gegenseitig gewährt, nicht mehr freiwillig ist?
Erfülle mir, o mein Herr, noch diese letzte Bitte, dir ins Gedächtnis zu rufen, dass du mich nur darum besitzen konntest, weil ich dem drohenden Kerker der Ehe mich durch Flucht entzogen habe.
Wenn du mich nach diesen offenen und zugegebenermaßen für deine Magd ungehörigen Worten nicht mehr wiedersehen wolltest, würde es mir die Eingeweide aus dem Leibe reißen, aber ich könnte es verstehen, mehr noch als wenn du mich, was ich mit allen Fasern meines Leibes herbeisehne, triffst, wo wir Himmel und Hölle zugleich zu finden pflegten und auch, so es deinem süßen Willen entspricht, weiter finden werden. Das wäre mehr wert, als wenn wir unsere Liebe verlören, um unsere Qualen durch eine Eheschließung zu beenden – sei versichert, dass ich unter den Bußen, wie mir mein Beichtvater für die Sühnung meiner Schuld vor Gott auferlegt, nicht weniger leide als du, weil du meine Abwesenheit nicht erträgst.
Nun entscheide also, wie immer du dich entscheiden musst, und teile mir mit, wie immer deine Antwort ausfallen mag.
Gegeben durch Schwester Guta vom Beginenkonvent der Bela Crieg in der Stolkgasse zu Köln, am 25.3.1299
*
Johannes Eckhart, den seine Predigerbrüder »Meister« und seine Schwestern »Hechard« nannten, spürte, dass die Begine zitterte. Dabei sah er nicht einmal ihren Mund. Sie hielt ihn ein wenig von der Öffnung im Beichtstuhl entfernt, wie wenn sie eine zu große Nähe fürchtete. Es war ihm aber, als versetze das Weib das Holz ganz leicht in Schwingungen. Trotz seines hohen Alters ließ ihn das nicht kalt. Nie ließ es ihn kalt. Er hatte Mitleid mit der Seele, noch bevor sie zu sprechen begann. Vom Herrn erbat er sich die Kraft, ihr helfen zu können, ganz gleich, was es für Vergehen sein mochten, die eine derartige Erregung in ihr auslösten.
»Meine Tochter, wer bist du?«, fragte er und versuchte, seiner Stimme einen besänftigenden Ton zu verleihen.
Stille. Keine Antwort. Nur ein kaum vernehmbares Geräusch wie ein stark unterdrücktes Räuspern.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie nach einer geraumen Weile.
Das hatte er nicht erwartet. »Warum weißt du es nicht?«
»Weil ich weder Mädchen bin noch Weib, ehrwürdiger Vater, weder Mann noch Magd noch Frau«, sagte die Begine.
»Deine Worte klingen wundersam in meinem alten Ohr, liebe Tochter«, sagte Eckhart angerührt. »Erkläre mir genauer, was du meinst.«
»Wäre ich ein Mädchen … so würde ich noch unschuldig sein. Wäre ich ein Weib … so würde ich Gott in meiner Seele gebären. Wäre ich ein Mann … so könnte ich allen Sünden widerstehen. Wäre ich eine Magd … so würde ich meinem Herrn ohne Widerrede dienen. Wäre ich aber … eine Frau, so würde ich …« Sie unterbrach ihre eh schon stockende Rede und setzte dann aufs Neue an. »Vater, mir ist weh ums Herz … und … ich möchte nicht, dass Ihr Euch wider mich … mich erschreckt … da es noch nie zuvor an Euer heiliges Ohr gedrungen ist«, fuhr sie zögernd mit bebender Stimme fort. Die dazugehörige unsichtbare Person mochte, schätzte Eckhart, der ein erfahrener Beichtvater war, nicht mehr jung sein, jedoch gute zwanzig Jahre jünger als er selbst.
Eckhart fühlte, wie ihn das Licht durchströmte und er sie auf diese Weise nicht weitersprechen lassen konnte. »Schwester«, sagte er mit seiner tiefen, etwas schleppenden Stimme, »wenn es dir gestattet ist, deinen Herrn als ›Bruder‹ anzureden, sollst du es dergestalt auch mit mir halten, der ich nicht weniger ein Sünder bin, als du es bist, und nur durch die überfließende Gnade des Herrn dazu auserkoren, Ihm mein Ohr zu leihen.«
Da er dies gesagt hatte, war ihm, als pulsiere all sein Leben in seinem Ohr, das zu glühen begann. Er fühlte sich, als sei sein Geist aus dem Körper getreten und könne sich solcherart selbst auf dem harten Beichtstuhl sitzen sehen, wie er reglos zwischen den aus dunklem Holz gedrechselten Säulen mit den wachsamen Engeln eingeklemmt war. Weder konnte er mit seinen anderen Sinnen empfinden, noch verfügte er über eine Erinnerung an irgendetwas in seinem Leben. Also wähnte er sich in der Lage, vollkommen von sich abzusehen. Er wusste nun, dass er bereit war.
»… wäre Schwester Guta, wie man mich nämlich heißt, eine Frau, so hielte sie also ihrem lieben einzigen Gemahl die Treue«, vollendete die Begine ihre unterbrochene Selbstanklage.
»Sag mir, wie es dir geht, liebes Kind«, forderte Eckhart.
»Es geht mir übel. Mir sind Himmel und Erde zu eng«, seufzte Schwester Guta.
»Sag mir ein Wort darüber«, beharrte der Beichtvater.
»Es gibt da einen Mann«, hörte das Ohr Schwester Guta endlich flüstern, »dessen Minne mir mehr bedeutet als die meines Herrn Jesus Christus.« Obwohl er gedämpft gesprochen war, hörte sich der Satz wie leicht dahingeplaudert an. Er war gewachst und glänzend poliert wie die Säulen am Beichtstuhl. Sein Inhalt konnte deshalb nicht der Grund sein, schloss Eckhart, warum sie so sehr von Angst erfüllt schien.
»Wir wollen beten«, sagte er nach einer Pause, »beten, dass es nicht deine Minne ist, die deinem Friedel zufliegt, noch die seinige, die dich umgarnt, sondern dass das ewige fließende Licht der Liebe des Herrn euch durchfluten möge.«
Eckhart wartete geduldig auf eine Antwort. Als er sie schließlich vernahm, deuchte es ihm, dass der Ton eine Spur an Schärfe enthielt:
»Dafür, dass ich unkeusch war, Vater …«, sie unterbrach sich hastig, »nein: Bruder, welche Strafe erlegst du mir auf darob?«
Dass Eckhart sich ein fast schon abschätziges Lächeln erlaubte und das Haupt langsam schüttelte, konnte Schwester Guta natürlich nicht sehen. Vielleicht jedoch erahnen? Eckhart hoffte, dass dies nicht geschehen würde, denn es war eine Geste, die seinem eigenen sündigen Hochmut geschuldet war, den er all die Jahre nicht zu unterdrücken vermocht hatte.
»Weiter sage ich: Du erwartest die Strafe, meine Tochter.«
»Ja«, hauchte sie, »mit ganzem, freudig erregtem Herzen.«
Eckhart fuhr unbeirrt fort: »Darüber hinaus sage ich: Alle die Pfaffen, die vor mir das offene Ohr des Herrn für dich hätten sein sollen, haben dir gar schreckliche Strafen auferlegt, um dein sündiges Fleisch zu züchtigen.«
Obwohl Eckhart seine Stimme am Ende des Satzes nicht gehoben hatte, antwortete Schwester Guta, als sei es eine Frage gewesen: »Ja, Bruder.«
Eine ärgerliche Stirnrunzel zeigte sich senkrecht in dem zerfurchten Gesicht des Alten. »Und dies also muss ich nämlich betrübt feststellen: Du hast es genossen. Die Angst davor und die Züchtigung danach hast du gekostet wie ein Labsal!«
»Ist es uns nicht aufgetragen, voll unbändiger Freude die von allumfassender Liebe getränkte Zurechtweisung des gerechten Herrn zu erwarten?«, begehrte Schwester Guta auf, wie Eckhart meinte, denn er erkannte den trotzigen Klang in ihrer Stimme.
»Nein«, beschied er mit überaus scharfer Zunge. »Sich an der Pein zu ergötzen, das ist die wahre Unkeuschheit.«
»Und wahre Keuschheit, was dawider wäre dieselbe?«, fragte Schwester Guta wissbegierig, anscheinend unberührt von seinem Tadel.
»So zu sein, wie du warst, bevor du da warst, das ist wahre Keuschheit«, erwiderte Eckhart und fand zu seiner gewohnten Milde zurück. »Bloß dieserart kannst du den Herrn in dir empfangen. Zuerst also jungfräuliche Keuschheit, dann allerdings musst du auch ein Weib sein, damit Gott in dir fruchtbar werde. Darum ist ›Weib‹, nicht Frau, das edelste Wort, das man zur Seele sagen kann, denn allein durch die Fruchtbarkeit, die der jauchzenden, alles erquickenden Vereinigung in der Minne folgt, zollt der Mensch dem väterlichen Herzen Gottes Dank.«
»So … lebe ich nicht … nicht in Sünde?« Die Erleichterung in der Frage Schwester Gutas berührte Eckhart unangenehm. Solche Überheblichkeit zu bändigen war das ihm auferlegte Kreuz, schon damals, als man ihn vor fast zehn Jahren als Stellvertreter des Ordensgenerals nach Straßburg berufen hatte, um dort die Seelsorge für die in ihrer brennenden Gottesminne bisweilen über die Stränge schlagenden Beginen zu übernehmen und sie vor der Gefahr der Ketzerei zu bewahren.
»Schwester Guta, dir gebricht es an Demut!«, donnerte er, wie er sich sofort zerknirscht eingestehen musste, ein wenig zu laut. Er hielt inne und zwang sich, um hernach ruhiger weiterzusprechen, und es gelang ihm, indem er die passenden Worte wählte: »Wohingegen du demütig lieben solltest, wie ich gesagt habe, ob es nun der Herr sei oder dein Friedel: Es dürfte nicht deine Minne sein, sondern die Gottes durch dich. Nimm dieses Wort demütig an als die dir von Ihm zuerkannte Strafe. Dies möge dir in seiner Güte der gewähren, der in vollkommener Dreieinigkeit lebt und regiert: Gott von Ewigkeit in Ewigkeit. Amen.«
*
Auf den Tag genau vier Jahre später erinnerte sie sich an diese erste Beichte bei Hechard. Seitdem hatte er vor allem auf ihren gemeinsamen Wanderungen nach Koblenz alle menschenmöglichen Mühen obwalten lassen, bei ihr den Glauben zu stärken, dass Liebe und Wahrheit in Gott keinen Widerspruch darstellen. Sie solle die Liebe nicht aufgeben, aber zur Wahrheit finden. Sie hatte diesen Weg nie eingeschlagen, weil sie die Folgen nicht tragen wollte – aus, wie Hechard nicht müde wurde, mit sanftem Nachdruck zu sagen, Mangel an Glauben.
Bis itzt. Doch itzt war es zu spät gewesen, wie sie schmerzlich zu spüren bekam, als sich die kalten Finger ihres Peinigers um ihren Hals legten. Die Bilder ihres Lebens liefen in rasender Geschwindigkeit vor ihrem inneren Auge ab, während ihr die Luft langsam ausging. Hatte sie bisher daran festgehalten, dass es die unwiderstehliche Minne war, mit der sie die Menschen um sich herum unglücklich gemacht hatte, musste sie in diesem Augenblick, als des Lebens ganze Wucht sie eingeholt hatte und ihm das Ende bereiten sollte, erkennen, dass es sich wirklich verhielt, wie Hechard ihr wieder und wieder zu bedenken gegeben hatte: Der Mangel an Wahrheit war ihr Unglück, beruhend auf einem Mangel an Glauben. Der Glaube hätte Liebe und Wahrheit zu einer guten Wirklichkeit fügen können, wie Hechard es lehrte. Hätte.
Sie wunderte sich, dass sie keine Todesangst empfand. Nachdem sie erkannt hatte, wer ihr Richter war, schaffte sie es vielmehr sogar, ihm einen mitleidigen Blick zuzusenden, denn auch er würde in der zwischen Liebe und Wahrheit zerrissenen Wirklichkeit, ihre Wirklichkeit, sein Schicksal finden. Schon bald.
»Vergib mir, Paul«, stöhnte sie, und ihre Seele trennte sich von ihrem Körper. Sie hatte keine Gegenwehr geleistet.
Ihr Meuchler hielt den Hals der toten Schwester Guta noch eine kleine Weile im festen Würgegriff, bevor er ihren entseelten Körper in den Schnee gleiten ließ. Er schaute sich verstohlen um, denn daran hatte er in seiner Raserei nicht gedacht, dass er nämlich bei seiner Meucheltat hätte beobachtet werden können. Nachdem er sichergestellt hatte, dass das nicht der Fall gewesen war, machte er sich befriedigt von dannen. Durch das Gewissen wollte er sich nicht beißen lassen. Noch nicht.
KAPITELII
»Minne sonder Erkenntnisdünkt die weise Seele Finsternis.«
Mechthild von Magdeburg
Nein, nicht noch einen Humpen von dem erzbischöflichen Kirschbier, stark, schwarz und süß, so herrlich es auch riechen und so köstlich es auch munden mochte. Mehr fasste Wilhelms Magen beim allerbesten Willen nicht, auch wenn der inzwischen einiges gewohnt war. Er fühlte sich randvoll abgefüllt. Sein hartnäckiger Freund ließ aber nicht locker.
»Einen noch, Bruder Wilhelm«, bettelte Bruder Hermann aufgekratzt, »damit dein Fiedelbogen macht, als wie du ihn heißt.«
Wilhelm gewahrte, dass sich das wundervolle Bier bei Bruder Hermann in schlechten Atem verwandelt hatte, und verzog angewidert das Gesicht. Sein eigener Atem würde wohl nicht besser sein.
»Weitere Sünden?«, lallte er in schwacher Gegenwehr. Sein schwerer Kopf dröhnte ihm, und er nahm das Wirtshaus bloß verschwommen wahr. Es roch muffig in der engen Stube. Vereinzelt züngelten kleine blaue Flammen aus der Glut, wie um sich gegen das unvermeidliche Sterben des Feuers aufzulehnen. Erbarmungslos kroch die Kälte durch die allzu zahlreichen Ritzen der Wände. Wilhelm aber spürte nichts davon. An der Tür, die windschief im Rahmen hing, war auf dem Boden verschüttetes Bier schon gefroren. Nur ganz flüchtig streifte Wilhelm der Gedanke, dass sie, wenn sie denn gingen, aufpassen mussten, dort nicht auszugleiten. Kaum noch andere Gäste befanden sich im Raum. Wilhelm konnte nicht genau ausmachen, ob überhaupt noch welche da waren. Ellikint, die Wirtin von geheimnisvoller Schönheit, wollte schließen. Das wusste er. Sie legte mit deutlich vernehmbaren Klappern den Deckel auf das verbliebene Fass Bier, das neben dem Feuer stand, um es lecker warm zu halten. Auch entzündete sie keine weitere Kerze, und nachdem die vorletzte verloschen war, flackerte nur noch eine vor Hermann und verbreitete den angenehmen Duft von Bienenwachs, den Wilhelm so liebte. Mit einer schnippischen Drehung ihrer Schulter griff Ellikint nach dem letzten Stück Käse, das auf dem Tisch von Hermann lag. Hermann war jedoch schneller und stopfte es sich in den Mund.
Schluss machen, hallte es Wilhelm im Schädel. Was für ein Leben! Ellikints Mägde Gepa und Junta, eine erschien dem bierseligen Blicke betörender als die andere, kauerten dicht beieinander im hinteren Dunkel, wohin sie sich zurückgezogen hatten, denn sie hofften wohl eher, dass sie keine Geschäfte mehr machen würden … Ach ja, Geschäfte, Bruder Hermann zahlte ja gar kein Bettgeld. Das musste einen Grund haben, welcher ihm aber entfallen war. Oder hatte Bruder Hermann ihm den Grund gar nicht anvertraut?
»Sie werden uns abgelassen, die Sünden, alle Sünden, darunter auch die schwersten! Hast du das vergessen, stumpfer Pickel?« Bruder Hermann puffte ihn kräftig und verschluckte sich an dem Käse. Beduselt, wie er war, hatte er zu heftig zugestoßen. Schwer wie ein nasser Sack fiel Wilhelm von dem groben Brett, das ihnen als Sitzgelegenheit diente. Wilhelm hatte wie stets, wenn er mit Bruder Hermann hier verweilte, ganz am Rand gesessen, mit bloß einer Arschbacke auf dem Brett, und war auch nicht weiter in die Mitte gerutscht, nachdem sich die Reihen der Gäste gelichtet hatten.
»So viel Stunden zählt kein Tag«, heulte Wilhelm auf den modrigen und verdreckten Bodendielen liegend, »als dass wir die Sünden beichten könnten, die wir begehen.«
»Elender Jammerlappen«, brachte Bruder Hermann zwischen Husten hervor und einige Käsekrümel flogen im hohen Bogen durch die Luft. Einer traf direkt in Wilhelms Auge, der Rest ging zu Boden und kullerte in die Spalten. Dort würde der Käse vergammeln und den Kriechtieren als Speise dienen. Nachdem Bruder Hermann ausgekeucht hatte, bückte er sich und griff Wilhelm fest in die Kutte, zog ihn hoch und warf ihn Gepa in die Arme.
Wie stark er doch ist, dachte Wilhelm bewundernd, fast wie ein stolzer Ritter voll männlichem Saft, ich wiederum bin ein fetter, wabbliger Mönch. Wenn es Bruder Hermann gestattet wäre, sein dunkles Haar und seinen kräftigen Bart wachsen zu lassen und fürstliche Kleider zu tragen, würde er einen stattlichen Helden abgeben. Er könnte Drachen töten, anstatt seine strahlend blauen Augen beim Lesen von Buchstaben zu verderben; könnte zur Erbauung des Volkes das Herz einer anmutigen Prinzessin im Sturm erobern, anstatt sich heimlich der Huren bedienen und dafür schämen zu müssen.
»Mach, das er diese Nacht nicht vergisst«, befahl Bruder Hermann Gepa, »trotz des zu viel genossenen Bieres. Schließlich muss er morgen vor dem Erzbischof eine ausgezeichnete Figur machen.«
Sich in ihr Schicksal fügend nahm Gepa Wilhelm in Empfang. Sie stützte ihn, damit er es die Treppe hinauf in die Kammer schaffte. Als sie bei Junta vorbeikamen, flüsterte sie ihr etwas zu, doch Wilhelm konnte nicht erfassen, um was es ging.
Wilhelm wusste genau, was er sagen wollte. Aber es war schwierig, den Mund dazu zu bewegen, es auch kundzutun.
»Freundschaft«, brabbelte er schließlich. »Ist sie nicht das herrlichste Geschenk des … des Herrn?«
Gepa legte Wilhelm sanft auf das wacklige Bett mit den einst sorgsam gedrechselten Seiten, die nun jedoch abgestoßen und grau waren. Sie deckte ihn mit einem zerschlissenen Kissen zu, aus welchem das Stroh quoll. Wilhelm merkte erst jetzt, dass er zitterte, anscheinend also frieren musste, und war ihr dankbar. Es war der härteste Winter, seit er denken konnte, und die Älteren, deren Gedächtnis noch weiter zurückreichte, wussten auch kaum von einem schlimmeren Wüten der Kälte, ausgenommen jenes schreckliche Jahr des Herrn 1316, in welchem so viele Menschen erfroren oder verhungert waren. Das warme Bier benebelte die Sinne, konnte den Leib dennoch nicht lange betrügen.
»Ein bisschen raubeinig ist er ja, dein Freund«, sagte Gepa und streckte ihre Füße zu Wilhelm unter die Decke. »Aber na ja. Weißt du, Junta ist auch so eine. Immer borgt sie sich ein paar Pfennige von mir und gibt sie nie zurück, als hätte ich genug davon. Aber jetzt, da kann ich mich auf sie verlassen. Sie wird Hermann so trunken machen, dass er nicht hereinkommt mit ihr und Acht gibt, dass du tust, was er von dir erwartet. Ich kann mich auf sie verlassen. Sie ist meine Freundin. Und er ist dein Freund.«
Ich meinte nicht ihn, dachte Wilhelm, ich meinte dich. Oder euch. Er vergaß aber, es laut auszusprechen.
Gepa kicherte. Dann nahm sie vorsichtig seinen Arm und strich ihm sanft über den Ellbogen. »Tut es weh, wo du draufgefallen bist?«
Sie ist so gut zu mir, dachte Wilhelm. Gepa trug ein gelbes Tuch um den Kopf, derart locker jedoch, dass ihre dicken braunen Haare überall herauslugten. Ihr Gesicht war weiß und fast ebenmäßig. Doch die Härte des Lebens zeichnete sich scharf in ihre Züge ein. Die Lippen schimmerten blau, Wilhelm wusste aber, wie rot sie im Sommer strahlten. Er mochte das Funkeln in ihren dunklen, unergründlichen Augen. Der Kälte wegen hatte sie viele löchrige Kleider übereinander gezogen; so weit er es erkennen konnte, keines in einer anderen Farbe als Gelb, wie es ihr Stand nach dem weisen Ratschlusse der Stadtväter gebot. Der viele Stoff machte ihre Formen fließender und man konnte kaum erahnen, dass ein kräftiges, fast kantiges Weibsbild darunter verborgen war. Wilhelm erinnerte sich gut an das feste Fleisch ihrer Hüften. Verborgen. Das sollte es auch bleiben, heute. Bald werde ich Magister der Theologie, frohlockte Wilhelm. Was habe ich bloß dieserorts zu schaffen? Muss Gott nicht einen solchen Heuchler wie mich bestrafen? Wenn er es aber nicht tut … na, dann ist er halt selbst Schuld. Sagte der Meister Eckhart nicht immer wieder, es komme nicht auf die äußeren Werke an, sondern auf die inneren? Und dass sich im Bösen Gottes Herrlichkeit ebenso zeige wie im Guten?
»Bei den Barfüßern in Aachen«, setzte Wilhelm seinen Gedanken nun laut fort, »wo ich als Waise aufgewachsen bin, habe ich hungern müssen um des Herrn willen. Als sich der elfte Finger aufzurichten begann und manchmal des Nachts … du weißt schon, was, tat …«, Gepa nickte, und Wilhelm nahm es als Zeichen, dass er das Peinliche nicht auszusprechen musste, »habe ich Schläge bekommen. … wurde hierhergeschickt, weil ich einen starken Geist habe … doch mein Fleisch ist schwach … ist es umgekehrt, hier ist es umgekehrt, hier bekomme ich Schläge … von meinem Freund, umgekehrt, wenn ich …« Wilhelms Rede löste sich ins Unverständliche auf. Alles drehte sich in seinem Kopf.
Wie von weiter Ferne hörte er nach einer Weile, in der er völlig weggetreten gewesen zu sein schien, dass Gepa fragte: »Was sollte ich anstatt dessen tun?«
Wahrscheinlich hat sie mir die Geschichte ihres Lebens und Leidens erzählt, dachte Wilhelm, aber ich habe sie nicht mitbekommen. Was soll ich jetzt tun?
»Hast du schon mal daran gedacht, dich den Beginen anzuschließen?«, fragte er und hoffte, dass sie das als Antwort auf das nehmen konnte, was sie gesagt hatte.
Wilhelm sah, wie sich Zornesröte auf dem Gesicht von Gepa ausbreitete. Wie hübsch sie doch ist!, dachte er.
»Dafür muss man im vierzigsten Jahr stehen«, schnaubte sie.
Ja, Wilhelm entsann sich der neuerlichen Verfügung des garstigen Herrn Erzbischofs: Nur Weiber, die mehr als vierzig Lenze zählten, sollten sich den Laienschwestern anschließen dürfen, die ein armes und keusches Leben im Dienst des Herrn führten, vornehmlich Witwen. Der ehrwürdige Vater wird schon seine guten Gründe dafür haben. Ehrwürdiger Vater? Erzbischof Heinrich? Morgen? Gute Figur machen? Ich muss geträumt haben. Das konnte er noch denken. Weiteres nicht.
*
Demudis versuchte gerade, sich dem süßen Schlummer hinzugeben, als sie merkte, dass Schwester Godelivis neben ihr unter der Decke zitterte. In den vier Betten des Gemaches lagen immer drei Schwestern beieinander, es wechselte allerdings oft, welche bei welcher. Nächst Schwester Godelivis schnarchte Schwester Mentha, die Älteste von ihnen. Demudis fragte sich, ob Schwester Mentha denn alle Bäume Kölns gleichsam eigennäsig absägen müsse.
»Gütiger Gott«, sagte Demudis, »du wirst mir doch nicht krank werden!«
Fürsorglich rückte sie näher an die zitternde Godelivis heran. Sie fühlte sich nicht kalt an, hatte aber auch keine überschüssige Hitze. Schwester Godelivis war eine Magd, die noch nie einen Mann erkannt hatte, eigentlich viel zu jung für die Beginen, jedenfalls laut Verfügung des ehrwürdigen Vaters und Herrn Erzbischof. Eigentlich. Doch es gab immer einen Weg, wenn man nur wollte. Die Eltern von Schwester Godelivis waren mit ihrer eigensinnigen Tochter nicht zurechtgekommen und dachten daran, sie in ein Kloster zu geben. Da hatte sie sich verweigert, bis sie nach vielem Hin und Her einwilligte, sich den Beginen anzuschließen. Ihre Eltern mussten dafür nicht nur dem Konvent eine angemessene Stiftung machen, sondern auch den Zorn des Erzbischofs mit einigen Oboli besänftigen. Oboli halfen bei diesem alten Sack von Erzbischof immer, dachte Demudis belustigt. Wie konnte der Herr ihn nur so unglückselig lange am Leben erhalten, während er andere, würdigere Menschen viel früher zu sich befahl? Oder wenigstens hätte er ihm die Weisheit und die Milde des Alters geben sollen, wie Hechard, anstatt ihn mit Torheit zu schlagen! Der Grund für die ungewöhnliche Dauer von Erzbischof Heinrichs Lebens hienieden konnte nur sein, dass Gott es so weit wie möglich herauszögern wollte, dessen Gesellschaft dulden zu müssen. Konnte er ihn nicht einfach zur Hölle schicken, auch wenn er Erzbischof war?, überlegte Demudis und grinste schuldbewusst in sich hinein.
Schwester Godelivis gebärdete sich wild, wild wie ein Bursche, eine richtige Maennyn, wie man so sagte. Im großen Ganzen konnten die Bewohner des Hauses mit ihr auskommen und sie bemuttern, bis auf Schwester Hardrun, mit der es immer nichts als Streit gab. Schwester Hardrun achtete streng auf Gottesfürchtigkeit. Dieselbe ließ Schwester Godelivis bisweilen vermissen, wenn sie auch nicht, wie Schwester Angela, allen hinterher stieg, denen Glocken zwischen den Beinen läuteten.
Der Atem von Schwester Godelivis ging stoßweise. »Was bist du doch unendlich schön, meine allersüßeste Jungfrau Maria!«, jauchzte sie und kuschelte sich eng an Demudis.
Demudis streckte den Arm aus und umfasste Schwester Godelivis. Den jungen Körper zu spüren, empfand sie als angenehm. Üblicherweise gerieten die Schwestern nicht abends vor dem Schlafen in Verzückung, vielmehr geschah dies morgens beim Erwachen. Aber es kam auch eher selten vor, dass die Schwestern die Vereinigung mit der Mutter Maria ersehnten statt mit ihrem Bräutigam, dem Herrn. Nichts an Schwester Godelivis war gewöhnlich.
Was bedeutete es wohl, fragte sich Demudis, dass sie selbst noch keine Erscheinung des Herrn oder der Jungfrau Maria gehabt hatte? Sie wusste, dass es nicht nur ihr, sondern auch Hechard bisweilen lästerlich anmutete, wenn die Schwestern den Herrn betrachteten, als breite er die beseligenden Arme für sie aus, um ihre Brautschaft zu empfangen, und senke sein Haupt, um ihnen den Hochzeitskuss zu geben, während er doch vom Menschen geschändet und leidend am Kreuze hing. Schwester Lora war einmal im Angesicht des Kreuzes so in Wallung geraten, dass sie sich, wie sie erzählte, ihrer Kleider vollständig entledigt und sich Ihm ganz hingegeben hatte. Demudis behielt ihre Einwände für sich. Immerhin handelte es sich um ihre Schwestern. Der Konvent war ihr Zuhause geworden in den beiden Jahren ihrer Witwenschaft. Jede musste selbst wissen, wie sie mit dem Herrn verkehren wollte. Es reichte, dass der Erzbischof es immer besser wusste und ständig neue Vorschriften erließ. Wie gut, dass die Beginen nicht dem Weltklerus unterstanden, sondern den Predigerbrüdern, die Hechard zu den ihren zählten, den Gelehrtesten und Gütigsten unter den Menschen.
Ein leichtes Kribbeln verbreitete sich über ihren Körper, als sie an Hechard dachte, den seine Mitbrüder Meister Eckhart nannten. In ihm sah sie keinen Mann wie die anderen, die Weibern wie ihr Gewalt antaten und hinab in den Schlund der Hölle gehörten.
Schwester Godelivis war, wie Demudis meinte, eingeschlafen, bewegte aber wohl unwillkürlich die Hand angenehm sanft über Demudis’ Tütelin, und bald war auch Demudis selbst mit einem seligen Seufzer entschlummert. Trotz des ohrenbetäubenden Rasselns aus Schwester Menthas Nase.
*
Nach der Vesper würde Hanß ein wenig allein sein können. Er liebte die Brüder, war aber doch froh, nun als Abt der Barfüßer ein eigenes Haus beanspruchen zu können, um für sich zu sein, wenn ihn danach dürstete. Er würde Gott um Gnade für die Sünden seiner Mutter bitten, die er so sehr vermisste. Wenn ihn sein kaputtes Auge schmerzte, dachte er sogar bisweilen noch an Agnes. Würde der Herr diesen Stachel nie aus seinem Fleische entfernen? Gebenedeite Jungfrau, voll der Gnaden, betete er zu Maria, der Mutter Gottes, bitte lass mir deine keusche Liebe genug sein!
Als die Brüder die eiskalte Kirche verließen und ins nicht minder kalte Dormitorium strömten, um sich zur Ruhe zu begeben, während Hanß zum Abthaus abbog, gewahrte er zunächst nur undeutlich, dass sich jemand neben ihn gedrängt hatte. Er schaute auf. Es war ein gewaltiger Fettberg, Bruder Dirolf, einer seiner fähigsten Mitstreiter, wenn er ihm auch mitunter etwas engstirnig vorkam. Die einzige Sünde, die Bruder Dirolf sich erlaubte, war es, soweit Hanß wusste, seinem ungeheuren Hunger nachzugeben.
»Ich brauche dein Ohr für eine Kerzenlänge«, sagte Bruder Dirolf keuchend.
Hanß nickte. Es würde wohl nichts werden aus der beschaulichen Einsamkeit vor dem Schlafen. Für morgen hatte ihn der ehrwürdige Vater und Herr Erzbischof Heinrich einbestellt. Da musste er ausgeschlafen sein, denn ihm schwante nichts Gutes. Zwar war ihm der Grund der Unterredung nicht mitgeteilt worden, aber Hanß hatte gehört, dass Erzbischof Heinrich sich wieder mit dem Vorhaben trug, gegen diejenigen das Schwert zu erheben, die er der Ketzerei zieh, Bettelorden, Barfüßer, Prediger, Begarden, Beginen, Brüder und Schwestern des freien Geistes, den berühmten Meister Eckhart. Alle wurden in einen Topf geworfen, ohne einen Unterschied zu machen! Es war Hanß zuwider, sich mit diesen eines Christen unwürdigen Händeln der Welt herumzuplagen, bei denen die Glaubensdinge nur zum Vorwande im gotteslästerlichen Ringen um Macht und Geld dienten.
Bruder Dirolf war rücksichtsvoll genug, um auf dem Weg über den verschneiten Kreuzgang und den vereisten Vorhof ins Abthaus nichts zu sagen. Sie mussten vorsichtig auf ihre Schritte in der Dämmerung Acht geben, um nicht auszugleiten. Im Abthaus angelangt, holte Hanß einen Krug Wein und entzündete eine Kerze. Er nahm Platz und Bruder Dirolf ließ sich neben ihm schwer auf den Stuhl fallen. Hanß befürchtete schon, der Stuhl würde auseinander brechen unter dem Gewicht des Bruders, doch er knarrte nur, wenn auch bedenklich, und hielt Stand.
Bruder Dirolf wischte sich mit der Hand den Schweiß aus dem Gesicht und stöhnte. Wie kann er trotz der Kälte derart schwitzen?, dachte Hanß flüchtig.
»Es geht um diesen Prediger, Johannes Eckhart, den sie den Meister nennen; die Weiber rufen ihn Hechard«, begann Bruder Dirolf düster. Seine Stirn zeigte tiefe, speckige Sorgenfalten. »Er lehrt Dinge, die gegen den Glauben gehen.«
»So, so«, knurrte Hanß, um etwas zu sagen. Das war kein Gesprächsstoff, den er liebte. Es reichte, wenn der Erzbischof ihn nötigten würde, sich damit zu befassen.
»Er sagt zum Beispiel, die äußeren Werke wie die der Keuschheit seien nichts wert, denn es käme vielmehr bloß auf den Willen an, den guten Willen. Und dann, wenn man mit gutem Willen handele, wäre, gleich was man täte, die Übereinstimmung mit dem Willen des Herrn bereits gegeben«, fuhrt Bruder Dirolf fort, ohne sich durch Hanß’ abweisende Art abschrecken zu lassen.
»Das wird den Weibern, den Beginen, nicht gefallen, die sich so in der Zucht ihrer Körper üben«, sagte Hanß und lachte Bruder Dirolf an. Vielleicht ließ sich die Angelegenheit ins Närrische ziehen und auf diese Weise abtun und übergehen. Denn jeder wusste doch, dass das, was man von den Beginen erwartete, von ihnen bloß überaus selten auch eingelöst wurde.
»Und doch lieben sie ihn über alles«, sagte Bruder Dirolf abschätzig.
»Wir haben mit derlei nichts zu tun«, beschied ihn Hanß. Er musste also doch noch deutlicher werden! »Wir folgen dem heiligen Franz in seiner Einfachheit, Demut und Armut und tun damit unserer Christenpflicht genüge.«
»Ich weiß, dass du so darüber denkst.« Bruder Dirolf wurde hitziger. Hanß meinte, einen anklagenden Unterton zu vernehmen. »Allem Anscheine nach nehmen sich die Unterschiede zwischen den Beginen und Eckhart jedoch weitaus geringer aus, als du wahrhaben willst. Was dieser Eckhart lehrt, hört sich gefährlich nach dem an, was auch die ketzerischen ›Brüder und Schwestern des freien Geistes‹ gesagt haben. Und was ist aus der einen geworden, die du vor dem gerechten Zorn des ehrwürdigen Vaters und Herrn Erzbischof Heinrichs gerettet hast? Eine Dirne!«
»Die Wege des Herrn sind unerforschlich«, wich Hanß müde zurück. »Er verlangt von uns, jedem Sünder, auch dem verderbtesten, die Möglichkeit offen zu halten, sich aus eigenem Willen zu Ihm zu bekehren. Denke an den heiligen Augustinus, der es uns in seinen Bekenntnissen überliefert hat, ein wie sündiges Leben er geführt hat …« Leise fügte Hanß hinzu: »Und an mich.«
»Doch kann es nicht geduldet werden, dass Derartiges auch noch gepredigt wird und damit die zarten Gemüter der Leute, die sich wie Schilfrohr im Winde biegen, ins Verderben gestoßen werden«, ereiferte sich Bruder Dirolf. Sein Mund zuckte und von der Stirn tropfte eine Schweißperle auf den Tisch. »Das darf nicht geduldet werden! Die Kirche muss dem Einhalt gebieten!«
Hanß fühlte die heftigen Worte wie Peitschenhiebe im Kopf. »Bruder Dirolf, du bist so wundersam rechtschaffen. Dein Eifer für den Herrn ist überaus löblich.« Er breitete die Hände aus. »Gleichwohl bitte ich dich, vertraue mit mir auf das Tun des Herrn. Lass uns im Gebet vereinigt sein mit allen christlichen Seelen und ihre Errettung erflehen.«
An der Stirnseite der engen Abtstube befand sich ein Kruzifix mit einem kleinen Altar davor. Die Magd hatte ein paar frische Tannenzweige darauf gelegt. Hanß erhob sich und ging vor dem Altar auf die Knie. Er begann zu beten. Er versank ganz in Gedanken und genoss die süße Zuneigung des Herrn. Als er sich erhob, sah er, dass Bruder Dirolf gegangen war. Hanß stöhnte erleichtert auf. Wie konnte er sich den Brüdern verständlich machen?
Er trank noch den letzten Schluck Wein und bettete sich dann. Wie vorgeschrieben, entkleidete er sich nicht. Im Winter war das eine durchaus erfreuliche Regel. Ganz anders verhielt es sich in der Hitze des Sommers. Hanß dachte an den Sommer, als er die klamme Decke über sich zog. Die Hände waren ihm kalt und so führte er sie zwischen die Schenkel, um sie zu wärmen. Ihn ergriff eine schier unbezwingliche Sehnsucht. Kein Mensch kann keusch sein und sich gegen die fleischlichen Gelüste wappnen, wenn er nicht die gnädige Mithilfe des Herrn dazu findet, hatte der heilige Augustinus gesagt, entsann sich Hanß, während er sein steifes Dynck rieb. Darum also wird es wohl Sein Wille sein. Hanß versuchte noch, sich für seine Gedanken zu hassen, aber das Bild der unwiderstehlich liebreizenden Magd Agnes schob sich davor. Sie erstrahlte vor seinem einen Auge in ihrer ganzen herrlichen Wunderbarkeit. Es war nicht frostiger bösartiger Winter, sondern warmer mildtätiger Sommer. Ihre festen runden Tutten mit den kecken rosigen Wertzlin, ihre gut geformten Hüften, der verführerische Duft ihrer samtweichen Haut wurden so gegenwärtig, dass Hanß fast meinte, er könne sie spüren. Allein diese Erinnerung war das eine Auge wert, das er um ihretwillen hatte hingeben müssen. Schließlich konnte er auch mit dem anderen Auge noch genug sehen!
Doch schnell, allzu schnell war es vorbei, und die Kälte hatte ihn wieder eingeholt. Was bin ich für ein niedriges Geschöpf, haderte Hanß mit sich, dass ich für derart flüchtige Freuden das ewige Seelenheil aufs Spiel setze und dem elenden Genuss keine Schranken setzen kann! Wie viel glücklicher wäre ich, wie es in der Schrift heißt, als einer derjenigen, »die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreiches willen«, o heilige Jungfrau, in Erwartung deiner seligen Umarmung. Aber nein, ein Verschnittener hat ja keinen Zugang zum Himmelreich, wie es im Buch Mose heißt, so danke ich dir, o Gott, dass ich sündigen darf.
Lange fand Hanß keinen Frieden, ehe ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen.
KAPITELIII
»Die sehnende Minne schafft reinen Herzens sehr viel süße Not.«
Mechthild von Magdeburg
Als die Glocke am folgenden Tage, dem Fest der heiligen Martina, zur Matutin rief und Wilhelm aus unruhigem Schlafe erwachte, wusste er nicht mehr, wie sie, Bruder Hermann und er, gestern Nacht zurück ins Predigerkloster gelangt waren. Sein Kopf schmerzte höllisch. Er erhob sich und torkelte mit den Brüdern aus dem Dormitorium über die schmale Treppe in die Kirche. Beinahe wäre er gestürzt. Die liebkosenden Stimmen des Gesangs während der Messe, die er sonst als so zart und himmlisch empfand, klangen nun wie furchtbare Hammerschläge. Er überstand auch das.
Dann, beim Waschen mit eiskaltem Wasser, vermeinte Wilhelm, die Haut wolle ihm vom Leibe abplatzen. Sein Blick glitt über die Brüder, bis er bei Bruder Johannes verweilte. Man erzählte sich, dass dieser auch dereinst einem holden Weibe verfallen sei, fünfzig Jahre musste das nun her sein! Seitdem hatte er zur Sühnung ein heiliges Gelübde abgelegt, nicht ein Wort mehr über seine Lippen kommen zu lassen, und dies auch bis auf den heutigen Tag eingehalten. Seine Heiligkeit wurde von jedermann, selbst von den Barfüßern, anerkannt. Vielleicht bin selbst ich noch nicht gänzlich verloren, dachte Wilhelm und betrachtete den Greis wehmütig. Möge Gott Gnade walten lassen und mir die Kraft schenken, Seinem Willen gemäß zu leben!
Nach der Säuberung des sündigen Leibes scherte ihn Bruder Hermann, der ebenfalls stumm litt. Als die Reihe an ihm war, Bruder Hermann zu scheren, wie es die Bruderpflicht befahl, konnte er die Hand nicht ruhig führen und schnitt Bruder Hermann. Dafür handelte er sich einen kräftigen Knuff ein. Bruder Hinkmar, der nächst ihnen Bruder Frulof die Tonsur erneuerte, fragte klatschsüchtig:
»Höre mal, Bruder Hermann, wo wart ihr, du und Bruder Wilhelm, denn gestern zur Vesper?«
Wilhelm wusste, dass Bruder Hermann nichts sehnlichster erwartete als den Tag, an dem er ehrerbietig als Magister angeredet werden würde; und richtig, Bruder Hermanns Gesicht verfinsterte sich auf die Frage hin bedrohlich ob der Anrede.
»Des Christen Barmherzigkeit tätig üben in Melaten bei den Leprosen«, knurrte er.
Bruder Hinkmar lächelte ein schmallippiges, wissendes Lächeln. Konnte es sein, dass sich in Bruder Frulofs Blick Abergunst und Anerkennung in eigentümlichem Widerstreit befanden?
Wilhelm schleppte sich zwischen den anderen in den Kapitelsaal, um mit Abt Norbert das Tagewerk zu besprechen. Müde ließ er sich auf einen der noch freien Stühle an dem lang gestreckten Tisch fallen. An dem Tisch fanden alle Brüder Platz. Hinten, viel zu weit hinten im Saale brannte ein Feuer, das wenigstens etwas Wärme verbreitete. Wilhelm merkte, dass er gleichwohl entsetzlich fror. Und die lebenspendende Glut war so weit weg. Der Stuhl fühlte sich kalt und hart unter seinem weichen Arsche an, der sich nach dem Bett sehnte. Im Gedränge hatte er Bruder Hermann verloren. Der saß woanders. An welcher Stelle? Wilhelms Blick kreiste unstet umher. Die Wände schienen zu wanken und er sah die Gesichter der Brüder nur umrisshaft. Ach da, nebst den Brüdern Tauler und Seuse, geachtete Schüler des Meisters, hatte Bruder Hermann Platz genommen. Wilhelm kam sich verlassen vor. Immerhin war beruhigend, dass er Bruder Hermann im Blick halten konnte. Wenn er bloß klar zu sehen vermochte! Das Hören fiel ihm noch schwerer. Seine Gedanken glitten ab in den Sommer. Es war mollig warm, richtiggehend heiß. Der salzige Schweiß troff ihm von der Stirn in den Mund. Seine Kleider wurden durchnässt. Er war ein kleiner Junge. Die Barfüßer in Aachen waren nicht ausnahmslos schlecht. Bruder Jordan gab ihm einen Apfel. Einen wohlmundenden weichen Apfel. Sie saßen im ausgedörrten, fast schon wie Heu aussehenden und riechenden Gras und Bruder Jordan schnitt hauchfeine Scheibchen ab, legte sie ihm in den Mund; so dünn waren sie, dass sie auf der Zunge fast von allein zerfielen. Geduldig hatte der Bruder weitergemacht, weil Wilhelm nicht genug von diesem Spiel bekommen konnte. Wilhelm sehnte sich plötzlich nach Bruder Jordan. Alles, was gesagt wurde, rauschte an ihm vorbei, bis sich Bruder Hermann zu Wort meldete und mit stolzgeschwellter Brust verkündete:
»Ehrwürdiger Vater und Herr Abt Norbert, wir, also Bruder Wilhelm und ich, werden zur Terz beim ehrwürdigen Vater und Herrn Erzbischof Heinrich II. von Virneburg erwartet.«
Welche Ehre!, dachte Wilhelm und konnte den Stolz seines Freundes nur zu gut verstehen.
Abt Norbert dagegen zog die Augenbrauen hoch. Wilhelm konnte sich aber nicht entscheiden, ob sein Blick Missbilligung ausdrückte oder so etwas wie eine unerklärliche Angst. Bruder Hermann hatte einen forschen, herausfordernden Ton angeschlagen, mit welchem er alle Brüder in Schrecken versetzen konnte. Alle? Es gab Ausnahmen. Meister Eckhart, sicherlich auch Bruder Johannes. Wilhelm meinte, dass aber Abt Norbert nicht weniger unter Bruder Hermann litt als er selbst. Bruder Norbert war ein edler Mensch, mildtätig zu jedermann, nachsichtig den kleinen Fehlern der Brüder gegenüber. Er entstammte einer der bedeutendsten Familien der Stadt, den Overstolzen, die ihn, als er noch ein Knabe gewesen war, der Kirche geweiht hatten, damit er für sie, ihrer zahllosen Sünden wegen, beten möge. Er ergab sich demütig in sein Schicksal. Nie hatte Wilhelm ihn klagen gehört. Er liebte das Essen und die Ruhe. Niemand konnte ihm etwas Arges nachsagen. Bruder Hermanns kraftvollem Wesen allerdings zeigte er sich nicht gewachsen.
»Gehet hin in Frieden«, sagte Abt Norbert langsam und, wie es Wilhelm schien, niedergedrückt. Dabei betonte er das Wort »Frieden«, sodass sich Wilhelm bange fragte, um was es sich denn handeln würde.
Die Brüder erhoben sich und Wilhelm tat es ihnen nach. Er suchte die Nähe von Bruder Hermann.
»Die Sache mit dem ehrwürdigen Vater und Herrn Erzbischof Heinrich. Davon wusste ich ja gar nichts«, raunte er ihm zu.
»Wie konntest du es vergessen? Gestern bei Ellikint!«, ereiferte sich Bruder Hermann. Doch dann legte er Wilhelm den Arm um die Schultern und sagte sehr leise in sein Ohr: »Eine ganz große Sache. Du wirst schon sehen. Alles wird gut, alles wird sich zum Besten wenden.«
Wilhelm begnügte sich damit, wie immer. Er folgte Bruder Hermann sowieso auf Schritt und Tritt. Er hatte doch niemanden sonst, der sich um ihn kümmerte! Es ist, als wäre ich noch ein Kind, dachte Wilhelm.
»Komm mit«, forderte Bruder Hermann ihn auf. »Uns verbleibt etwas Zeit. Wir wollen uns an der unvergleichlichen Weisheit des Meisters laben.«
Sie trafen Meister Eckhart in der Bibliothek an. Er saß dort vertieft in einem großen Werk lesend. Sein welliges Haar war lang, sehr dünn und schlohweiß. Es ging über in einen ebenso weißen und ebenso langen Bart. Wie aus einem Wollknäuel schaute eine hohe zerfurchte Stirn heraus. Die Augen waren fast geschlossen. Wilhelm fragte sich, ob der Meister so überhaupt zu lesen vermochte. Den linken aus seiner Kutte stakenden, knochigen Arm hatte er auf die Lehne seines schweren, mit kostbarem Leder bezogenen Stuhls gestützt. Die Hand hielt den Kopf, während die Rechte das Buch umklammerte. Fast fünf Jahre weilte der Meister jetzt unter ihnen. Er war aus Straßburg gekommen, wo er den Beginen gepredigt hatte, unglaublicherweise auf Diutisch, weil sie, wie er sagte, als Laien des Lateins, der Sprache des Herrn, nicht mächtig waren. Als Generalvikar war er der Stellvertreter ihres Ordensgenerals gewesen, die Neider streuten aber das Gerücht, die Beginen hätten ihn zur Ketzerei verführt. Er musste Straßburg verlassen und verlor seinen Posten. Wie glücklich sich das gefügt hatte, dachte Wilhelm, so konnten wir in den Genuss seiner Anwesenheit kommen, denn Abt Norbert holte ihn, damit er hier in Köln das Studium beaufsichtigen möge. Doch auch hier ließ man nicht ab von ihm. Wilhelm hatte gehört, Erzbischof Heinrich, dessen Feindschaft den Beginen gegenüber die ganze Kirche der Stadt entzweite, würde die Inquisition gegen ihn hetzen. Nicht auszudenken, was geschehen könnte! Würde der Meister verbrannt wie die ersten Märtyrer des Herrn Jesus Christus, dachte Wilhelm, so müsste auch ich verbrennen.
Bei der Ankunft der beiden Brüder hatte der Meister kaum aufgemerkt.
Bruder Hermann zog sich einen niedrigen dreibeinigen Schemel heran und setzte sich dicht dem Meister gegenüber. Wilhelm blieb notgedrungen stehen.
»Verehrter Meister«, unterbrach Bruder Hermann frech und beugte sich vor. Wilhelm sah, wie der Schemel zu kippen drohte, Bruder Hermann fing sich aber rechtzeitig ab. Er führte seine Handflächen zusammen, versenkte sie in der Kutte zwischen den Beinen und rieb sie ein wenig, vermutlich um sie zu wärmen. »Ich habe da eine Frage.«
Meister Eckhart klappte sehr langsam das Buch zu, ließ es auf seinen Knien liegen und schaute Bruder Hermann in die Augen. Er nahm seinen linken Arm von der Lehne und legte die Hand auf Bruder Hermanns rechten Unterarm.
»Mein Sohn«, sagte er. Wilhelm kannte niemanden, der eine solch begütigende Stimme besaß. »Dies ist das Buch des Philosophen über die Seele. Es ist ein sehr, sehr weises Buch. Und es ist wahrlich Aristoteles nicht vorzuwerfen, dass er nicht getauft ist, denn der neue Bund mit unserem Herrn Jesus ward noch nicht geschlossen zu der Zeit, als er dies geschrieben hat.«
»Meine Frage«, erinnerte Bruder Hermann ungeduldig und betonte unverschämt das »meine«. »In der Disputatio neulich wart Ihr aufgefordert worden zu erläutern, warum Gott die Welt nicht früher erschaffen habe. Ihr aber habt dagegen gehalten, die Welt sei von Ewigkeit her gewesen. Wie kann sie da geschaffen worden sein?«
Wilhelm erinnerte sich, dass er nach der Disputatio dies zu Bruder Hermann gesagt hatte. Er stiehlt mir meine Frage!, empörte er sich innerlich. Aber warum stellt er sie jetzt und nicht in einer neuerlichen Disputatio?
Meister Eckhart räusperte sich. »Ich sage dir: Nichts kann wirken, bevor es da ist. Also kann die Welt nicht erschaffen worden sein, bevor Gott da war. Weiter nämlich sage ich: Da Gott die Wirklichkeit der Welt schlechthin ist, muss Er sie, wie auch den Sohn, zugleich geschaffen haben, sobald Er auch da war. Und noch mehr sage ich: Da Er lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie es heißt, muss die Welt von Ewigkeit her da gewesen sein.«
»Die Schrift sagt uns, dass Gott am Anfang die Welt erschuf. Was aber erschaffen ist, ist nicht da, bevor es da ist: Also ist das Geschaffene nicht ewig, denn was ewig währt, ist immer da.« Bruder Hermann hatte schnell und ein wenig schrill gesprochen. Wilhelm fand es mutig, dass sein Freund es wagte, dem übermächtigen Meister zu widersprechen. Aus ihm wird sicherlich einmal ein ganz Großer, dachte er voller Bewunderung.
Meister Eckhart sog tief Luft ein und stieß sie dann geräuschvoll aus. »Mein Sohn«, sagte er, »du redest wahr, soweit es den Menschen betrifft. Ich aber sage dir noch: In Gott ist keine Zeit. Das Ewige, der Anfang und das Erschaffen sind in Gott ein und dasselbe, so wie Er ungeteilt und einfach ist.«
Bruder Hermann wandte sich an Wilhelm, der über die weisen Worte des Meisters nachgrübelte. Es war schwer, ihn zu verstehen. Er war so in Gott versenkt, dass es kaum möglich war, ihm zu folgen. Unterzog man sich jedoch der Mühe, gelangte man zu Einsichten in das Wesen Gottes, die so tief und unergründlich waren, dass die Freude darüber unermesslich wurde. Ein Gefühl, dachte Wilhelm, als würde man eins mit Gott! Bruder Hermanns Worte rissen Wilhelm aus seinen Gedanken.
»Ist es nicht großartig, wie ein vollkommener Geist immer wieder in verständlichen und klaren Worten uns die ewige Wahrheit des Herrn verkünden kann?«
Bruder Hermann erhob sich vom Schemel. »Danke, verehrter Meister, wir wollen Eure Zeit nicht länger für die nichtswürdigen Fragen von Anfängern verschwenden, wo Ihr doch so viel Wichtigeres zu bedenken habt.«
Meister Eckhart gab einen Grunzlaut von sich und schlug sein Buch wieder auf.
Was geht hier vor, macht sich Bruder Hermann über den Weisen lustig?, fragte sich Wilhelm, Bruder Hermann ließ ihm aber keine Zeit zum Nachsinnen.
»Wir gehen«, sagte er schroff.