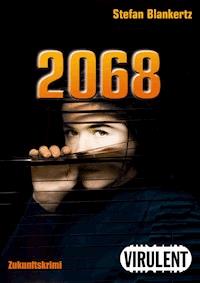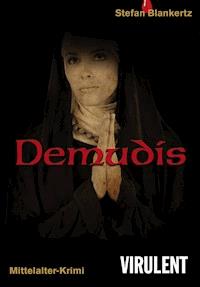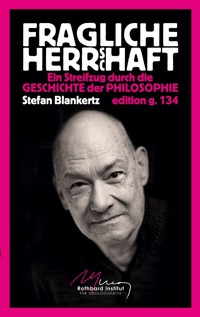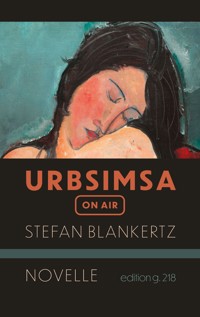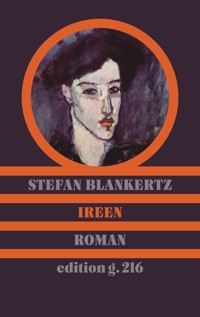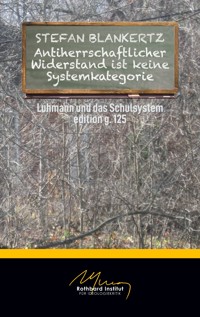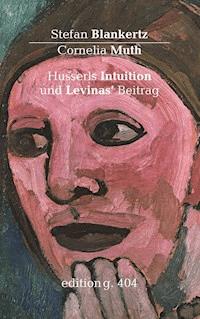Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Mittelalter live miterleben – von junger Liebe bis zur Inkontinenz des greisen Magisters Albertus, von tief empfundener Barmherzigkeit bis zu brutaler Verfolgung Andersgläubiger, vom opulenten Fressgelage bis zum kargen Fastenmahl, von großer Heilkunst bis zu gefährlicher Quacksalberei: Der genau recherchierte und detailliert nachgezeichnete Alltag des Hochmittelalters im 13. Jahrhundert bildet den Hintergrund für Stefan Blankertz' Mittelalterkrimis. El Arab ist der Spitzname für Sultan Ibn Rossah. Er ist arabischer Gelehrter, Arzt, Erzieher und Abenteurer. Seiner Herkunft nach Jude, ist er zum Islam übergetreten, aber verehrt auch herausragende christliche Philosophen. In seinem verzweifelten Kampf um ein "Land der Sonne", in welchem alle Religionen friedlich nebeneinander leben können, verschlägt es ihn bis nach Köln. Dort nehmen die Kriminalfälle ihren Ausgang. El Arab bleibt freilich ein Held zum Anfassen: Er ist keineswegs ohne Fehl und Tadel. Alle Kriminalfälle werfen die Frage nach dem Verhältnis von Toleranz und Recht im Umgang miteinander auf. Eine Frage, die heute nicht weniger wichtig ist als ehedem. BAND 3: CREDO Mitten in der vorösterlichen Fastenzeit 1277 wird der Kölner Dominikanermönch Moneta erdolcht. Klosterarzt Johannes macht sich daran, den Mörder des Bruders zu ermitteln. Doch er muss erfahren, dass Verbrecherjagd und Heilkunst zwei ganz verschiedene Wissenschaften sind. Als er sich noch zu allem Überfluss unglücklich in eine Nonne verliebt, drohen ihm die Ermittlungen gänzlich aus der Hand zu gleiten … "Credo" entführt den Leser in das klösterliche und städtische Leben und Denken des 13. Jahrhunderts mit seinen großen und kleinen Problemen, die zunächst fremd erscheinen, aber bei genauerem Hinsehen von unseren heutigen gar nicht so verschieden sind: Die Frage, wann Recht unrecht oder Unrecht recht wird, ist so aktuell wie eh und je. "Dieses Buch [ist] ein Genuss." Aus einer Rezension in "Pax et gaudium"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFANBLANKERTZ
Die stumme SündeEin Krimi aus dem Mittelalter
Johannes, Schüler von El Arab, Band 2
Inhalt
Köln im 13. Jahrhundert
Paris im 13. Jahrhundert
Personen
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Nachwort
Glossar
Impressum
E-Books von Stefan Blankertz
Weitere Mittelalter-Krimis
Urban-Fantasy-Roman
Köln im 13. Jahrhundert
Paris im 13. Jahrhundert
PERSONEN
Die Wanderer
Johannes von Köln, Dominikanermönch, Arzt und Theologe
Gerhard, Novize im Kölner Dominikanerkloster, begleitet Johannes
Die Kölner
*Albertus .(1193–1280), hochbetagter dominikanischer Magister
Bruno Hardefust, ein ehrgeiziger Patrizier
Dideradis, Äbtissin der Klarissen in Köln
Elisabeth, Magd bei den Kleingedanks
Emund von Regensburg, franziskanischer Prediger
*Engelbert II. von Falkenburg .(1220–1274), Erzbischof von Köln
Franz Weinhold, ein Schöffe
Hadwig, Mutter von Johannes, Leiterin des »weißen Hauses«, eines Laienkonvents für unverheiratete Mütter .(»Reuerinnen«)
Heinrich Koelhoff, ein Kürschner
Isfried Hardefust, Halbbruder von Bruno
Kuno, Knecht bei den Kleingedanks mit eigenartigen Aufgaben
Martin Koelhoff, Deutzer Bauer, älterer Bruder von Heinrich
Mathilde Bechofen, Frau von Heinrich Koelhoff
Mechtild, ein junges Mädchen
Paul, übergewichtiger Koch im Kölner Dominikanerkloster
Peter, Sohn von Sophia
Rudolph, ein misstrauischer alter Goldschmied
Sophia Overstolz, aus dem mächtigsten Geschlecht Kölns stammende Ehefrau von Bruno
Vogelo, ein junger Schuster
Wido, Abt des Kölner Dominikanerklosters
*Willelmus de Rubruquis .(1215–?), weitgereister Mönch im Kölner Dominikanerkloster
Die Familie der Kleingedanks
Aldevatter, gelähmter Großvater von Andreas
Andreas, angeklagter Ratsherr
Dietrich, Großonkel von Andreas
Friederich, Bruder von Andreas
Frieda, Ehefrau von Dietrich
Gerlinde, Ehefrau von Gottfried
Gottfried, Onkel von Andreas, gichtgeplagt
Monicka, blutjunge dritte Ehefrau von Aldevatter
Otto, Vater von Andreas
Wolfhardt, Bruder von Andreas und Ehemann der Mutter von Johannes
Die Fahrensleute
Christian der Bonger, Trommel
Engyn die Fleuterin, Flöte, Gesang und Wahrsagen
Thers der Pijffer, Gesang, Pfeifen, Akrobatik
Theodora, ein lebenslustiges Mädchen
Die Bauern von Andenne
Jacoba, schlagkräftige Mutter von Uugo
Loodewijck, Vater von Uugo
Uugo, Sohn von Jacoba und Loodewijck
Die Laoner
Alexis, Gräfin
*Gui III., Graf
Marie, Magd der Gräfin
Weitere Personen
Agatha, Äbtissin der Benediktinerinnen in Königsdorf, die als junges Mädchen im »weißen Haus« von Hadwig betreut worden war
Arab, Beiname für Averom .(1211–1272), arabischstämmiger Gelehrter und Arzt
Ibrahim, Begleiter von Averom
Ingeborg von Dänemark, eine Pariser Prostituierte
Margarete, belgische Wirtin
Philippe von Soissons, Graf
Pierre, Magister an der Pariser Universität
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, einige sind es nicht. Die historischen Personen des Romans sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Darstellung ihres Verhaltens und ihres Charakters entspricht jedoch nicht in jedem Fall der Überlieferung. Schriften damaliger Autoren werden sinngemäß, nicht wörtlich zitiert. Der Anhang enthält ein Glossar.
»Er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht.«
Lukas 3,14
»Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.«
Matthäus 6,12
»Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette.«
Johannes 12,47
KAPITELI
»Der Ursprung alles Unvollkommenen liegt notwendig in einem Vollkommenen.«
Thomas von Aquin
Isfried Hardefust war so frohgemut, dass es ihm nie in den Sinn gekommen wäre, dies könnte der letzter Besuch des Badehauses in der Schwalbengasse gewesen sein, den Gott ihm gewähren würde.
Seit heute, dem Tag vor dem Fest des heiligen Apostels Matthäus im Jahre des Herrn 1274, nannte er ein Geheimnis sein eigen, das sein Schicksal zum Besseren wenden würde. Trotz der Verkleidung hatte er den Verbannten sofort wiedererkannt, den er einstmals auf einer ansonsten eher langweiligen Handelsreise zufällig getroffen hatte, zu der er von seinem gemeinen Vater gezwungen worden war. Nun hatte ihm der Erzbischof versprochen, ihn fürstlich zu belohnen, weil er ihm Mitteilung davon gemacht hatte, dass ein Mitglied aus einer der verbannten Familien sich in Köln aufhielte, was ihnen bei Androhung des Todes verboten war.
So hilfreich ist es, dass ich ein so gutes Gedächtnis habe, freute sich Isfried und rieb sich die Hände. Er hatte die letzten Nächte bei seiner Buhle Mathilde verbracht, da deren Mann eine Schuld bei dessen Bruder in Deutz abarbeiten musste. Am Morgen war er auf einem Müßiggang durch die Gassen zufällig dem Verbannten begegnet.
»Oh, welche Überraschung«, hatte er ihn angesprochen, »ist es nicht gefährlich, Euch hier blicken zu lassen, wo Ihr doch zu dem Geschlechte der Verbannten gehört?« Ohne ihn einer Antwort zu würdigen, hatte der Angesprochene kehrt gemacht und war weggeeilt. Solch ein Feigling!, hatte Isfried noch gedacht.
Das Geheimnis hatte er für sich behalten, denn niemand sollte ihm die Belohnung streitig machen, auch seine Buhle nicht. Wie gut das gewesen war! Denn der ehrwürdige Vater und Herr Erzbischof bat ihn, noch niemandem die Anwesenheit des Verbannten zu offenbaren, da er erst zum angemessen Zeitpunkt von dem Wissen Gebrauch machen wolle. Ja, nur wenn er sich an diese Abmachung halte, werde ihm die Belohnung zuteil. Nun drängte es ihn jedoch, nach Hause zu gehen und auch seiner hochverehrten Schwägerin Sophia stolz von seinem unmittelbar bevorstehenden Reichtume zu künden, wenn er auch nicht würde sagen dürfen, worauf er sich gründete.
Als Isfried gelabt aus dem Badehaus in der Schwalbengasse trat, sah er, dass die Dämmerung sich bereits über Köln senkte. Isfried hasste die Nacht. Sie machte ihm angst, mehr als den meisten anderen, wie es ihm schien. Er hatte das Gefühl, gar nicht mehr da zu sein und sich in der Nacht aufzulösen.
In den Gassen befanden sich kaum noch Menschen. Er musste sich sputen, wenn er vor Einbruch der schrecklichen Dunkelheit zu Hause sein wollte, und er beschleunigte seinen Schritt. Hier und da sah er noch einen letzten Hurenbuben gesenkten Hauptes vorbeihuschen, der eine der Dirnen in der Schwalbengasse oder auf dem Berlich besucht und sich verspätet hatte – wie er selbst. Nur dass er aufrecht ging in Erwartung seines zukünftigen Glanzes. Isfrieds Brustkorb hob sich für einen schweren Atemzug, aber nicht frische Abendluft, sondern säuerlicher Gestank drang in seine Lungen. Die Unreinheit ist hier wohl zu riechen, dachte Isfried und senkte nun doch sein Haupt, weil er selbst gezwungen war, sich dieserorts zu vergnügen, anstatt, wie es ihm als stolzen Hardefust gebührt hätte, Frau und Kind sein eigen zu nennen.
An der Ecke zur Langgasse trat unvermittelt ein großer, hagerer Mann neben ihn, der in aufwändiges scharlachrotes Tuch gehüllt war. Auch seine guten Schuhe mit den langen Spitzen wiesen den Mann als einen Vornehmen aus. Isfried erschrak, als er sah, dass der Mann kein Gesicht zu haben schien, da er es in einer dunklen Kapuze verbarg.
»Folgt mir!«, befahl der Mann gedämpft. Als er die vertraut klingende, tiefe Stimme hörte, entspannte sich Isfried trotz der unheilkündenden Erscheinung. Es war ja nur Andreas Kleingedank, ein Ratsherr, der für seine außergewöhnliche Kleidung bekannt war, der liebste Freund seines Halbbruders Bruno. Isfried konnte Andreas wegen dessen Überheblichkeit ihm gegenüber nicht ausstehen, war aber in diesem Falle froh, dass er es war und nicht ein Räuber.
»Wie beliebt es Euch, zu mir zu sprechen, durchlauchter Herr Andreas?«, fragte Isfried und stieß erleichtert seinen Atem aus.
Der rechte Arm des scharlachroten Mannes steckte in einer Stoffalte. Nun holte er seine verborgene rechte Hand sehr ruhig hervor und offenbarte einen Dolch.
»Folgt mir!«, wiederholte der Mann. »Ihr habt keine Wahl.«
O doch, dachte Isfried, als er begriff, dass dies wahrlich ein Angriff war, ob es sich bei seinem Gegenüber nun um Andreas handelte oder nicht. Er machte einen Satz in die Kupfergasse, wo er gerade einen Mann erspäht hatte, der in einen Hauseingang trat. Isfried schrie laut, so dass der Mann sowie einige weitere Neugierige aus umliegenden Häusern auf die Gasse stürzten, um ihm zu Hilfe zu eilen.
»Was ist los, guter Mann?«, wurde Isfried gefragt. »Warum macht Ihr so ein Getös?«
»Jemand ist hinter mir her«, keuchte Isfried. »Man will mich meucheln!«
Er schaute sich ebenso wie die anderen um, doch niemand war ihm gefolgt. Der scharlachrote Bube war weit und breit nicht zu sehen.
»Ein Narrenesel«, hörte Isfried jemanden sagen. »Es war wohl nur der Wind.«
Die Leute kehrten in ihre Häuser zurück. Isfried war unschlüssig, ob er rennen oder langsam und umsichtig weitergehen sollte. Er lief ein Stück bis zur Ecke der Svardinsgazze, in die er rechts einbog. Er hielt nun inne und lauschte. Er vernahm ein schlurfendes Geräusch hinter sich und fuhr herum. Doch es war nur ein Bettler, der sich mühsam auf den Weg Richtung Stadtmauer machte, wo er vermutlich in einer der Nischen sein Unterkommen hatte. Der Bettler trug ein Bündel; im fahlen Mondschein meinte Isfried, es als braune Franziskanerkutte zu erkennen. Sicherlich ein verschlissenes Teil, das ihm von den minderen Brüdern aus Barmherzigkeit gegeben worden war, damit er sich für die Nacht zudecken kann, dachte Isfried.
Warum sollte mich der Freund meines Halbbruders bedrohen?, grübelte er. Er versuchte, sich so weit zu beruhigen, dass er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Wenn es sich bei dem scharlachroten Mann um den Ratsherrn Andreas Kleingedank gehandelt haben sollte, konnte es nicht anders sein, als dass auch sein eigener Halbbruder Bruno in den Angriff auf ihn verwickelt war! Isfried packte das blanke Grauen. Schließlich lebte er bei ihm und seiner Frau Sophia, die er heimlich anhimmelte. Dann wäre es wahrlich nicht ratsam, in Brunos Haus zurückzukehren. Gleich darauf verwarf Isfried die Vorstellung, Bruno könne ihm nach dem Leben trachten. Sophia würde das nicht zulassen! Und sie war es, die alle wichtigen Entscheidungen traf, überlegte Isfried und beschloss, dem Halbbruder und vor allem dessen Frau zu vertrauen. Sollte er seinen üblichen Weg über die Glockengasse und die Brückenstraße zurück nehmen? Er wählte den Weg an den Minoriten. Die Mauer des Franziskanerklosters zog sich lang hin und wirkte bedrohlich auf ihn. Er hatte große Angst, sie in der Dämmerung zu passieren. Doch glaubte Isfried sich hier der Vorsehung des Höchsten näher. Als er vorsichtig an der Mauer entlangschlich und sich immer wieder umdrehte für den Fall, dass er verfolgt wurde, kamen ihm unterdessen seine vielen Sünden in den Sinn und er war sich nicht mehr so sicher, ob Gott die Hand schützend über ihn halten würde.
Am Steynweg angelangt, schlug Isfried ein Kreuz und bedankte sich beim Herrn. Der Steynweg war breiter und hier trieb sich noch einiges Gesindel herum. Im ersten Augenblick beruhigte ihn das. Er fühlte sich nicht mehr allein und hilflos. Dann begann Isfried allerdings, sich vor jedem, dem er begegnete, zu fürchten. Blitzte nur ein Fetzen roten Stoffes auf, so vermeinte er, der Dolch werde ihm ins Herz gerammt. Er fasste sich an die Stelle, wo er den Stoß gefühlt hatte, aber er blutete nicht. Er kniff sich ins Bein. Zweifellos war er am Leben. Wer wollte es ihm nehmen? Der Ratsherr Andreas? Oder hatten ihn seine Sinne getäuscht? Isfried fühlte sich nicht in der Lage, beides zugleich zu tun, nämlich diese Frage zu ergründen und sich behutsam weiter fortzubewegen. Er verschob es auf später, darüber nachzudenken, wer ihn bedroht hatte. Wohlbehalten gelangte er an die Ecke zur Oben Marspforten und wusste nun, dass er gleich Brunos Haus erreicht haben würde. Die Oben Marspforten freilich war eng und düster.
Isfried beschloss, das letzte Stück zu rennen. Dann würde er sogleich zu Hause sein und überdies die Angst nicht spüren. Morgen würde er die Belohnung erhalten. Isfried freute sich bei diesem Gedanken. Das Schicksal meinte es gut mit ihm. Wenn ich mich dann später an den scharlachroten Mann erinnere, werde ich wissen, dass dies nur eine kleine Prüfung durch den Herrn war, ging es Isfried durch den Kopf.
Es drang kaum in sein Bewusstsein, dass der scharlachrote Mann offensichtlich schneller als er gewesen war, hinter einem Mauervorsprung hervortrat und diesmal nicht zögerte, ihm den Dolch direkt dorthin zu rammen, wo Isfried es vorhin schon zu fühlen vermeint hatte.
KAPITELII
»Alles Unvollkommene strebt zur Vollendung.«
Thomas von Aquin
Ich zitterte ein wenig, als ich hinter den sich leicht von einem Windhauch bewegten Vorhang schlüpfte, weil Ingeborg es mir nämlich diesmal verboten hatte. Sonst ließ sie mich zusehen, nachdem sie festgestellt hatte, dass ich solcherart mehr Freude empfand als daran, es selbst zu tun. In einer Art unausgesprochenem Einverständnis verheimlichten wir es meinem Lehrmeister, dem sarazenischen Gelehrten Averom, in dessen Obhut ich mich seit nunmehr sieben Jahren befand und mit dem ich seit zwei Jahren in Paris an der Universität weilte. Meister Arab, wie ich ihn zärtlich nannte, war Ingeborg zugetan und bezahlte sie dafür, mich in anderer Hinsicht zu unterrichten. Dass Ingeborg aus dem fernen Königreich Dänemark in den kalten Landen herkam, deutete schon ihr Name an, doch ihre fast durchsichtige Haut, ihre hellblauen Augen und ihr silbern schimmerndes, feines Haar machten es zur Gewissheit. Sie stammte aus gutem Hause und war entlaufen, als ihr Vater sie mit einem Grafen zu vermählen beabsichtigte, den sie als vertrocknet, grob und einfältig beschrieb. Fortan führte sie ein wildes Leben im Gefolge von Fahrensleuten und Burgsängern. In Luik, wo sie einige Zeit verbrachte, bevor sie, als sie ungefähr fünfundzwanzig Jahre zählte, nach Paris kam, entdeckte sie die Berufung zu dem Gewerbe, dem sie von da an nachging. Sie war größer als viele der Männer in Paris, ausgenommen die nordischen Studenten, und ihre Schönheit wäre vollendet gewesen, wären ihre Brüste ein wenig bescheidener und ihre Hüften etwas unbescheidener gewesen.
Ingeborg ging ihrem Geschäft in einem ehemaligen Heuspeicher auf der Rue du Fouarre nach. Der Heuspeicher war zum Schulraum der Artistenfakultät hergerichtet worden, um Studenten aus der ganzen Welt in die Sieben Freien Künste der Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie einzuführen. Man meinte, in dem Raume noch das süße Heu zu riechen, obgleich der herbe Duft des harzigen Holzes, aus dem die erst jüngst aufgestellten Bänke waren, überwog.
Die großen Magister Siger von Brabant und Roger Bacon hatten hier schon gelehrt, noch bevor es die Bänke gab und die Studenten statt dessen im Heu saßen, um ihren überaus weisen Worten zu lauschten. Später polterte ein anderer bedeutender Magister von Paris, Bruder Thomas von Aquin, vor uns Studenten: »Mein Widersacher Siger betreibt seine Lehre im Verborgenen, anstatt sich wie üblich der klösterlichen Einrichtungen zu bedienen.« Meister Arab, der Bruder Thomas fast mehr noch als Magister Siger schätzte, verübelte ihm das, vor allem, weil er sich gewünscht hätte, die beiden Scholastiker Thomas und Siger würden sich gegen den unheilvollen Einfluss der Franziskaner verbünden, die das Studium der Schriften des Aristoteles zu verbieten trachteten.
Während nun Siger und die anderen Magister am Tage den Hunger der Studenten nach Wahrheit stillten, befriedigten Ingeborg und ihre Freundinnen des Nachts denjenigen nach Fleischeslust. Zu selbigem Zwecke unterteilten sie den Raum mit leichten Vorhängen. Ingeborg war beliebt unter den gebildeteren Studenten, denn sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, den letzten Disputationen des Tages beizuwohnen, um auch ein paar Worte mit ihren Gästen wechseln zu können. Mehr noch jedoch, so nehme ich an, war ihre Beliebtheit darauf zurückzuführen, dass Meister Arab sie in morgenländischer Liebeskunst unterwiesen hatte. Während sich die meisten Studenten gierig auf die Weiber warfen und einem Wettlauf gleich zum Ziele strebten, wusste es Ingeborg besser als diejenigen ihrer Freundinnen, die es mit sich geschehen ließen, weil sie derart in der Lage waren, mehr Kundschaft zu bedienen. Meister Arab aber lehrte, dass die »unverzügliche Wollust«, wie er es nannte, nicht nur die wahre Freude unterbindet, sondern sowohl beim Manne als auch beim Weibe zu der schweren und bisweilen sogar tödlich verlaufenden Krankheit führt, die »Edica« genannt wird. So zündete Ingeborg ihre Besucher zuvor mit liebreizenden Worten und schmeichelhaften Zärtlichkeiten sorgfältig an und kannte für einen jeden die angemessene Stellung. Ingeborg hütete das Geheimnis, wie sie die übereiligen Buben zügeln konnte, und weil das deren Labsal nur erhöhte, nahm sie aufs Ganze gesehen mehr ein als ihre schnellen Freundinnen.
Ich tue dies dar, weil ich nicht möchte, dass man das Erstaunen und Erschaudern über das, was ich an jenem Tage mitansehen musste, einer übergroßen Empfindsamkeit oder mangelnder Kenntnis fleischlicher Dinge zuschreibt. Ingeborg begrüßte nun also einen hageren, bärtigen Studenten, der um einige Jahre älter war als ich. Er war groß und muskulös und trug ein gutes teures Gewand in blauer Farbe über seinem gelben Hemd, Schuhe mit einer sehr langen Spitze sowie eine rote Mütze auf dem Kopf. Mitten in seinem einfältigen Gesicht befand sich eine lächerlich kleine Stupsnase, als sei sie dort nur zu Besuch. Ich kannte ihn nicht und nahm an, er habe vielleicht schon das Studium der Theologie aufgenommen. Er machte einen so wohlhabenden Eindruck, dass ich vermutete, er müsse sich nicht wie ich seinen Unterhalt durch das Kopieren von Büchern verdienen – alldieweil ich mich darüber nicht beklagen sollte, denn dergestalt genoss ich den Vorzug, wohl mehr Bücher als alle anderen zu Gesicht zu bekommen. Ingeborg schien den Gast anders als mir schon vertraut.
»Ah, mein vom Schicksal so schwer gebeutelter Freund«, begrüßte sie ihn auf Diutisch, denn die Studenten kamen aus aller Herren Länder und nicht jeder lernte wie ich die Landessprache gut, so dass Ingeborg sich anheischig machte, zu ihnen zu sprechen in der Weise, wo sie also herkamen. Sie umarmte ihn kurz und drückte ihm einen Kuss auf die Wange, jedoch nicht in der Art einer Buhlerin, sondern in der einer liebenden Mutter. Der Student dagegen blieb stumm. Nur seine geweiteten wässrigen Augen wanderten unschlüssig hin und her.
»Bei mir«, sagte Ingeborg und blickte ihn dabei fest an, »müsst Ihr Euch nicht schämen. Für nichts. Nicht einmal der gütige Vater im Himmel schaut Euch hier zu.«
»Gott fürchte ich nicht so sehr«, flüsterte der Student mit dunkler Stimme und wandte seinen Kopf ab, wohl um ihrem Blick zu entgehen, »denn ich weiß, er ist barmherzig.« Offensichtlich wusste er dagegen nicht, wohin mit seinen Händen, die er fahrig mal vor dem Bauch faltete, mal die Arme seitlich hängen ließ oder gar auf den Rücken legte und sich dabei vorbeugte wie ein alter Mann.
»Wer also sitzt Euch im Nacken?«, fragte Ingeborg und strich, um ihren Gast zu beruhigen, vorsichtig über seinen Hals. Mit einem leichten Druck ihrer Hände brachte sie ihn dazu, sich auf die Bank zu setzen, und nahm dicht neben ihm Platz.
»Wenn ich seinen Namen nenne, wird das die ganze Sache verderben«, weinte der Student, um dann in einer heftigen Gebärde seine Arme nach oben zu reißen, fast als wolle er Ingeborg schlagen. »Und du bekämest dann auch nichts.«
Ingeborg aber war geübt und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Wenn Ihr es nicht sagt«, beharrte sie, ohne ihn aus dem Blick zu entlassen, »werdet Ihr auch keine Freude empfinden können. Denn Lust und Angst verhalten sich so gegensätzlich zueinander wie Himmel und Hölle.«
»Pah«, machte der Student verächtlich, zog den Mund schief und schloss seine Lider, »was braucht es eine Hölle, wenn man einen solchen elenden Schlappschwanz wie Richard zum Vater hat!«
»Aha!«, rief Ingeborg aus. Sie vollführte eine ausladende Bewegung mit den Armen und Händen. »Da haben wir es. Euer Vater, wo hält er sich nun auf?«
»Wo wohl?« erwiderte der Student ungehalten, wobei er die Augen endlich wieder öffnete. »In Regensburg!«
»Das ist so weit«, beruhigte ihn Ingeborg gütig, »dass nicht einmal ich diese Stadt kenne.«
»Wenn meine stolze Mutter es sehen könnte …«, heulte der Student und wischte sich übers benetzte Antlitz. »Ich schäme mich so.«
»Wenn es sie nicht gäbe, könntest du dich auch nicht erfreuen, denn dann wärst du nicht da«, sagte Ingeborg zärtlich.
Der Student wurde darob wieder roh und lief zornrot an. »Dieses ganze Geschwätz«, wütete er, »von: Du sollst Vater und Mutter ehren widert mich an! Mir ist zum Erbrechen! Der Magen dreht sich mir um! Ich möchte mich entleeren auf diesem Pack!«
Nun war es Ingeborg, die nichts sagte. Ich dachte schon, sie gebe auf und würde ihren Gast entlassen, ohne dass etwas geschehen sei. Doch dann beobachtete ich, wie sie sich einen Schuh vom Fuße zog und ihm diesen reichte. Ich verstand diese Geste nicht und konnte mir keinen Reim darauf machen.
Der Student nahm den dargebotenen Schuh mit der linken Hand entgegen, während er sich mit der rechten Hand entblößte. Dann holte er seinen erstarkten Lyedemyt hervor und benutzte den Schuh, als wäre er ein weibliches Vogelhuß. Seine Stöße wurden immer heftiger und schneller, ganz so, als vollzöge er einen normalen Akt der Unkeuschheit, bis er sich in den Schuh von Ingeborg ergoss. Dabei gab er jedoch keinen einzigen Laut von sich. Ingeborg schaute ihm mitfühlend zu. Währenddessen hielt ich erstarrt den Atem an und konnte nicht fassen, was ich da sah.
Alsdann richtete sich der Student wieder auf, brachte seine Kleider in Ordnung und schnippte Ingeborg drei Deniers hin, einen mehr, als sie verlangte. Hastig verließ er den Ort.
Ingeborg steckte die Münzen ein, trocknete ihren Schuh, seufzte und sagte zu sich: »Oh, was ist er nicht für ein armer Götzenjäckel!«
Darum also hatte sie mir dieses Mal das Spähen untersagt – um meiner zarten Seele diesen absonderlichen Anblick zu ersparen! Ich wartete, bis Ingeborg ging, um ihren nächsten Gast zu begrüßen, bevor ich wie betäubt hinter dem Vorhang hervorzukommen wagte und mich auf den Weg dorthin machte, wo Meister Arab, sein treuer Begleiter Ibrahim und ich unsere Bleibe hatten: auf der Petit-Pont, der Brücke, die das linke Seineufer mit der Îlle de la Cité verbindet, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hôtel-Dieu, einem Krankenhaus, in welchem Meister Arab ob seiner alles überragenden sarazenischen Heilkunst oft als Physikus aushalf. Ein Stückchen weiter legten Steinmetze letzte Hand an die vollkommenste Kirche zu Ehren der Gottesmutter mit Namen Notre-Dame, um sie in nächster Zukunft zu vollenden. Zu Hause angekommen, traute ich mich nicht, mit meinem Meister über das Vorgefallene zu sprechen.
Gewiss wäre meinem Gedächtnis diese kleine Begebenheit meiner Jugend entglitten, wenn nicht viele Jahre später unglaubliche Geschehnisse in meiner Mutterstadt Köln, wohin ich auf mancherlei Umwegen, zweiundzwanzig Jahre alt, im Jahre des Herrn 1274 nach dem Tode meines geliebten Meisters Arab zurückgekehrt bin, sie mir schmerzlich in Erinnerung gerufen hätten. Selbige bringe ich der Welt zur Kenntnis, auf dass ein jeder gewarnt sei vor dem sündigen Hochmute, den diejenigen zur Schau tragen, die da meinen, über ihre Mitmenschen zu Gericht sitzen zu dürfen, anstatt, wie es gottgefällig wäre, dies dem obersten Richter zu der von ihm gewählten Stunde zu überlassen. Denn der Herr spricht: »Die Rache ist mein.«
Wer mich nun aber fragt, warum ich so viele Dinge darlege, die die Menschen eigentlich voreinander geheim halten, weil es sie nur im Zwiegespräch mit Gott und seinen Stellvertretern bei der heiligen Beichte zu erörtern gilt, so antworte ich, dass nämlich erst in jüngster Zeit gewisse Leute alle Barmherzigkeit fahren lassen und statt dessen meinen, den Lebenswandel anderer beurteilen zu dürfen, ganz so, als seien sie nicht selbst elende Sünder. Doch siehe, es steht geschrieben: »Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.«
So also bete ich, wie Bruder Thomas von Aquin mich zu beten gelehrt hat: Erhabener Schöpfer, du Quelle des Lichtes und der Weisheit und überragender Ursprung allen Seins, schenke durch deinen Segen meinen Reden Anmut, meinem Erkennen Scharfsinn, meinem Lernen Weite und meinem Auslegen Leichtigkeit, auf dass ich mühelos die dir wohlgefälligen Worte finde. Du, der du wahrer Gott und Mensch bist und der du lebest und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
»Ich mache mir Sorgen, Bruder Physikus«, sagte Bruder Paul, der Koch in unserem Konvent, der so dick war, dass sein Versuch, das speckige Gesicht in Kummerfalten zu legen, unweigerlich fehlschlagen musste. Bruder Paul roch immer gut nach dem Essen, das er so meisterhaft zuzubereiten verstand, ausgenommen an Freitagen, an denen er um des Leiden Christi willen nicht umhin kam, nach ekelhaftem Fisch zu stinken. Ich war erst vor ein paar Tagen aus Sevilla nach Köln, meine Geburtsstadt, zurückgekehrt, nachdem ich fast fünfzehn Jahre mit dem sarazenischen Gelehrten Averom, den ich, wie gesagt, ebenso liebevoll wie respektvoll meinen Meister Arab nannte, bis zu dessen Tod im Jahre des Herrn 1272 in aller Welt umhergezogen war und die Theologie ebenso wie die Medizin gelernt hatte. Im Kölner Kloster meines Ordens, den Dominikanern, war der altehrwürdige Bruder Physikus kürzlich verstorben und demgemäß konnte ich trotz meiner jungen Jahre seinen Platz einnehmen.
»Große Sorgen«, bekräftigte Bruder Paul in seiner quiekenden Stimme. Da er nach wie vor nicht gesagt hatte, worum sich seine Sorgen drehten, schwieg ich und schaute ihn erwartungsvoll an. Bruder Paul hatte mich, als ich zur Terz auf dem Weg vom Spital zum Kreuzgang war, unweit der Küche abgefangen, aus der, wie es am heutige Tage nicht anders zu erwarten war, ein widerlicher Fischgeruch drang. Mir graute es schon vor dem Mahle.
»Um Magister Albertus«, rückte Bruder Paul endlich mit der Sprache heraus. Magister Albertus war der älteste Bruder unseres Konvents, zählte über achtzig Jahre, ein bedeutender Wissenschaftler, vor dessen unsäglicher Geisteskraft mir Meister Arab die größte Hochachtung beigebracht hatte.
»Was fehlt dem ehrwürdigen Magister?«, fragte ich ein wenig spöttisch, weil ich Bruder Paul nicht für den Mann hielt, der medizinische Zusammenhänge verstand.
»Er wird heute wieder nichts essen, obgleich er schon dermaßen ausgezehrt ist, dass es mich dauert«, antwortete Bruder Paul, der einfältig genug war, meinen Spott nicht zu bemerken. Seine wasserblauen kleinen Schweinsäuglein füllten sich mit Tränen.
»Bei Menschen in diesem hohen Alter ist Dürrheit leider nicht selten«, belehrte ich Bruder Paul hochmütig. »Aber nun sage mir, warum du die sichere Vorhersage treffen kannst, dass Magister Albertus heute wieder nichts essen wird?«
»Es ist doch Freitag!«, jammerte Bruder Paul in hohem Tone und richtete seine Augen flehentlich nach oben.
»Und Magister Albertus verweigert stets am Freitag, Speise zu sich zu nehmen?«, fragte ich verwundert.
»Ja«, quiekte Bruder Paul und schaute mich wieder an. »Es ist wegen des Fisches. Wenn er auch sonst alles vergisst, unser lieber Magister, so behält er doch, wie sehr er den Fisch verabscheut. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, die schmackhaftesten Zubereitungen bringen ihn nicht dazu, auch nur einen einzigen Bissen vom Fisch zu essen.«
»Wohl verständlich«, sagte ich. »Vor vielen Jahren hat der berühmte Bruder Petrus Venerabilis bemerkt, Fisch sei zum … na ja … Kotzen …«
»Das hat ein Bruder gesagt? Das ist gotteslästerlich!«, rief Bruder Paul mit der ganzen Empörung, derer er fähig war.
»Nein, das ist wahr«, berichtigte ich. »Und durch die Wahrheit lässt sich Gott nicht lästern. Wenn du also Magister Albertus etwas Gutes tun möchtest …«
»O ja, das möchte ich, bitte, bitte«, unterbrach Bruder Paul und klatschte freudig erregt, aber aufgrund seines Temperamentes doch ein wenig langsam mit seinen aufgeschwemmten Pranken, die er, der kurzen Arme wegen, kaum vor dem fetten Bauch übereinander brachte.
»… dann nimm eine Rohrdrommel, die ihres Lebenswandels wegen als Fisch zu gelten hat, wie der Bruder Thomas von Aquin sagte, ein jüngst zum Herrn abberufener Magister aus Paris, der einst Schüler von Bruder Albertus war und bei dem ich die Ehre hatte, einige Monate hören zu dürfen, und bereite dieselbe wie einen Fasan mit einer Tunke aus Zucker und Senf zu.«
»Was wird Herr Wido dazu sagen!«, erschrak Bruder Paul und riss die Augen weit auf.
»Du brauchst keine Angst zu haben, Bruder«, beruhigte ich ihn und dachte daran, dass mein Meister mich stets ermahnt hatte, nie Angst vor der Autorität von Menschen zu haben. »Herr Wido wird sich nicht getrauen, gegen das Wort von Bruder Thomas von Aquin Einspruch zu erheben.«
»Gott stehe mir bei«, murmelte Bruder Paul, schlug ein Kreuz und wuchtete seinen Körper wieder in die Küche.
Als wir uns dann nach der Sext zur Mittagstafel begaben, stellte ich freudig erstaunt fest, dass nicht nur Magister Albertus, sondern wir alle uns an dem schmackhaften Federvieh laben konnten. Es duftete herrlich, denn Bruder Paul hatte, meinem Rate folgend, jene Tunke aus Zucker und Senf bereitet, die ihresgleichen sucht.
»Was hast du mit dem Fisch gemacht?« fragte ich Bruder Paul leise. »Der war doch, dem Gestanke nach zu urteilen, schon fast fertig zubereitet.«
»Weggeworfen«, antwortete er und strahlte dabei über seine beiden rosaroten Backen. Doch sein Grinsen erfror, als er den harten Blick unseres Abtes, des besagten Herrn Wido, spürte.
Herr Wido entstammte einer reichen Kaufmannsfamilie im Norden – er gab den Namen nicht preis, da er sich gegen ihren Willen zum Dienst an Jesus Christus berufen gefühlt hatte und in den Bettelorden eingetreten war, während sein Vater ihn als den ältesten Sohn zum Nachfolger in dessen Geschäft auserkor. Herr Wido musste sich sogar gefallen lassen, dass ihn der Vater gefangen nehmen und für ein Jahr entführen ließ. Aber während des Jahres, das der Vater Herrn Wido unter Aufsicht gestellt hatte, ließ er sich nicht vom Glauben abbringen, und schließlich musste der Vater ihn ziehen lassen. Dieser Kampf zwischen Vater und Sohn hatte vielerlei Spuren in Herrn Widos Seele und auch auf seinem Gesicht hinterlassen: Da war die Härte um den schmalen Mund, die nötig war, um der Gewalt zu widerstehen. Da war auch die Trauer in den dunkelbraunen Augen, die den Sohn kennzeichnet, wenn er dem Willen des Vaters entgegenhandelt. Vor allem aber war da ein großes Verständnis für die freie Entscheidung eines jeden Menschen, weil diese allein dem gottgegebenen Gewissen verpflichtet sei und darum von allen Christenmenschen mit Würdigung behandelt werden müsse. Herr Wido war eher sich selbst als anderen gegenüber unerbittlich und dies drückte sich in seinem starken Körper mit den kantigen Formen vorzüglich aus.
»Oh, wie lecker«, freute sich hingegen Bruder Albertus. »Lässt uns unser Gedächtnis so sehr im Stich? Uns war, als müsste heute Freitag sein.«
»Heute ist Freitag«, warf Herr Wido scharf ein, indem er das Wort »ist« betonte.
Magister Albertus ließ es sich, als habe er nichts gehört, geräuschvoll unter lautem Schlürfen und Rülpsen mit großem Genuss munden und alsbald eiferten ihm die anderen Brüder darin nach. Ausgesprochen gierig gingen, wie stets, die Novizen ans Werk, und mir fiel besonders einer auf, der den Namen Gerhard trug, weil seine Haltung doch sehr zu wünschen übrig ließ. Nur Herr Wido, der einzige, der würdevoll und aufrecht dasaß, rührte die Speise nicht an.
Bruder Paul wand sich unter dem Blick unseres Abtes und stammelte: »Es ist so, ehrwürdiger Vater, ich habe … mit Bruder Johannes … es ist so … Bruder … äh …wie hieß er noch? … bitte, Bruder Physikus, erkläre du, bitte …«
»Gern, Bruder Paul«, sagte ich mit einem großen Bissen im Mund. Schnell nahm ich noch einen Schluck Wein, mit dem ich den Mund leer spülte. Um meinen Worten größeres Gewicht zu verleihen, stand ich auf. »Ehrwürdiger Vater, ich hatte ehedem das Glück, bei Magister Thomas von Aquin, einem Schüler unseres verehrten Bruders Albertus, in Paris zu hören. Magister Thomas hat statuiert, dass die Rohrdrommeln ihres Lebenswandels wegen unter die Fischen zählten und darum auch freitags um des Herrn willen durchaus zu genießen seien.«
Herr Wido entgegnete nichts, begann jedoch auch nicht mit dem Essen. Wir anderen aber verspürten gar wenig Neigung, uns dadurch in unserem Glücke beeinträchtigt zu sehen.
Ein Bruder – ich meine, es sei Willelmus gewesen – sagte in die Runde: »Beeilt euch, Brüder, es ist kundgetan worden, dass Bruder Emund von Regensburg auf dem Neumarkt noch vor der Non eine große Predigt halten wird.«
»Ein minderer Bruder!«, schmatzte Magister Albertus und verzog verächtlich den Mund. »Nehmt euch vor ihm in acht und misstraut seinen Reden!«
Als sich einige Brüder erhoben, um zum Neumarkte aufzubrechen, wandte sich Herr Wido an mich: »Johannes, mein Sohn, bist du dir ganz sicher, dass Magister Thomas die Rohrdrommeln den Fischen gleichgestellt hat?«
»Ehrwürdiger Vater«, antwortete ich sehr bestimmt, »ich bin mir nicht nur sicher, sondern ich habe es mit eigenen Ohren gehört.«
»Unser guter Thomas«, murmelte Bruder Albertus, der wohl das Gespräch mitbekommen hatte, »wir danken dir. Wir haben doch immer gewusst, wie unfassbar großen Geistes du bist!«
Wir drängten nun aus dem Saal und ich gewahrte noch, wie Herr Wido mit voller Freude in die übrig gebliebenen Reste griff, um sich nach Herzenslust zu sättigen.
Draußen war es sehr hell und wie immer, wenn ich aus dem Dunkel des Klosters trat, brauchten meine Augen eine Weile, bis sie sich daran gewöhnt hatten. Da wir uns nach Westen gen Neumarkt wenden mussten, schauten wir beständig in die grelle Sonne. Deren Wärme tat mir indessen wohl, denn die Klostermauern halten auch des Sommers eine Art klamme Kälte für ihre Bewohner bereit, die, wie mein Meister Arab zu tadeln pflegte, der Gesundheit allemal abträglich ist.
Es befanden sich, vom schönen Wetter begünstigt, gar viele Leute auf dem Neumarkt, denn Bruder Emund war bekannt dafür, eine kraftvolle, dem Volke überaus verständliche Sprache zu führen. Kannengießer, Schuster, Gerber, Leinweber und andere Handwerker hatten ebenso wie die Händler, die Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Tücher oder Gewürze feilboten, die Gelegenheit genutzt, ihre mühselige Arbeit zu unterbrechen. Bauern waren zusammen mit ihren Weibern, Knechten und Mägden vom Feld gekommen, und natürlich fehlten auch nicht das Bubenvolk und andere Müßiggänger, immer auf der Suche nach Unterhaltungen, um Gottes kostbare Zeit totzuschlagen. Es gab ein lärmendes und buntes Gerangel und der ganze Platz war erfüllt von dem Geruch, der unweigerlich entsteht, wenn sich zu viele Menschen auf zu engem Raume befinden. Als ich mit einigen der Mitbrüder eintraf, war die Predigt schon in vollem Gange. Ich hörte Bruder Emund, an seiner braunen Kutte und der Barfüßigkeit unschwer als Minorit zu erkennen, das erste Mal, doch mir däuchte, dass ich die große, hagere Gestalt mit dem einfältigen Gesicht und der viel zu kleinen Stupsnase schon einmal gesehen hatte. Ich konnte mich allerdings nicht erinnern, wo und wann das gewesen sein konnte. Für Bruder Emund war ein hölzerner Turm errichtet worden, der ihm als Kanzel diente. An der Seite des Turmes wehten Banner, um den Zuhörern die Windrichtung anzuzeigen, damit sie wussten, nach welcher Seite seine Worte am besten zu hören seien.
Die Stimme von Bruder Emund war volltönend, wenn auch für meinen Geschmack etwas zu selbstgerecht, so als gebreche es ihm an der geziemenden Demut.
»Wenn ich also zu euch spreche über die Sünde, liebe Kölner Christenmenschen«, rief Bruder Emund gerade, als wir in Hörweite kamen, »dann fragt ihr mich wohl: Sag, Bruder Emund, wie riecht diese Sünde? Etwa wie fauliges Aas?
Darauf aber antworte ich: Nein!
Ihr fragt sogleich: Wie verfaulter Käse? Und wieder sage ich: Nein!
Also fragt ihr mich: Riecht sie denn wie fauliger Fisch? Nein, das tut sie auch nicht, entgegne ich euch.
Und weiter fragt ihr: Stinkt sie etwa nach Mist?
Nein, nein, das alles ist falsch. Die Sünde riecht danach, dass ihr dem Tode nahe seid. Ja, ihr habt recht gehört: dem Tode nahe! Ihr, ihr alle, die ihr hier versammelt seid, ebenso wie die, die unbeirrt ihrem Tagewerk nachgehen, ihr alle hier in Köln seid dem Untergang geweiht! Das aber sage ich euch also! Da nämlich fragst du dich vielleicht, Adelheid«, Bruder Emund zeigte auf ein vor ihm stehendes junges Weib, »ist die Sünde meiner unzüchtigen langen Haare und meines unkeuschen Putzes so groß, als dass ich Unglück bringe über alle meine lieben Mitbürger? Nein, antworte ich. Gehe in dich, werde stille und komme zurück auf den Pfad der christlichen Tugend, die gottgefällig ist, aber sorge dich nicht zu sehr: Denn, das sage ich euch, die Verzweiflung, sie ist auch eine Sünde. Die Sünde, von der ich spreche, ist eine Sünde, die mich stumm macht. Ihr werdet es mir nicht glauben, da ihr wisst, wie gut ich mein Maul zu gebrauchen verstehe, das mir der Herr in seiner Gnade gegeben hat, aber hier muss ich schweigen.«
Bruder Emund hielt in der Tat inne, und die Zuhörer schauten ihn erwartungsvoll und sogar ein bisschen ängstlich an. Konnte es sein, dass er an dieser Stelle seine Predigt abbrach und sie im ungewissen darüber ließ, ob welcher Schuld sie der Herr mit dem Tode bedrohte? Meine Brüder schubsten und stießen sich durch die Menge nach vorn, um besser mitzubekommen, was nun geschehen würde. Ich jedoch blieb zurück, denn ich hatte eigentlich schon genug gehört. Natürlich! Bruder Emund stammte aus Regensburg, wo er vermutlich bei dem barfüßigen Prediger Berthold gelernt hatte, der dortselbst mit verführerischen Reden und falschen Wundern die Menschen verhexte. Während die franziskanischen Magister, mit denen mein Meister Arab in Paris disputiert hatte, zumindest der Sprache des Geistes mächtig waren, wenn sie sie auch nicht verstanden, so waren diese Prediger, wie er sagte, unwürdige Gaukler des Herrn.
Nun aber schickte sich Bruder Emund an, fortzufahren: »In der Nacht kam der Herr zu mir und klagte mir sein Leid, dass nämlich hier in Köln einer sei, der diese Sünde wider die Natur begehe. Und da der Herr nicht falsch spricht, so fand ich keinen Schlaf mehr, sondern wandelte durch die Stadt, bis ich endlich fand, was mir aufgetragen worden war.
Nein, ich kann es nicht aussprechen! Ich bringe es nicht über die Lippen! Sie sollen stumm bleiben und schweigen von dem, was ich sah. Mit meinen eigenen Augen sah! Ich aber sage euch, dass ich nur hingeschaut habe, weil es der Herr von mir verlangt hat, denn ihr könnt gewiss sein, dass ich viel lieber weggeschaut hätte!
Von zwei Männern aber spreche ich, die, wie der Apostel sagte, den Gebrauch der Frau aufgegeben und den natürlichen Verkehr vertauscht haben. Denn sie sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben.«
Bruder Emund hatte es geschafft, sogar mich in den Bann zu ziehen. Alle Ablehnung der Barfüßer, die mir mein Meister Arab mitgegeben hatte, vermochte es nicht, meinen Widerwillen gegen die Sünde zu mildern, von der da gerade gesprochen wurde – der stummen Sünde.
»O du unglückliche Stadt Köln, du armselige Stadt!«, klagte Bruder Emund und wandte seinen Blick zum Himmel. »Rache, du verteufelter Sodomit!, rufen die Kinder, die nicht zur Welt kommen durften deiner verfluchten Sünde wegen. Gerechter, großer Gott, übe Vergeltung an dem, der unser Vater sein könnte auf Erden, für uns, die wir geboren worden wären und durch seine Schuld nicht zur Welt gekommen sind.« Bruder Emund nahm nun wieder die Zuhörer in den Blick. »Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über die Stadt Sodom, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und vernichtete die Stadt und die ganze Gegend und alle Einwohner der Stadt und was auf dem Lande gewachsen war.
Wie Sodom aber bist nun du, schönes Köln, des Unterganges, weil es nicht irgendjemand ist, der sich auf so schlimme Weise an Gott vergangen und gegen die Natur gefrevelt hat, sondern es ist ein Ratsherr von euch, vor dem ihr noch meint, euch in Ehrfurcht verneigen zu müssen, weil ihr um seine stumme Sünde nicht wisst.«
Als Bruder Emund hier eine Pause machte, begannen viele aus der Menge zu rufen, er möge den Namen preisgeben: »Wer ist es? Wer? Bitte, Bruder Emund, gib es bekannt! Wir werden ihn richten, damit wir leben!«
»Sein Name aber ist … Andreas … Andreas Kleingedank.«
Da ich Köln im zarten Alter von sieben Jahren mit meinem Meister Arab verlassen hatte und, wie gesagt, erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt war, kannte ich diesen Andreas nicht. Wohl aber wusste ich, dass meine Mutter mit dessen Bruder Wolfhardt verheiratet war. Doch nicht Wolfhardt ist mein Vater, sondern, wie mir Meister Arab offenbarte, als er die Zeit für angemessen hielt, der verstorbene Erzbischof Konrad, was mich weniger der schändlichen Geburt wegen betrübte als wegen der Tatsache, dass ich aus dem Samen eines so unehrenhaften Mannes stammte. Wolfhardt jedenfalls hatte mich, nachdem ich von der Wanderschaft zurückgekehrt war, herzlich an Vaters Statt ins Herz geschlossen und ich fürchtete jetzt, dass er sich ebenso wie meine liebe Mutter der Enthüllung über besagten Andreas wegen grämen würde.
Die Menge war aufgebracht und alle schrien durcheinander und trampelten mit den Füßen, pfiffen oder trommelten sich mit den Fäusten auf die Brust.
Bruder Emund hob seine Hände, gebot Ruhe und sagte: »Liebe Christenmenschen, seid getrost! Ich bin vom Herrn abgesandt worden, um euch zu retten. Danket dem Herrn für seine überfließende Gnade! Bis dass der Frevler gefasst ist und er die Tat mit seinem Leben gesühnt hat, werde ich für euch beten, wie es einst Abraham für Sodom getan hat, um beim Herrn einen Aufschub zu erreichen. Um den Zorn des Herrn zu besänftigen, brauche ich ein Paar Schuhe von einer Jungfrau als sichtbares Unterpfand dafür, dass ihr auf dem rechten Wege zurück zum Herrn seid.« Bruder Emund wandte sich an die, die er vorhin Adelheid genannt hatte. »Dein Schuhwerk, liebe Tochter Adelheid, scheint mir gerade recht.«
»Ich heiße nicht Adelheid«, sagte die Angesprochene errötend.
»Gleichviel, ich nenne euch Jungfrauen alle bei diesem Namen«, beschied Bruder Emund kurz. Das hielt er wohl wie Berthold höchstselbst. »Gib mir um des Wohls deiner Mitchristen willen deine Schuhe!«
»Neue könnt ich mir nicht leisten«, wehrte sie zaghaft ab.
Da rief Bruder Emund in die Runde: »Diese Jungfrau hier gibt ihre Schuhe, um euch alle zu retten, da möcht ich meinen, dass ihr Schusterhunde euch wohl verstehen könntet, sie ihr für Gottes Lohn zu ersetzen.«
In der Tat fand sich sogleich ein lütter Schuster, Vogelo mit Namen, bereit, der bezeichneten Jungfrau neues Schuhwerk zu fertigen. Während Emund nun die Schuhe entgegennahm, hatte ich wiederum das Gefühl, ihn einstmals schon gesehen zu haben. Es musste lange her sein und dessentwegen wollte es mir nicht möglich sein, mir das entsprechende Bild ins Gedächtnis zu rufen. Ich bahnte mir den Weg durch das Gewühl, weil ich nach meiner Mutter und ihren Gatten sehen wollte.
Ich drückte mich durch die Menge, um zur Casiusgasse zu gelangen, denn ich musste, um zum weißen Haus meiner Mutter an der alten Mauer zu gelangen, gen Norden mich wenden. Die Begarden, die hier ihren neuen Konvent errichteten, wimmelten – von Bruder Emunds Predigt gänzlich unbeeindruckt – munter herum und ich musste ein wenig warten, bis sie einen Sparren aus der engen Gasse entfernten, der mir den Weg versperrte. Ich querte die Streitzeuggasse, um über die übel beleumundete Filzgasse auf den Berlich zu gelangen, wo die bedauernswerten Dirnen schon zu dieser Stunde auf ihre Freier warteten. Meine Mutter Hadwig leitete seit vielen Jahren das weiße Haus zwischen der Schwalbengasse und der Armenstraße, in welchem sie gefallene Mädchen in christlicher Nächstenliebe beherbergte und zur Arbeit anhielt, auf dass sie sich und ihre Kinder ehrlich ernähren konnten, ohne der Hurerei verfallen zu müssen. Es hieß das »weiße« Haus, weil die Mädchen stets von Kopf bis Fuß in weißes Linnen gewandet waren zum Zeichen, dass ihre Herzen im Gegensatz zu ihren Körpern rein waren. Ich war noch ganz von dem Versuch gefangen, die Erinnerung zu ergründen, die ich an Bruder Emund vermeinte zu haben, als ich an der Pforte klopfte und meine Mutter öffnete.
Meine Mutter war keine junge Frau mehr, zählte sie nun ja schon sechsunddreißig Jahre, aber konnte den Männern wohl noch gefallen, obgleich sie, der schweren Arbeit wegen, die sie leistete, weniger Speck ansetzte, als gemeinhin als erstrebenswert gilt. Da ich trotz ihrer Heirat mit Wolfhardt ihr einziges Kind geblieben bin, fragte ich mich bang, ob sie wohl eine Josephsehe führten, und ich hätte, wenn ich nicht im Konvent gewohnt hätte, gern gespäht, wie sie die Nacht verbrachten, weil ich mich nicht getraute, diese Frage zu stellen.
Anstatt den gehörigen Gruß zu entrichten, wie es sich geziemt hätte, murmelte ich: »Die Schuhe, es muss etwas mit den Schuhen zu tun haben.«
»Was redest du da, mein Sohn?«, fragte meine Mutter.
»Geliebte Mutter!«, rief ich. »Es ist ein Unglück geschehen. Dem Bruder deines Gatten wirft der Prediger der minderen Brüder vor, sich der sodomitischen Sünde hingegeben zu haben …«
»Tritt ein, mein Sohn«, sagte meine Mutter gefasst. »Wir wissen es bereits, Wolfhardt und ich. Er … er ist hier.«
Meine Mutter geleitete mich in den kleinen privaten Raum, den sie mit Wolfhardt bewohnte. Der Raum war höchst sorgfältig und liebevoll eingerichtet. Alles in ihm – von den sauber verarbeiteten Bohlen auf dem Boden über die schön verzierten Stühle und den gediegenen Tisch bis hin zu dem einladenden Bett – war von den Mädchen selbst gewirkt worden, und ich kam nicht umhin, ihre Handwerkskunst aufs äußerste zu bewundern. In diesem heimeligen Raume befand sich der bedrückte Ehemann meiner Mutter. Der aus der vornehmen Familie der Kleingedanks stammende Wolfhardt war trotz seines gewaltigen Bartes ein gemütlicher Mann, bei dem die Weichheit des Fleisches der seines Temperamentes entsprach, während sich nicht bestätigte, dass, wie Bruder Thomas meinte, dicke Männer besser denken würden. Vielmehr verhielt es sich dergestalt, dass Wolfhardt jedem Grübeln ebenso wie der frommen Kontemplation abhold war. Da er es vorzog, das einfache und arbeitsame Leben mit meiner Mutter zu teilen, als sich dem Überfluss hinzugeben, den seine Familie ihm ermöglicht hätte, sprach manch ein Kölner ihm die heilige Einfalt zu.
Erst auf den zweiten Blick sah ich den Bruder von Wolfhardt, den Ratsherrn Andreas Kleingedank, der in sich zusammengesunken und zitternd auf einem Stuhle hinten in einer dunklen Ecke hockte. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, denn er verbarg es mit seinen Händen, die blass-grau waren wie der Tod. Sein dichter, weithin gerühmter blonder Haarschopf hatte sich in den verkrampften Fingerspitzen verfangen und war zerzaust. Ich bemerkte, dass sein ganzer langer, dürrer Körper unter seinem roten Gewand zuckte, und dann vernahm ich auch schon sein leises Schluchzen.
»Als er hörte, worauf die Predigt hinauslief«, sagte Wolfhardt, »rannte er her, um sich zu verstecken. Ihn packte große Furcht, dass das stinkende Gesindel ihn in Stücke reißt.«
»Du kannst die Vorwürfe doch wohl entkräften?«, wandte ich mich betroffen an Andreas. Der aber blieb stumm.
»Im Gegenteil, mein Sohn. Er gesteht«, antwortete Wolfhardt an Stelle seines Bruders. Wolfhardt kraulte kummervoll seinen Bart.
»Diese übergroße Schande für die Familie!«, rief ich entsetzt.
»Habe ich dich bei dem größten Liebhaber unter den Gelehrten dieses Erdenkreises in die Lehre geschickt«, fragte meine Mutter in unerwartet tadelndem Ton, »damit du derart unvernünftige Ansichten hegst?«
Im Augenwinkel nahm ich wahr, wie Andreas die Hände von seinem verheulten Gesicht nahm, um meiner Mutter einen dankbaren Blick zuzuwerfen. Empört wollte ich etwas erwidern, aber ohne recht zu wissen, wie mir geschah, hörte ich, wie ich sagte: »Er erkennt die Schuhe.«
»Du redest wirr, schon als du eingetreten bist, geschätzter Sohn. Sag uns, was soll das bedeuten!«, herrschte meine Mutter mich an.
»Der Prediger, Bruder Emund«, erklärte ich pflichtschuldigst, »er halst Schule, als seien sie eine weibliche Saltzmeste.« Weil meine Mutter erwähnt hatte, Meister Arab sei ein so feuriger Liebhaber gewesen, war mir wieder in Erinnerung gekommen, was ich in Paris erlebt hatte. Zweifelsohne handelte es sich um den Studenten, der nunmehr auf dem Neumarkte als Bruder Emund predigte …
»Wie widerlich, nicht wahr, Hadwig?«, entfuhr es Wolfhardt. Er warf einen schnellen Seitenblick auf seinen Bruder, der sich daraufhin wieder die Hände vors Gesicht schlug.
»Woher weißt du das?«, fragte meine Mutter mich und zog ihre Augenbrauen unheilvoll zusammen.
Ich fürchtete, sie würde mir meine damalige Sünde der Schaulust vorhalten, also stammelte ich eher, als dass ich sprach: »Der Prediger ließ sich von einem Mädchen, das er als Adelheid ansprach, die Schuhe geben, mit denen er den eigenen Worten zufolge Gott um Aufschub der Bestrafung für die Sodomie bitten könne, die die Kölner in ihrer Mitte dulden. Dann befahl er Vogelo, dem Schuster, dieser Adelheid neue Schuhe zu machen. Das erinnerte mich … Meister Arab … in Paris … ein Mädchen … hat es uns erzählt … damals … Warum bist du mir darob so böse, liebe Mutter?«
»Geschätzter Sohn«, beruhigte sie mich. »Du missverstehst mich. Erzähle der Reihe nach, wie du zu der Kenntnis kommst, dass Pater Emund Schuhe brutet.« Sie lachte und mit ihr versuchte auch Andreas, etwas wie ein Lachen seiner Kehle zu entringen, während Wolfhardt sein Eheweib mit gerunzelter Stirn anschaute. »Eine ungemein lustige Vorstellung.«
»Könnte es sein, dass du derartige Dinge etwas zu leicht nimmst?«, schleuderte ich ihr ungehalten entgegen. Doch dann erzählte ich gehorsam, woher ich erfahren hatte, dass der Mann, der sich Bruder Emund nennt, die Sünde begeht, die man Immunditia oder Mollitia nennt. Ich sagte nicht alles, was mir nun ins Gedächtnis trat, aber es reichte, um die Neugier meiner Mutter zu befriedigen. Wie sollte ich ihr denn gestehen, was ich selbst dem Beichtvater nur unter größter Pein anvertrauen konnte?
»Und du hast keinen Zweifel in deinem Herzen?«, fragte meine Mutter.
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortete ich. »Warum diese Frage?«
»Du wirst unverzüglich nach Paris reiten …«, begann meine Mutter.
»Nichts dergleichen werde ich tun«, unterbrach ich scharf, denn nicht einmal meiner Mutter wollte ich gestatten, mich in Widerspruch zu den Regeln meines Ordens zu bringen. »Du solltest wissen, dass mich mein Gelübde hindert, mich anders als dem leuchtenden Beispiel meines Herrn Jesus Christus folgend auf den gottgegebenen Füßen fortzubewegen.«
»Meinetwegen kannst du hinkriechen, wenn es nur schnell genug vorangeht«, knurrte meine Mutter. »Dort wirst du die besagte Dirne suchen und mit nach Köln bringen, auf dass sie gegen Emund aussagt. So wird es möglich sein, diesen Teufel bloßzustellen, damit wir den Hetzer wider Andreas zum Schweigen bringen können. Er fordert, wie du weißt, seinen Tod und ich halte Erzbischof Engelbert für jemanden, der sich eine Gelegenheit nicht entgehen lassen wird, Andreas los zu werden, der schon lange im Rat sein Widersacher ist.«
Andreas sprang auf und fuchtelte mit den Armen. Sein verquollenes Gesicht hatte nun einen wilden Ausdruck angenommen. Ich dachte, dass er, wäre er in anderer Verfassung, sehr vornehme Gesichtszüge sein eigen nennen konnte, ganz anders als sein eher grobschlächtiger Bruder. Ich wartete eine Weile, denn ich nahm an, Andreas wolle etwas sagen. Er aber brachte keinen Ton heraus.
»Wie könnte durch die Schuld des einen diejenige des anderen aufgewogen werden?«, fragte ich dann abweisend.
»Gar nicht«, mischte sich nun Wolfhardt in das Gespräch ein. Andreas ließ die Hände sinken und schaute seinen Bruder mit ausdruckslosen Augen an. »Es verhält sich nur so, musst du bedenken, dass mein Bruder im Rat der Stadt unser Haus in Schutz nimmt gegen die Versuche des Erzbischofs Engelbert, es schließen zu lassen. Engelbert hasst es, weil es von seinem Vorgänger, Erzbischof Konrad, einst gegründet wurde. Konrad stattete es mit den mannigfaltigsten Privilegien aus, so dass wir weder Bierpfennig noch andere Abgaben zu leisten haben, was die Einnahmen von Engelbert empfindlich schmälert. Aber da die Privilegien auf ewig beeidet sind, kann er sie nicht ohne weiteres aufheben.«
»Stifter des Hauses war Konrad zwar nicht selbst«, berichtigte meine Mutter kleinlich. »Aber das tut nichts zur Sache.«
»Gleichviel, ich verstehe nicht, was das mit deinem Willen zu tun hat, dass ich nach Paris gehen soll, vorausgesetzt, mein geliebter Abt gibt mir die Einwilligung.«
»Du wirst dir die Einwilligung holen«, bestimmte meine Mutter. »Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Sprich mit Magister Albertus. Er wird sie für dich bei Herrn Wido erwirken.«
Dies aber stellte eine neue Erfahrung für mich dar, denn obwohl Meister Arab unbedingt strenge Zucht hielt, legte er stets den größten Wert darauf, dass ich seine Anordnungen vollständig verstand und billigte und dergestalt mein Gehorsam nie mit meiner Vernunft in Konflikt geraten konnte. Mich auf die beschwerliche Reise nach Paris zu begeben, ohne genau zu wissen, welcher Zweck damit verfolgt wurde, gefiel mir nicht. Ebenso jedoch war es mir unmöglich, mich der Weisung meiner Mutter zu widersetzen. Der Klang ihrer fordernden Stimme löste bei mir ein bisher unbekanntes Gefühl aus.
Als ich das Haus verließ, weigerte ich mich, Andreas der eingestandenen stummen Sünde wegen den Abschiedsgruß zu entrichten, obwohl ich spürte, wie sehr ihn das kränken musste.
Die Predigt von Bruder Emund war offensichtlich beendet, als ich auf die Gasse hinaustrat. Die meisten Leuten gingen wieder ihren Beschäftigungen nach, während einige in kleinen Grüppchen zusammenstanden und je nach Temperament ehrfurchtsvoll, sorgenvoll oder belustigt die Schmach des Ratsherrn Andreas besprachen. Ich aber eilte ins Kloster, um unter dem Vorwand, eine unaufschiebbare Beichte ablegen zu müssen, die Ruhe von Magister Albertus zu stören.
Magister Albertus war auf einem harten Stuhl sitzend in seiner Klause ins Gebet vertieft. Ich vernahm, dass er zum wiederholten Male den Namen der gebenedeiten Jungfrau und Gottesmutter Maria anrief. Es hing der Geruch des hohen Alters in der Luft. Auf dem Tisch vor ihm bewegte ein Luftzug einige der Pergamente, die dort neben dem Schreibzeug lagen, damit er seine Gedanken festhalten konnte.
»Ehrwürdiger Vater, uns besonders verbundener Bruder und Magister«, begann ich zaghaft und setzte mich auf einen Schemel, der einzigen verfügbaren Sitzgelegenheit. »Ich benötige Euren geschätzten geistlichen Beistand.«
»Unser Sohn«, sagte Magister Albertus freudig mit seiner alten Stimme, vergaß allerdings, sich herumzudrehen, und so sprach ich mit seinem Rücken. Mir fiel auf, wie recht Bruder Paul hatte: Magister Albertus war nicht mehr als Haut und Knochen. »Es ist schön, einen gebildeten Geist um uns zu wissen. Was ist es, das dich bedrückt?«
»Ich muss mich zwischen zwei Sünden entscheiden«, sagte ich zerknirscht.
»Wir müssen also, unterstützt von Unserer Lieben Frau, herausfinden, welche die geringere von beiden ist. Ist es das, was du meinst?«, fragte Magister Albertus scharfsinnig, denn sein Denken hatte durch das Alter keineswegs Schaden genommen, außer der Fähigkeit, sich an die Dinge des Alltags zu erinnern, die unwiederbringlich verloren ward.
»Ja«, antwortete ich.
»So also beginne und lege uns dar, um welche Sünden es sich handelt«, lud mich Magister Albertus ein.
»Die eine Sünde wäre Ungehorsam wider meine Mutter, Hadwig Kleingedank«, fasste ich kurz zusammen.
»Eine wahrlich schwere Sünde«, bestätigte Magister Albertus und nickte leicht mit dem Kopf. »Nun nenne uns die andere Sünde und warum du die eine oder die andere begehen musst, also nicht von beiden lassen kannst.«
»Meine Mutter verlangt von mir, dass ich nach Paris gehe …«, setzte ich an.
»Das wäre keine schwere Sünde«, unterbrach Albertus und wandte mir nun doch das Gesicht zu. Ich schaute ihm in die alten, bleichen Augen. Nimmer in meinem Leben hatte ich einen so betagten Menschen gesehen. Dieses von vielen Jahrzehnten Erfahrungen mit den Menschen, Gesprächen mit Gott und Beschäftigung mit der Natur gezeichnete Gesicht flößte mir eine derartige Ehrfurcht ein, als hätte ich tatsächlich eine Gestalt aus dem Alten Testament vor mir. Ich dachte an Abraham. Ich sah, dass Magister Albertus ein wenig lächelte, so als ob er mich nicht ganz für voll nähme in meiner Seelenqual.
»Dorten soll ich«, setzte ich erneut zu einer Erklärung an, »nach der Dirne Ingeborg suchen, mit der Bruder Emund als Student Umgang hatte, wovon ich Kenntnis besitze, weil ich in Paris, wie Ihr wisst, studierte.«
»Hat der Hundsfötter von einem Minoriten also doch noch einen letzten Funken menschlicher Leidenschaft in sich«, bemerkte Magister Albertus zufrieden. »Einfache Unzucht ist natürlich kein so besonders schwerwiegendes Vergehen.«
»Er hat … wie soll ich es Euch sagen, ehrwürdiger Vater?«, druckste ich verlegen herum.
»Wir sind alt, unser Sohn, es gibt nichts, was wir nicht schon gehört hätten«, beruhigte mich Magister Albertus gütig.
»Er hat keinen natürlichen Geschlechtsakt ausgeführt, sondern Hand an sich selbst gelegt«, erläuterte ich.
»Wozu dann die Dirne?«, fragte Magister Albertus vernünftig und nun doch etwas beeindruckt, wie ich an seinen leicht hochgezogenen Augenbrauen ersehen konnte.
»Bruder Emund«, antwortete ich, »benutzte dazu ihren Schuh und wollte, dass sie zugegen sei.«
»Hm«, machte Magister Albertus. »Nun, woher weißt du das?«
»Die Dirne hat es meinem Meister Arab erzählt, der ihr freundschaftlich zugetan war«, antwortete ich.
»Du meinst wohl Averom, einen großen Gelehrten mit allzu überfließender Lendenkraft«, warf Magister Albertus ein. »Was bringt dich dazu, den Worten einer Dirne Glauben zu schenken?«
»Ich«, begann ich verlegen. »Ich selbst … Ich war sehr jung …«
»Nun heraus mit der Sprache, unser Sohn, so schlimm kann es doch nicht sein!«, unterstützte Magister Albertus mein Geständnis.
»Hinter einem Vorhang … Also, ich habe selbst dabei zugeschaut.« Ich erwartete für dieses Vergehen eine gehörige Strafe, doch nichts in der Art geschah. Als hätte ich nicht gerade eine Ungeheuerlichkeit zugegeben, fuhr Magister Albertus in seinem Gedankengange fort:
»Welche Sünde meinst du nun, unser Sohn, damit zu begehen, wenn du dem Wunsch deiner Mutter entsprechend dich auf die Suche nach der Dirne von Bruder Emund machst?«
»Ihr Ziel ist es«, antwortete ich erregt, »das Ansehen von Bruder Emund zu erschüttern, um dadurch den angeklagten Ratsherrn Andreas Kleingedank, Bruder ihres Gatten, entlasten zu können. Ihr habt es vernommen? Er hat die Sünde der Sodomie begangen!«
Magister Albertus nickte kaum sichtbar.
Ich führte meine besorgte Überlegung nun zu Ende: »Es scheint mir eine Sünde zu sein, einem offensichtlichen Sünder beistehen zu wollen.«
Magister Albertus hob beide Hände vor sich und begann, sie wie Waagschalen auf und ab zu bewegen. Schließlich hielt er inne, wobei die rechte Hand in der unteren Stellung verharrte. »Die Sünde der Unreinheit verstößt gegen die natürliche Zweisamkeit des Geschlechtlichen, also könnte sie am schwersten wiegen.« Albertus wechselte die Stellung der Hände. »Das aber ist falsch. Denn es handelt sich nur darum, die Zweisamkeit unterlassen zu haben. Die Sodomiter treiben demgegenüber Missbrauch, weil sie das geziemende Geschlecht verfehlen.«
»Meint Ihr denn wirklich, ehrwürdiger Magister«, fragte ich, wie ich schon meine Mutter gefragt hatte, ohne eine Antwort erhalten zu haben, »dass die Sünde des einen die des anderen aufwiegen könnte? Wenn jemand einen Räuber entlarvt, wäre der Räuber dann freizusprechen, wenn ruchbar wird, dass sein Ankläger ein Mörder ist?«
»Du hast Recht, unser Sohn«, pflichtete Magister Albertus mir bei, um mir dann aber doch gründlich zu widersprechen: »Soweit es dein Beispiel betrifft. Hier geht es jedoch um ganz andere Sünden, als es Mord und Raub sind. Sie schließen kein Unrecht gegen eine andere Person ein und sind somit von untergeordneter Bedeutung. Die eigentliche Sünde von Bruder Emund ist, dass er die Sache an die große Glocke hängt.«