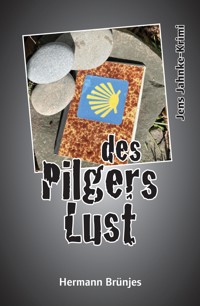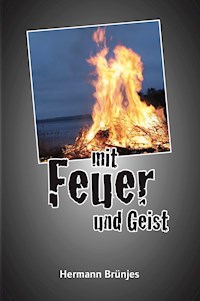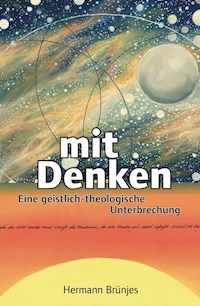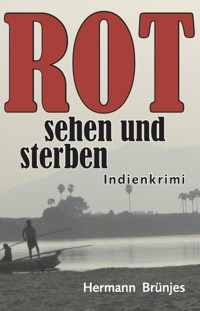1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er hat es nach zwei gescheiterten Ehen wieder als Single versucht. Hermann Brünjes beschreibt seine Erfahrungen mit dem Allein leben und seine manchmal skurrilen und doch so normalen Erlebnisse. Wie ein Single über fünfzig seine Sonn- und Feiertage gestaltet, sich sozusagen weltweit auf Partnersuche begibt, seinen Urlaub und die Herausforderungen des Alltags zu meistern versucht und nicht nur in seinen Beziehungen, sondern gewissermaßen auch als Single scheitert – darum geht es in diesem unterhaltsamen Büchlein über die Liebe, das Leben, das Scheitern und den Glauben.
Der Autor reflektiert und erzählt humorvoll und mit einem guten Schuss Selbstironie, erhebt dabei jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er deutet seine eigene und die Situation anderer Singles vom christli-chen Glauben her, ohne dabei moralisch oder dogmatisch zu werden. Auch ist dieses Buch weder Rezeptesammlung noch Ratgeber für´s glückliche Sin-gledasein.
Hermann Brünjes veröffentlicht seine oft sehr persönlichen Bekenntnisse nicht nur, um zu unterhalten, sondern um vor allem älteren Singles Mut zum Leben und Lieben zu machen. Und wenn jene Leserinnen und Leser, die ihre Ehe bis jetzt hingekriegt haben, ihr Herz für Singles öffnen und ihnen offen und akzeptierend begegnen, haben sie verstanden, worum es dem Autor geht. Hermann Brünjes, geboren 1951, ist kirchlicher Mitarbeiter, Vater zweier großer Kinder, zweimal geschieden, seit April 2010 erneut und glücklich verheiratet und fröhlicher Christ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
50 Plus und plötzlich Single
Anekdoten und Betrachtungen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Hermann Brünjes
Fünfzig plus
und plötzlich
Single
Anekdoten und Betrachtungen
BookRix April 2013
Kontakt Autor: [email protected]
Worum es geht
Er hat es nach zwei gescheiterten Ehen wieder als Single versucht. Hermann Brünjes beschreibt seine Erfahrungen mit dem Allein leben und seine manchmal skurrilen und doch so normalen Erlebnisse. Wie ein Single über fünfzig seine Sonn- und Feiertage gestaltet, sich sozusagen weltweit auf Partnersuche begibt, seinen Urlaub und die Herausforderungen des Alltags zu meistern versucht und nicht nur in seinen Beziehungen, sondern gewissermaßen auch als Single scheitert – darum geht es in diesem unterhaltsamen Büchlein über die Liebe, das Leben, das Scheitern und den Glauben.
Der Autor reflektiert und erzählt humorvoll und mit einem guten Schuss Selbstironie, erhebt dabei jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er deutet seine eigene und die Situation anderer Singles vom christlichen Glauben her, ohne dabei moralisch oder dogmatisch zu werden. Auch ist dieses Buch weder Rezeptesammlung noch Ratgeber für´s glückliche Singledasein.
Hermann Brünjes veröffentlicht seine oft sehr persönlichen Bekenntnisse nicht nur, um zu unterhalten, sondern um vor allem älteren Singles Mut zum Leben und Lieben zu machen. Und wenn jene Leserinnen und Leser, die ihre Ehe bis jetzt hingekriegt haben, ihr Herz für Singles öffnen und ihnen offen und akzeptierend begegnen, haben sie verstanden, worum es dem Autor geht. Hermann Brünjes, geboren 1951, ist kirchlicher Mitarbeiter, Vater zweier großer Kinder, zweimal geschieden, seit April 2010 erneut und glücklich verheiratet und fröhlicher Christ.
50 Plus und plötzlich Single
Die Nacht war kurz. Wieder habe ich schlecht geschlafen. Irgendetwas klappert am Dach. Vielleicht fallen Zapfen oder Äste von der Kiefer neben meinem Haus auf die Pfannen. Tauben gurren. Einen Wecker brauche ich seit Monaten nicht mehr. Je später ich ins Bett gehe, desto eher wache ich auf. Nicht, dass mir meine Gedanken den Schlaf rauben. Das auch. Aber es ist, als stände ich unter Drogen, Aufputschmitteln. Ohne sie jedoch zu nehmen. Doch da ist eine Unruhe in mir. Ein Gefühl des Fehlenden, des Mangels. Als ob etwas Aufregendes bevorsteht, von dem ich gleichzeitig weiß, dass es nicht eintritt. Gut, anderen geht es noch schlechter. Ein Freund von mir, einige Jahre jünger, schläft kaum noch und er weiß nicht, warum. Was mich betrifft, ich weiß es.
Ich stehe auf, gehe ins Bad, dusche und rasiere mich. In der letzten Woche habe ich mir einen neuen Rasierer gegönnt. Und einen schönen, großen Flachbildschirm für meinen Computer. Für kleine Momente freue ich mich über solche selbst gemachten Geschenke. Nicht, dass ich mich in den Konsum stürze. Dazu fehlen mir das Geld und die Lust. Doch ab und zu... einer muss sich ja schließlich um mich kümmern. Zur Not ich selbst. Also genieße ich meinen Rasierer, solange er den Reiz des Neuen vermittelt. Und meinen hellen, breiten Monitor.
Ich ziehe mich an. Ein Berg ungebügelter Hemden fordert mich heraus. Kein Problem, nur jetzt nicht. Keine Lust zum Bügeln. Zeit hätte ich schon, und etwas anderes zu tun im Moment auch nicht. Außer das Schuppendach zu erneuern, den Rasen zu mähen, ein längst auf die Fertigstellung wartendes Buch zu beenden... Ja, ich hätte doch genug zu tun. Ich könnte auch arbeiten, obwohl heute mein freier Tag ist. Vielleicht ginge es mir dann besser. Aber nein, frei ist frei – und ich will nicht vor mir selbst davon laufen. Die Arbeit in meiner Situation ist ein ganz eigenes Thema, speziell was meine Aufgaben als kirchlicher Mitarbeiter angeht.
Ich suche mir eines der bügelfreien Polohemden heraus. Davon habe ich viele und muss erst nach etwa zehn Tagen einen Waschtag einlegen. Und dann setze ich meine Espressomaschine in Gang und bereite mein Frühstück vor. „Guten Morgen!“ „Wie immer.“ „Drei Roggen?“ „Ja, danke! Und ein kleines Brot.“ ... die Dialoge beim Bäcker ähneln sich Tag für Tag. Was soll ich auch erzählen? Übers Wetter zu reden ist mir zu doof. Mit meinen Backwaren in der Lenkertasche des Fahrrades düse ich wieder zu meinem Haus.
Inzwischen ist die Espressomaschine warmgelaufen und ich brühe mir einen Cappuccino auf. Auch diese Maschine habe ich mir gegönnt, gleich als es anfing. Und das war eine wirklich gute Investition, trinke ich jetzt doch richtig edlen und vor allem bekömmlichen Kaffee. Mit Mitte fünfzig ist man eben nicht mehr der Jüngste. „Mit dreißig ist die Garantie vom lieben Gott abgelaufen“ hat mal ein Arzt zu einem befreundeten Pastor gesagt. Recht hat er. Und mit fünfzig schon lange! Mein Schwachpunkt ist der Magen. Cappuccino allerdings vertrage ich. Wie gut! Ich lese das Bibelwort aus der Losung. Ein kurzes Gebet. Eigentlich wollte ich ja länger beten. Meine Fürbittenliste ist enorm umfangreich. Ich kenne tausend Leute, bin in vielen Projekten involviert, habe alle möglichen Verbindungen. Aber keine Lust zum Beten. Lieber lese ich Zeitung. Es zerstreut besser als Beten, viel besser. Und inzwischen mache ich sofort wenn ich die Küche betrete, mein kleines Radio an, jeden Morgen zum Cappuccino. NDR Info. Da wird immer gesprochen. Musik macht mich eher nervös. Stimmen hören beruhigt. Und bildet. Allerdings kann ich mittags manche der Nachrichten und Reportagen beinahe auswendig, da sie dauernd wiederholt werden. Aber immerhin redet da jemand. Zwar nicht mit mir, aber doch während ich frühstücke. Und da ich das Radio einfach laufen lasse, auch wenn ich in einem der anderen Räume meines Hauses bin, kann fast der Eindruck entstehen, es sei noch jemand im Haus. Ist aber nicht.
Ja, mein Haus. Es ist schön. Eigentlich ist es ein ganz normales, eher kleines Haus, gebaut für eine ganz normale Familie. Doch jetzt ist es ein großes Haus, ein manchmal zu großes Haus. Nicht dass ich nicht genügend Möbel hätte, es zu füllen. Nein, nein, es ist komplett eingerichtet und ich habe es richtig schön, genauso wie ich es mag. Immer wieder freue ich mich über die Räume und schaue hinein mit dem Gedanken, dass die Einrichtung okay ist. Aber...ich bin nicht okay. In den meisten dieser Räume lebe ich nicht, ich durchstreife sie eher wie eine Raubkatze ihren Käfig. Ich setze mich nicht, und wenn, dann nur kurz, nur solange mein Frühstück oder mein Mittagessen oder das Abendbrot oder die Arbeit am Schreibtisch oder das Bügeln oder das Fernsehen oder irgendeine andere Beschäftigung es erfordern. Danach bin ich sofort wieder unterwegs, unruhig und allein.
Allein? Ja, allein. In meinem großen kleinen Häuschen, im Auto unterwegs zu Terminen, zwischen Menschen in Gruppen, auf Tagungen und am Schreibtisch. Wie ein einsames Raubtier. Der einsame Wolf? Noch nicht ganz. Aber wenn es so weitergeht auf dem besten Weg dahin.
Einsam - als Christ?
Ein Christ ist einsam? Das gibt es doch nicht, oder? Jesus ist doch immer da. Und Gott ist überall. Und die Schwestern und Brüder aus der Gemeinde auch. Ob mit dem was nicht stimmt, wenn er einsam ist? Vielleicht der Glaube. Wahrscheinlich, er glaubt eben nicht genug! Er hält nicht für wahr, dass Jesus an seiner Seite geht. Er hat sich die in so vielen Predigten erzählte Geschichte von den Spuren im Sand nicht zu Herzen genommen: „Jene einsame Spur im Sand, mein Freund, sie ist nicht von Dir. Es ist meine Spur. Da habe ich Dich auf meinen Schultern getragen!“ Wenn er einsam ist, jener Christ, dann hat er letztlich selbst Schuld, dann glaubt er Gott nicht.
Genau! Vielleicht ist dies das richtige Stichwort: Schuld. Einsamkeit ist Schuld! Da glaube ich den Gott an meiner Seite nicht, den Immanuel, den Gott mit uns, den Auferstandenen, den Gott, der mich auf seinen starken Schultern trägt wie ein guter Hirte sein geliebtes Schaf. Einsamkeit ist Ausdruck von Verlorenheit, von Gottesferne, oder zumindest von leblosem, sich nur theoretisch aber nicht praktisch verstandenem Glauben. Christus macht glücklich! Das zu erleben war ja gerade Grund meines Glaubens, damals auf der Jugendfreizeit und den Offenen Abenden, und während des Glaubenskurses. Ein tiefes Glücksgefühl hatte mich erfasst. Er war da, für mich! Nichts mit Einsamkeit!
Und nun sollte derselbe Christ einsam und unglücklich sein? Was ist passiert? Ist er von Glauben abgekommen, vielleicht nicht theoretisch, aber praktisch? Ein richtiger Christ wird doch nicht unglücklich – und wenn, dann gibt er es sich selbst gegenüber natürlich nicht zu. Das stellt doch alles in Frage!
„Sich outen verboten!“
Nein, es geht hier nicht um Homosexualität. Sich darin zu „outen“ (auf deutsch: „offenbaren“) birgt zwar Gefahren, vor allem in christlicher Szene, es kann jedoch inzwischen getrost gewagt werden. Vielleicht nicht in gewissen Kreisen evangelikaler und fundamentalistischer Glaubensüberzeugungen. Dort darf man sich ohnehin kaum „outen“, weder mit seiner Sexualität, noch mit seinen Zweifeln, noch mit den heimlichen Leidenschaften und Sehnsüchten. „Fromm ist, wer sich besonders gut versteckt,“ oder eben „wer sich selbst verleugnet“. Wo solche heimlichen Regeln gelten, findet ein „sich outen“ natürlich nie oder nur selten statt – und wenn, dann mit verheerenden Folgen. Kompromisslos wird ausgegrenzt und in die wie auch immer geartete Ecke gestellt.
Zum Glück nicht bei uns in der evangelischen Kirche. Wer bei uns schwul oder lesbisch ist, sollte das zwar nicht ständig herumposaunen, muss jedoch kaum mehr Angst vor Diskriminierung haben. Auch wer geschieden ist, darf das sagen. Mit der Scheidung der einstigen hannoverschen Landesbischöfin Frau Dr. Käßmann scheint auch der letzte Bann gebrochen. Zwar gibt es Widerspruch. Doch zum Glück wird nicht mehr ohne wenn und aber „rausschmeißen!“ gefordert, sondern es geht „nur“ noch darum, ob sie im Amt bleiben kann oder nicht. Wir Evangelischen haben wohl weit gehend begriffen, dass Ehe ein irdisch Gut ist und damit auch vergänglich sein kann. Also, hier geht es nicht vor allem um das Thema Scheidung, wenn auch indirekt. Es geht um die Einsamkeit, und besonders um die Einsamkeit von Christen. Und sich darin zu outen ist durchaus riskant, zumindest außerhalb geschützter Räume. Solche Offenbarung wird oft nicht ohne Folgen bleiben. Und es geht auch um jene Erfahrung, die sich mit dem Titel im ersten Teil dieses Büchleins verbindet: „Fünfzig plus und plötzlich Single“. Ich habe den Eindruck, ein Tabu-Thema anzusprechen. Und genau deshalb riskiere ich diese Zeilen. Sollte ich sie jemals veröffentlichen, dann deshalb, um jene zu unterstützen, die auch durch ihr eigenes aber auch durch unser Verschweigen einsam geworden sind. Und sollte ich sie nicht veröffentlichen, dann deshalb, weil dieses Thema entweder für die angefragten Verlage ein Tabu darstellt und aus Marketinggründen kein Interesse daran besteht – oder weil ich mich denn doch nicht traue, diese Bekenntnisse preiszugeben.
Sonntag - welcome home!
Der Tag des Herrn.
Leider klappt es mit dem Ausschlafen nicht wie gewünscht. Immerhin, bis kurz nach acht hält es mich im Bett, wenn auch nicht schlafend, kuscheln, schmusend ... Darauf musste ich lange verzichten und frage mich, ob dies einen Teil meiner Unruhe ausmacht. Keine körperliche Nähe, kein Streicheln, Küssen, Hautkontakt, kein Sex. Kein Wunder, wenn etwas fehlt. Auch am Tag des Herrn. Ich frage mich, wie meine katholischen Kollegen es mit dem Zölibat hinkriegen. Völlig enthaltsam, emotional und sexuell abgestumpft – oder Selbstbefriedigung als Dauerzustand und der Rest wird in Begegnungen und im Dienst am Menschen platonisch sublimiert? Keine Ahnung. Gott sei Dank, ich bin evangelisch! Auch wenn es mir nicht wirklich hilft bei der Sehnsucht nach Nähe.
Der „kleine Gottesdienst“
Heute gehe ich nicht in den Gottesdienst, habe ich beschlossen. Gestern habe ich selbst eine lange Andacht mit Abendmahl und persönlichen Segnungen geleitet. Heute nehme ich mir frei. Früher, noch mit Familie, haben wir das dann immer „der kleine Gottesdienst“ genannt, eben jene Stunden am Sonntagvormittag im Bett und dann am Frühstückstisch, mit Urlaubsqualität. Jetzt sitze ich allein auf meiner Terrasse, mit Ei, Marmelade, Kaffee und Zeitung. Nicht schlecht, aber eben auch nicht „sonntagsrund“.
Eigentlich genieße ich es, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Oft finde ich Inspiration, manchmal nette Begegnungen hinterher und immer Ruhe zum Gebet. Heute also mal nicht. Ich lasse mir Zeit beim Lesen der Zeitung, gehe dann einmal ums Haus und suche hinten am Schuppen meine gestern verlorene Uhr. Verlorenes suchen, das passt ja durchaus zum Sonntag. Gestern habe ich einen Baum gestutzt. Am Abend war meine Armbanduhr verschwunden. Wie vor Tagen bereits schon einmal, muss sich das Armband gelöst haben und weg ist sie ... Ich bin froh, dass Gott zumindest mit mir bei all seiner Mühe doch hoffentlich immer wieder fündig wird. Jedenfalls kann ich nicht sagen, dass mein Glaube geringer oder mein Gottvertrauen schwacher geworden ist, seit ich allein bin. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ein junger Mann fragte mich einmal, ob mich die Erfahrung der Trennung und Scheidung, also das Scheitern, eigentlich von Gott weggebracht habe. Meine Antwort kam sofort und völlig überzeugt: „Im Gegenteil, gerade die Erfahrung des Scheiterns treibt mich zu Gott!“
Meine Armbanduhr finde ich trotzdem nicht. Ich versuche es mit einem kurzen Gebet. Da gibt es genügend Zeugenberichte, wo Verlorenes gefunden wurde, weil jemand betete. Bei mir klappt es nicht. Überhaupt, ich habe längst aufgegeben, aus meinem Beten, der Erhörung und meinem neu gestärkten Glauben eine kausalistische Kette zu machen: Wenn, dann! So funktioniert das nicht, jedenfalls nicht bei mir. Aber ich habe nicht aufgehört zu beten. Und ich nehme das, was dann geschieht oder eben auch nicht, aus der Hand Gottes – mal mehr, mal weniger dankbar.
Was mache ich heute? Wen kann ich besuchen? Wen anrufen? Ich entscheide mich für eine Fahrt nach Lüneburg. Mein Rad nehme ich mit, damit ich dort beweglich bin. Die Stadt hat Stil und Atmosphäre. In der Straße mit den Cafés spielt eine Band. Der Anhänger einer Getränkefirma ist zur Bühne umfunktioniert worden. Die Musik ist gut, aus dem Bereich Blues, Jazz und Country, nichts Eigenes aber gut interpretiert. Ich schließe mein Fahrrad an und setze mich in eines der Bistros. Die Sonne scheint, es ist warm. Ich bestelle mir ein Wok-Gericht und gönne mir Lachs mit Reis und Gemüse. Lecker! Wenn man wie ich allein ist, soll man sich gelegentlich etwas gönnen – finde ich. Und es müssen ja nun nicht immer ein neuer Flachbildschirm oder andere teure Dinge sein. Mal Essen gehen tut es auch. Ich muss ohnehin an mir arbeiten, was das Genießen angeht. Da habe ich Defizite. Ich arbeite, ich esse und schlafe, ich arbeite wieder, oft schnell, ziel- und ergebnisorientiert. Ich grinse in mich hinein. Als schlechtes Beispiel von Lebensqualität führe ich gelegentlich meinen ehemaligen Zahnarzt an. Er hatte ein Schild an der Wand mit folgendem Text darauf: „Arbeite, friss und erwirb, zahl Steuern und stirb!“ „Welch ein furchtbares Leben!“, dachte ich damals immer, wenn ich es während der Behandlung mit offenem Mund las. Und heute rutsche ich beinahe selbst in diese Ecke. Das Leben genießen kann ich nicht so gut. Jetzt, am Sonntag, kann ich es üben.
Das Bistro ist voll. Ich habe dennoch einen guten Platz erwischt, einen Tisch mit zwei Stühlen. Allein kann man schnell Entscheidungen treffen: Wo gehe ich Essen? Was mache ich heute? Keine Diskussionen, keinen Streit, kein trotziges, muffeliges oder gar beleidigtes Nachgeben. Trotzdem, ich hätte mich gerne gestritten. Dann wäre auch der zweite Platz belegt und ich hätte jemanden zum Reden. Wie die meisten anderen um mich herum. Merkwürdig, wie selbst lästige Erlebnisse mit meiner Verflossenen an Glanz gewinnen. Jene Einkäufe, wo ich keine Lust mehr hatte und lieber neben angebundenen Hunden draußen vor der Tür gewartet habe, als meiner Frau mit schlurfendem Schritt von Regal zu Regal zu folgen. Und wie grässlich war manchmal die Auswahl eines Sitzplatzes in einem Restaurant. Mal war´s zuviel Qualm, mal zu laut, mal zu kalt, mal zu warm, mal liefen blöde Kellner herum – und manchmal sind wir nur deshalb wieder hinausgegangen, weil wir uns nicht einigen konnten, was es zu essen geben sollte. Nun denn, jetzt habe ich ja alle Freiheiten.
Etwas später kommt eine junge Frau, die auch allein ist und setzt sich an den Nachbartisch. Zwanzig Jahre jünger und ich hätte sie angesprochen. Und vielleicht wäre ein Paar daraus geworden. Doch jetzt wäre das ganz daneben. Ich schaue die vorbeigehenden Leute an, jene Beschäftigung, die wohl für die meisten von uns köstlicher schmeckt als der schönste Wok-Lachs. Die Pärchen wecken Wünsche in mir. Anfassen, sich küssen und in den Arm nehmen, einander verliebt anschauen, miteinander reden. Für mich fällt das flach, jedenfalls im Moment. Ein Mann in meinem Alter schlurft vorbei, sieht ziemlich traurig aus. Ob der auch allein lebt? Er sieht so aus. Wie jemand aussieht, der allein lebt? Keine Ahnung. Er guckt vor sich auf den Boden, abgestumpft, vom Leben nichts mehr erwartend. Oder er schaut unruhig von Mensch zu Mensch. „Bist du jemand, mit dem ich reden kann? Würdest du dich an meinen Tisch setzten? Hätten wir uns etwas zu sagen? Könnten wir sogar Freunde werden? Oder gar ein Paar?“. Keine Ahnung, wie jemand aussieht, der allein lebt und dazu noch einsam ist. Erwachsene können sich zudem bestens verstellen. Ganz anders als jene Kinder dort, die sich vor einer Drogerie die Gesichter schminken lassen. Ihnen sieht man sofort an, ob sie fröhlich oder traurig sind. In den meisten erwachsenen Gesichtern dagegen erkenne ich nichts, oder fast nichts. Unsere nicht gemalten Masken verstecken uns und kaschieren unsere wirklichen Gefühle, auch die Einsamkeit.
Dabei wäre es doch prima, wenn sich alle zum Alleinsein bekennen würden. Mit einem Schild um den Hals: „Lebe allein, bin allein!“ Oder: „Wer setzt sich zu mir, suche jemanden zum Reden!“ Oder: „Einsame Endvierzigerin sucht Mittfünfziger“. Oder einfach nur: „Bin (noch) Single!“ Oder ein Symbol, so was Markantes wie die Aidsschleife, als in allen Medien bekannt gemachtes Erkennungszeichen für Singles auf der Suche. Na, das wäre was! Kontaktanzeigen und Partnerplattformen im Internet wären dann überflüssig. Einmal durch Lüneburg und ich bin sicher, es käme zumindest zu vielen Gesprächen und vielleicht wäre ja jemand dabei ... Spinnerei? Ja, leider. Oder auch zum Glück. Wir Menschen können unser eigenes Scheitern kaum ertragen, wie sollen wir dann jenes der anderen verkraften. Auch würden unsere Sehnsüchte, Gefühle und Schwächen unzählige Glücksritter und Geldmacher anlocken und wir würfen uns allzu schnell den Wölfen zum Fraß vor. Trotzdem, es wäre schon spannend zu sehen, wer von denen hier allein lebt und wer nicht. Und wer sich so fühlt.
Ich zahle. Dabei rede ich mit einer Frau! Mit der Kellnerin. Wenigsten habe ich was zu reden. Etwas später auf meinem Fahrrad, schweige ich. Ich radle durch die Straßen der Stadt, schaue in Winkel, durch die ich zu Fuß niemals gehen würde. Selbst große Städte wie New York oder Berlin habe ich so erkundet. Ich kann viel sehen, ohne fußkrank zu werden. Das gefällt mir. Vielleicht ist ja mein ehemaliger Kollege zuhause, der nach Lüneburg gezogen ist. Ein kleiner Besuch kann nicht schaden. Doch er ist nicht da. Es ist ein wunderschöner Sommertag, wer bleibt da schon zuhause? Und am Sonntag schon gar nicht! Man unternimmt etwas mit seinem Partner oder der Familie, man besucht Freunde, geht mit der Freundin ins Schwimmbad, amüsiert sich mit der Clique beim Straßenfest. Oder man radelt eben allein durch die Straßen, wie ich.
Einsam und ... allein?
Allein sein muss natürlich nicht gleichzeitig auch Einsamkeit bedeuten. Das habe ich früh begriffen. Auch allein Lebende können ein erfülltes Leben genießen, mit Freunden, Bekannten und viel, viel Gemeinschaft. Anders herum gibt es viel Einsamkeit auch in der Gruppe, in der Familie und sogar in der Ehe. Dennoch, seit ich allein lebe, bin ich einsamer denn zuvor. Ich will das nicht. Ich weiß, dass man selbst etwas dagegen tun kann und muss. Also fahre ich am Ende meines Ausfluges zu einem befreundeten Ehepaar mit kleinem Kind und Hund. Mit großer Freude werde ich willkommen geheißen. Nicht vom Hund, der bellt und knurrt zunächst wider den Eindringling. Doch auch er wird nachher zutraulich und kann von meinen Streicheleinheiten nicht genug bekommen. Komisch, früher bin ich Hunden meistens aus dem Weg gegangen. Nun streichle ich sie. Ob das auch mit meiner Single-Situation zusammenhängt? Den Hund streicheln, sonst ist ja auch niemand da. Und der lässt es sich ohne Widerspruch gefallen. Nur dass er nicht zurück streichelt! Ob jene Singles mit Hund sich ihn angeschafft haben, um ihr Alleinsein zu überwinden? Oder zumindest zu verdrängen? Ich weiß es nicht, kann es mir aber sehr gut vorstellen.
Anders als der Hund ist das Baby. Als sein Vater ins Haus geht und es allein mit mir im Garten sitzt, schreit es wie am Spieß. Furchtbar, wenn Vater und Mutter ihr Kind verlassen. Wahrscheinlich ist dies die tiefste aller Einsamkeiten in die man je fallen kann. Von den Eltern verlassen. Nicht die Trennung von der Freundin oder Ehefrau, nicht die Abnabelung der Kinder ins eigene Leben und das Zurücklassen der Eltern, nicht plötzlich dastehen ohne wirkliche Freunde, sondern die Trennung von Vater und Mutter im Kindesalter ist die Spitze der Einsamkeit. Was mag im Kopf dieses Babys vorgehen? Selbst die vertraute Umgebung tröstet nicht mehr, nicht die Spielsachen, nicht die Kuscheldecke. Allein gelassen. Vater geht. Wir sind getrennt. Du bist verschwunden, ich bin allein. Furchtbar!
Ob der Grund unserer Einsamkeit in der Trennung vom Vater liegt, vom Vater im Himmel? Nicht nur theologisch, auch existenziell ist dieser Gedanke überaus spannend. In der uralten und sich doch immer wiederholenden Geschichte vom Paradies und dessen Verlust wird ja tatsächlich die Einsamkeit begründet. Nur verlässt da nicht der Vater das Kind, sondern das Kind den Vater. Wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. „Sündenfall“ nennen wir vordergründig und einfach, was doch so hintergründig und vielschichtig ist. Und es geht dabei eben nicht um Moral. Die kam erst später, als Adam und Eva sich voreinander schämten und ihr Mannsein und Frausein meinten verstecken und verkleiden zu müssen. Es geht um die Trennung vom Vater. Und die macht einsam.
Selber Schuld?
Also doch. Wenn ich als Christ einsam bin, lebe ich in Sünde?! Also ich ändere meine Einsamkeit und vermeide damit diese Sünde, oder ich lasse sie mir vergeben. Oder wie?