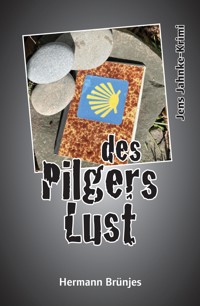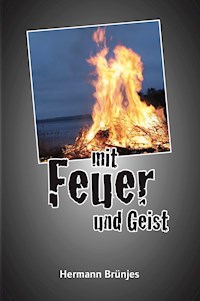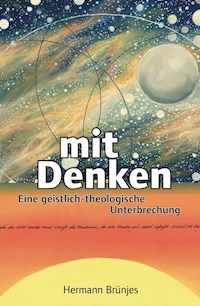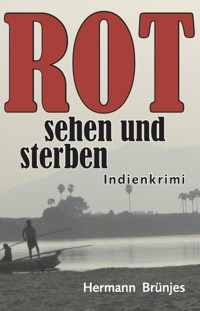3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jens Jahnke Krimi
- Sprache: Deutsch
Putins Krieg eskaliert, Preise und Ängste gehen durch die Decke. Wälder brennen. Das Trinkwasser wird verseucht. Aktivisten für eine lebenswerte Zukunft werden ermordet. Rechte Populisten, Verschwörungs- und Weltuntergangs-Sekten finden Zulauf. Auch der Lokalreporter Jens Jahnke und seine Kollegin Elske werden in den Strudel der 'Zeitenwende' hineingezogen. Was zunächst wie eine zufällige Häufung an Unglück und Verbrechen aussieht, erweist sich als geplant und arrangiert. Auch dieser siebte Krimi nimmt christliche Gedanken auf, diesmal die am Ewigkeitssonntag gefeierte Hoffnung auf eine neue Welt, und stellt sie in den Kontext aktueller Ereignisse. Begleiten Sie die Reporter nach Himmelstal, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, das es in sich hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hermann Brünjes
Der achte Engel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Mittwoch, 24. August
Samstag, 27. August
Mittwoch, 21.09.
Donnerstag, 22.09.
Freitag, 23.09.
Samstag, 24.09.
Sonntag, 25.9.
Mittwoch 28.9.
Donnerstag, 29.9.
Samstag, 1.10.
Dienstag, 4.10.
Mittwoch, 5.10.
Freitag, 7.10.
Sonntag, 9.10.
Montag 10.10.
Mittwoch 12.10.
Freitag, 21.10.
24.10. Montag
Mittwoch, 26.10.
Montag, 31.10. (Reformationstag)
Mittwoch, 2.11.
Freitag, 4.11.
Samstag, 12.11.
Montag, 14.11.
Sonntag, 20.11. (Ewigkeitssonntag)
Epilog
Wichtigste Personen
Autor, Hinweise zum Buch und weitere Bücher
Impressum neobooks
Prolog
Der achte Engel
Ein Jens Jahnke-Krimi von Hermann Brünjes
Gewidmet jenen Menschen in Dorf und Region,
die unter den Krisen unserer Zeit leiden,
Angst vor der Zukunft haben und nach einer Perspektive suchen,
die wieder Freude ins Leben bringt.
Danke.
„Gott sei Dank!“
Im Sicherheitsschloss knackte es, er drückte gegen den Rahmen und die hellgraue Außentür öffnete sich. „Ich bin drin“, dachte er und grinste, weil er an die uralte Werbung mit Boris Becker denken musste.
„Warum sie sowas nicht besser sichern, ist kaum zu verstehen. Nicht einmal Kameras gibt es hier.“
Während er das sagte, schob er die Tür zur Hälfte auf. Eine schlanke Gestalt, wie er selbst ganz in schwarz gekleidet und mit Gesichtsmaske versehen, schob sich wortlos an ihm vorbei. Auch er betrat das flache Gebäude am Dorfrand von Himmels-tal und schloss leise die Tür.
Der Strahl seiner Maglite-Lampe glitt durch einen kahlen Flur, dann nach links. Ein Schreibtisch, das dunkle Display eines Monitors, an der Wand eine Karte.
„Das muss der Versorgungsplan des Landkreises sein.“
„So ist es. Ich mache mich gleich an die Arbeit.“ Seine Partnerin saß bereits auf dem Drehstuhl vor dem Schreibtisch und fingerte am PC-Terminal unter dem Tisch herum. Sie sprach akzentfrei mit fast jugendlicher Stimme. Der Bildschirm erwachte. Sein Dunkel füllte sich mit Zahlen, die im Rhythmus der über die Tastatur huschenden Finger lange, ständig wechselnde Zeilen ergaben. Plötzlich war ein Bild da.
„Ich bin drin!“
Wieder musste er schmunzeln, sagte doch sie jetzt, was er vorhin gedacht hatte. Boris Becker und die AOL-Werbung von 1999 wird seine Partnerin allerdings nicht kennen – war sie doch damals kaum geboren!
Er riskierte ein Foto von der gerahmten Landkarte und benutzte den integrierten Blitz des iPhone. Unter seiner Kapuze lächelte er.
„Es wird vermutlich schneller gehen, als wir vermutet haben.“ Vom PC kam keine Antwort.
Die Zahlenreihen waren verschwunden und stattdessen Karten, Säulendiagramme und Listen zu sehen. Seine Partnerin schien Teil der Maschine geworden zu sein. Was um sie herum geschah, nahm sie vermutlich nicht mehr wahr. Gut so, er war nicht hier, um die Hackerkünste seiner Schwester im Herrn zu bewundern. Durch eine Glastür kam er in den eigentlichen Betriebsraum. Der Kegel aus Licht huschte über riesige rote Tanks, weiß leuchtende Rohre, blaue Pumpen und silbrige Metallkonstruktionen. Der Boden war gefliest oder aus glattem, hell getünchtem Beton gegossen, die kurze Treppe hinunter aus Edelstahl. Die Stahlelemente erinnerten ihn an seinen Mobilbaukasten von früher – nur alles war ungleich riesiger.
Seine dunkle Ledertasche klapperte, als er sie unten neben der Treppe auf die Fliesen stellte. Er öffnete sie. Vorsichtig holte er einen großen Behälter aus Kunststoff heraus, dann einen Satz Steckschlüssel und eine Knarre, mit der sie benutzt wurden. Er begann seine Arbeit. Schieber und Ventile schließen, Pumpe vom Netz, zweimal acht mächtige Schrauben lösen, das Anschlussstück vom Filtertank entfernen, den Inhalt seines Kanisters in die Pumpe entleeren – und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Wie geplant und mehrfach geübt, brauchte er knapp 45 Minuten. Sie würden vermutlich das beim Auseinanderschrauben der Rohrverbindungen ausgetretene Wasser entdecken. Sonst jedoch würde es keine Spuren geben, zumal sie beide dünne Latexhandschuhe trugen. Seine Partnerin hatte den Fluss des Wassers digital gestoppt. Erst wenn sie längst in Sicherheit waren, würde das kostbare Nass wieder durch die Leitungen rauschen und den gesamten Landkreis mit Trinkwasser versorgen. Danach würde es fast zwei Wochen dauern, bis sie checken würden, was heute Nacht hier geschehen war.
Allerdings würde man dann nicht mehr von „allerbestem Trinkwasser“ reden oder gar vom Wasser als „Lebenselixier“.
Im Gegenteil …
Mittwoch, 24. August
„Komm sofort, hier ist die Hölle los!“
Es ist meine Lebensgefährtin.
„Maren, wir haben Redaktionssitzung!“
Sie weiß genau, dass es während der wöchentlichen Teambesprechung ein strenges Handyverbot gibt und wir uns durch so gut wie nichts stören lassen. Ich bin trotzdem rangegangen, die strafenden Blicke unseres Chefs und meiner Kollegen ignorierend. Das mehrfach weggedrückte Vibrieren hat genervt.
„Hier brennt gewissermaßen die Hütte. Der halbe Süsing steht in Flammen.“
Im Hintergrund höre ich Sirenen in diversen Tonlagen.
Florian Heitmann, Chefredakteur des Kreisblatts, trommelt mit seinen wurstigen Fingern auf der Tischplatte. Steini, Sportreporter und Nervensäge, grinst schadenfroh über mein Vergehen. Meine Lieblingskollegin Elske und die beiden jungen Lokalredakteure, beide noch Volontäre, schauen eher interessiert.
„Ich komme!“ Ich lege auf und schaue meine Kollegen an.
„Ich muss weg, sofort. In Himmelstal ist die Hölle los!“
„Sooo wichtig kann es ja wohl nicht sein!“ Steini schaut nicht mich, sondern den Chef an. „Seit wann kann man hier einfach so abhauen?“
Elske wirft ihm einen ihrer tötenden Blicke zu. „Blödmann, wenn die Hölle sogar Himmelstal erreicht, würde ich das sehr, sehr ernst nehmen!“
„Was ist los?“ fragt Florian.
„Der Süsing brennt. Es muss wohl ziemlich schlimm sein.“
Florian nickt. „Wenn es mehr als ein kleiner Waldbrand ist, sollten wir tatsächlich vor Ort sein. Immerhin sind wir die Zeitung! ‚Hölle‘ hört sich nach etwas Größerem an.“
„Danke, Chef.“ Ich schnappe mir meine leichte Jacke und bin schon an der Tür. „Ich halte euch auf dem Laufenden!“
*
Kein Wunder, dass es brennt, denke ich während der Rückfahrt. Dieser Sommer war heiß und trocken, wie ich es selten oder nie erlebt habe. Die Temperaturen lagen fast immer zwischen 30 und 40°C. Erstmals ist unser Rasen völlig verdorrt. Seit Mai hat es in Himmelstal nur zwei- oder dreimal geregnet, viel zu wenig beim Sandboden unserer Region. Niemand traut sich, seine Gärten mit Leitungswasser zu gießen. Wasser ist zu kostbar. Bereits jetzt, im August, verlieren viele Bäume und Büsche ihre Blätter und man hat den Eindruck, es sei bereits Herbst.
Mehrmals muss ich auf der Kreisstraße rechts ranfahren, da Feuerwehr und Polizei mit Blaulicht die gleiche Richtung nehmen. Direkt vor mir verlassen fünf vollbesetzte Kleinbusse der Bundespolizei lautstark ihre Kaserne. Wenn sie den ehemaligen Grenzschutz mobilisieren, muss es schon schlimm sein! Ich hänge mich an die staatliche Bulli-Parade und komme entsprechend gut voran.
Extremsommer – nicht nur mit Blick auf das Klima. Auch politisch ist zurzeit ‚die Hölle los‘. Der Ukrainekrieg eskaliert. Die Preise für Energie und Lebensmittel gehen durch die Decke. Eine weitere Corona-Welle wird erwartet. Die Regierung steht vor nie dagewesenen Herausforderungen.
Ich lenke meinen alten Golf durch den ‚Flecken‘, den Hauptort der Samtgemeinde und für uns Himmelstaler gewissermaßen Versorgungszentrum und Provinz-City.
Kaum habe ich den Ort verlassen und der Blick nach Nordwesten ist wieder frei, wird dort eine dunkle Wolkenfront sichtbar. Nein, es sind keine Wolken, es ist Rauch.
Grau und Schwarz steigt er auf und bildet einen geradezu bedrohlichen Kontrast zum hellen Blau des wolkenlosen Himmels. In Himmelstal passiere ich die alte Wassermühle. Am Abzweig danach biegen die Polizeibusse ab. Ich sehe, dass einer weiter hinten hält und mehrere Uniformierte hinausspringen. Sie sperren die Straße ins nördliche Waldgebiet. Der Brand muss wirklich heftig sein, wenn sie bereits hier im Ort den Verkehr umleiten.
Ich fahre zunächst nach Hause.
Wie schön, wenn man ‚nach Hause‘ sagen kann! Seit einigen Jahren wohne ich mit Maren Bender in ihrem schmucken kleinen Häuschen und fühle mich pudelwohl in Himmelstal.
Einst durch seltsame Umstände um ihren verstorbenen Mann dienstlich in dieses kleine Heidedorf gekommen, haben wir uns später verliebt und dann irgendwann den Schritt gewagt, als Paar zusammenzuziehen. Wir haben es nicht bereut, wenn auch das Leben zu zweit völlig anders ist als jenes Singledasein damals in der Kreisstadt. Ich fühle ich mich inzwischen wirklich heimisch hier. Wir haben zwar wenig gemeinsame Zeit – Maren arbeitet im Lüneburger Klinikum und ich toure durch die Region oder sitze am Schreibtisch – kommen aber weiterhin prima miteinander aus und fühlen uns hier wohl.
Kaum steht mein alter grauer neben ihrem jungen schwarzen Golf, öffnet sie auch schon die Haustür. Sie trägt eine gestreifte Sommerhose, darüber eine helle Bluse. Ihre braunen, gelockten Haare und die feinen Gesichtszüge lassen sie deutlich jünger aussehen, als sie mit Mitte fünfzig eigentlich ist.
„Jens, ich hoffe, du hast keinen Stress mit Heitmann bekommen!“ Maren gibt mir einen flüchtigen Kuss.
Wir gehen ins Haus.
„Nee. Kein Stress. Nur Steini hat rumgemosert, wie immer.“
„Der ist schlicht neidisch.“
Maren hat ein gutes Gespür für Menschen. Sie hat unseren Sportreporter Stein zwar nur zweimal getroffen, ihn jedoch schnell durchschaut.
„Ich dachte, diese Story solltest du dir nicht entgehen lassen. Ich war auf dem Friedhof. Zuerst habe ich mich über den Brandgeruch gewundert. Dann ging es los. Pausenlos Sirenen, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Die Sirene auf dem Tagungshaus hörte nicht auf zu jaulen. Die Blaulichter sind aus allen Richtungen gekommen, an mir vorbeigerauscht und gen Süsing gefahren. Es scheint da draußen wirklich schrecklich zu sein. Der Horizont sieht aus, als ginge die Welt unter.“
„Nun ist sogar die Bundespolizei angerückt. Sie sperren offenbar das gesamte Gebiet ab.“
„Da wirst du mit dem Presseausweis aber doch durchkommen, oder?“
„Ich hoffe. Ich nehme das Fahrrad.“
„Pass auf dich auf und sei nicht leichtsinnig.“
Ich grinse und nehme ihre Floskel auf: „Wer wird schon leichtsinnig sein, wenn die Welt untergeht?!“
*
Ich komme erstaunlicherweise bis zum Forsthaus, das im Süden des großen Waldgebietes liegt. Ich habe eine Abkürzung genutzt und bin oberhalb der Straßensperre herausgekommen. Auf der schmalen Asphaltstraße, im kleinen Nachbardorf und dann auf der Fahrt durch ein erstes Waldgebiet, sind viele Blaulichter an mir vorbeigerauscht. Mehrfach musste ich anhalten, auf den Grasstreifen ausweichen und die breiten Löschfahrzeuge vorbeilassen. Zwei Hubschrauber knattern über mich hinweg Richtung Rauchschwaden. Der Brandgeruch wird stärker, je näher ich dem Waldbrand komme.
Auf dem Kopfsteinpflaster der Straße vor der Försterei und in Wegen, die hier ankommen, parken diverse Fahrzeuge. Die Polizei hat alles abgeriegelt. Ein junger Mann gibt mir zu verstehen, dass hier kein Durchkommen ist.
„Sie dürften eigentlich gar nicht hier sein!“
Ich reiche ihm meinen Presseausweis und zücke meine Canon-Kamera. Er bleibt skeptisch.
„Trotzdem. Wir lassen niemanden durch. Die Löscharbeiten dürfen nicht behindert werden und es ist hier brandgefährlich!“
Gute Wortwahl, denke ich. Was sonst, wenn es brennt.
„Das verstehe und akzeptiere ich. Gibt es denn hier einen Ansprechpartner, den ich befragen kann? Vielleicht Ihren Vorgesetzten?“
Er überlegt, kratzt sich dabei am Dreitagebart.
Dann greift er zum Funkgerät, das er am Gürtel trägt. Ich bin gespannt. Er spricht mit jemanden im Nirgendwo, nickt. Dann zeigt er auf einen der VW-Busse und lässt mich durch.
„Sie können zu dem Fahrzeug dort hinten gehen. Es wird gleich jemand kommen, mit dem Sie sprechen können.“
Ich lehne mein Rad an einen Baum. Auf dem Weg zum Polizeibus schieße ich ein paar Fotos.
Die blauweißen oder roten Einsatzfahrzeuge, aufgeregt umherlaufende Feuerwehrmänner in rot-gelb und teilweise mit Atemschutzausrüstung in Händen, grüner Wald und dicker schwarzer Qualm im Hintergrund unter blauem Himmel – und alles eingehüllt in gleißendes Blaulicht … das macht sich gut. Das unglaubliche Gewusel um mich wirkt chaotisch, ist jedoch vermutlich genauso gewollt. Kommandos, Motoren- und Pumpengeräusche, von Weitem das Knattern der Hubschrauberrotoren und ein Knacken und Knistern wie von einem überdimensionierten Osterfeuer. Flammen oder Funkenflug kann ich von hier aus leider nicht sehen und fotografieren. Was man auch nicht ins Bild kriegt, obwohl für diese Szenerie unsichtbar prägend: Der Geruch nach verbranntem Holz. So ist es oft: Dem Bild fehlt der Ton, der Geruch oder auch das Kribbeln auf der Haut, die Hitze oder Kälte …
Gut, wenn man die Grenzen einer Berichterstattung kennt und akzeptiert, besser, wenn man solch Gefühle dennoch durch ein gelungenes Foto vermitteln kann.
Am VW-Bus mit Lüneburger Kennzeichen warte ich auf meinen Ansprechpartner. Eigentlich bin ich nicht wirklich überrascht. Es kommt ein alter Bekannter, Julius Spiekermann. Der Polizeisprecher aus Lüneburg ist ein Bekannter, ja sogar entfernter Nachbar, wohnt er doch in unserer Straße weiter oben.
„Ach, der Herr Jahnke! Das hätte ich mir ja denken können. Immerhin bin ich diesmal vor Ihnen da.“ Er grinst.
Der Endvierziger, jetzt in Polizeiuniform, ist mir immer schon sympathisch gewesen. Ich schätze ihn als gewissermaßen verbeamteten Kollegen sehr. Allerdings bin ich ihm in der Vergangenheit diverse Male zuvorgekommen.
Er musste dann in der Zeitung lesen, was doch die Polizei zuvor hätte ermitteln sollen. Ich erwidere sein freundliches Grinsen.
„Ich gönne es Ihnen von Herzen, lieber Nachbar! Natürlich hoffe ich, dass Sie mir ein paar Infos geben und ich nicht auf eine offizielle Pressekonferenz warten muss.“
„Kein Problem. Vermutlich gibt es eine solche Konferenz diesmal nicht. Wenn das Feuer weiter tobt wie bisher, werden bald die Ü-Wagen der Nachrichtendienste die Einsatzkräfte behindern. Dann bedarf es keiner Konferenz mehr.“
„So schlimm ist es?“
Er nickt, öffnet die Schiebetür des Kleinbusses und wir setzen uns gegenüber in das wie ein Multivan ausgestattete Polizeifahrzeug. Auf dem schmalen Tisch stehen einige kleine Flaschen Mineralwasser. Spiekermann nimmt sich eine und schiebt auch mir eine zu.
„Es ist schlimm, kann aber deutlich schlimmer werden. Der Wind hat aufgefrischt und von dort hinten“, er weist in Richtung Ende der befestigten Straße.
„Bis jenseits der nächsten Weggabelung brennt es. Ich schätze, das Feuer wird mindestens zwanzig, wenn nicht gar sechzig Quadratkilometer Wald vernichten.“
Ich bin geschockt, kenne ich doch von diversen Fahrradtouren die Gegend gut. Die angesprochene Weggabelung liegt etwa zwei Kilometer von hier.
„Wow. Sind auch Gebäude oder gar Menschen betroffen?“
„Ja, wenn es hier auch zum Glück nur wenige gibt. Im Moment versuchen die Einsatzkräfte aus allen umliegenden Orten das kleine Sägewerk mit dem Arbeiter-Haus zu retten. Der Schaden geht schon jetzt in die Millionen.“
Ich nicke und mache mir eine Notiz.
„Sie meinen, wegen des Waldes.“
„Genau. Kostbarer Hochwald steht in Flammen. Tannen, Kiefern, Buchen, Lärchen und Douglasien sind betroffen. Am Weg lagern noch diverse Stämme Nutzholz vom letzten Jahr. Na ja, und vom ökologischen Schaden mal abgesehen. Auch wenn keine Menschen zu Schaden kommen, ist dieses Feuer eine echte Katastrophe.“
„Katastrophe? Also hat es sich selbst entzündet? Blitz und Donner gab es ja seit Monaten nicht mehr.“
Spiekermann schüttelt mit dem Kopf und mir fällt auf, dass seine Schläfen grau sind. Vielleicht stresst sein sicherer Beamten-Job mehr als ich es mir als relativ freier Journalist vorstelle.
„Wir sind noch am Anfang. Natürlich kann eine Glasscheibe oder sowas das trockene Gras oder Laub entzündet haben. Allerdings ist es doch recht unwahrscheinlich, dass dies an mindestens fünf Orten gleichzeitig passiert.“
„Also Brandstiftung.“
„Das jedenfalls vermutet die Feuerwehr. Entlang des Hauptweges gibt es mindestens fünf Brandherde, vielleicht mehr.“
„Dann könnte jemand den Weg mit einer Fackel abgefahren haben und hat diese immer wieder ins Gras gehalten?“
„Oder es waren mehrere Brandstifter. Ob Fackel, Brandbeschleuniger oder etwas anderes, wird erst die Untersuchung der Brandermittler ergeben. Wir wissen es also erst, nachdem das Feuer gelöscht ist.“ Er seufzt. „Und das wird noch dauern!“
Ein Feuerwehrmann klopft an die Tür.
Es ist Enno Dieckmann, Ortsbrandmeister aus Himmelstal.
„Jens! Dass du hier bist, wundert mich irgendwie nicht. Du riechst schließlich immer, wenn es brennt.“ Er lacht mich an, wendet sich dann jedoch an Spiekermann. „Eine Frau von der Kripo fragt nach dir. Sie sind gerade angekommen.“
Etwa wo mein Fahrrad steht, hält ein dunkler Passat. Eine Frau und ein Mann kommen in unsere Richtung. Spiekermann verlässt den Bulli und geht ihnen entgegen.
Enno nimmt seinen Schutzhelm ab, wischt sich die Stirn, steigt ein, setzt sich zu mir und nimmt einen langen Zug aus der Wasserflasche des Polizisten.
„Puh, die Hitze draußen ist schon groß genug. Nun auch noch das Feuer!“
„Ihr seid schon lange hier?“
Er nickt. „Wir waren die ersten. Die Leitstelle in Lüneburg hat um 9.15 Uhr das Feuer gemeldet. Eines der Kontrollflugzeuge hat es entdeckt. Als wir fünfzehn Minuten später hier waren, brannte es bereits lichterloh. Wir sind bis zum Sägewerk gekommen. Inzwischen fürchten wir, dass auch das nicht mehr zu retten ist.“
„Spiekermann meinte, vermutlich ist das Feuer absichtlich gelegt worden. Wie kommt er darauf?“
„Die Flieger haben mehrere unabhängige Brandnester gemeldet, alle entlang des Hauptweges. Zwei davon haben wir selbst erreicht und bekämpft.“
„Woher kriegt ihr das Wasser?“
„Aus unseren Tanks und einem kleinen Bach. Aber es ist knapp. Wir haben in Celle Löschflugzeuge angefordert. Sie wollen Polizei-Hubschrauber schicken, mit 2.000 bzw. 5.000 Liter Wasser je Einsatz beim dem dicken Sikorsky CH-53. Leider gibt es bei uns keine Lösch-Jumbos wie etwa in Kanada.“
Ich notiere mir die Informationen und erfahre noch, dass die freiwilligen Feuerwehren aller umliegenden Dörfer hier sind. Viele Kameraden mit Atemschutz sind im Einsatz. Sie alle leisten ihr Bestes, fürchten jedoch, dass sie den Brand wegen des Windes nicht unter Kontrolle kriegen. Es werden bereits strategische Überlegungen für Brandschneisen angestellt. Sie haben entsprechendes Gerät bei den Forstbehörden und bei der Bundeswehr angefordert.
„Wir fürchten das Schlimmste“, schließt Enno seine Schilderung. „So etwas habe ich nur als junger Mann 1975 miterlebt.
Damals sind 13.000 Hektar Fläche in der Südheide und dem Wendland, meist Wald und Heide durch etwa 300 Feuer vernichtet worden. Es war wie der Weltuntergang … und heiß wie die Hölle.“
Auch ich erinnere mich an jene Katastrophe. Damals gab es eine ähnliche Trockenperiode wie in diesem Jahr. Die Ursachen der Brände hat man nur teilweise klären können: Heißgelaufene Bremsen eines Schienenfahrzeuges, fahrlässig weggeworfene Zigaretten und vorsätzliche Brandstiftung.
*
Während ich gegen Mittag, mit der Wand aus Rauch und Feuer im Rücken, zurück nach Himmelstal radle und überlege, wie ich meinen Bericht schreibe, gehen mir vor allem zwei Begriffe durch den Kopf: Hölle und Weltuntergang.
Samstag, 27. August
Es brennt immer noch. Der gesamte Süsing ist Katastrophengebiet. Auch die Presse lassen sie nicht mehr hinein. Hubschrauber kreisen. Einer von ihnen nimmt sein Wasser bei der Mühle in Himmelstal auf, die anderen im entfernteren Lopausee. Die meisten Feuerwehrteiche in umliegenden Dörfern sind längst trocken. Es wimmelt von Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Sie behaupten, dass sie das Feuer eingedämmt haben. Das Sägewerk samt Wohnhaus und Nebengebäuden liegen in Schutt und Asche. Die Schäden auf mindestens fünfunddreißig Quadratkilometern sind immens. Wertvoller Wald wurde vernichtet. Wie Zunder haben vor allem Kiefernwälder und die vom Borkenkäfer befallenen Bäume gebrannt. Das viele Totholz der letzten Windbrüche hat alles beschleunigt.
Die Experten von Feuerwehr und Kripo ermitteln jetzt. Sie haben die ersten vier Brandnester untersucht und beunruhigende Entdeckungen gemacht. Julius Spiekermann und Enno Diekmann haben mich auf dem Laufenden gehalten, so dass ich auch gestern und heute brandaktuell (!) berichten konnte.
Rückstände von Behältern wurden gefunden und Brandbeschleuniger vermutet. Daneben lagen verkohlte Kabel und Elektroteile. Die Spezialisten gehen davon aus, dass Benzinkanister mit Zeitzündern abgelegt und zeitgleich gezündet wurden. Es war folglich ein vorbereiteter und strategisch durchorganisierter Anschlag – kein Versehen oder fahrlässig herbeigeführtes Unglück.
„Wir leben in unruhigen Zeiten!“ meint Maren, als wir am Samstag gemeinsam zu Mittag essen. Wir haben uns beim Chinesen im Flecken zwei Portionen Ente mit Reis geholt, unseren Tisch nett gedeckt und eine Flasche weißen Burgunder aufgemacht.
Ich kann ihr nur zustimmen. „Ähnlich haben es diverse Leute in den letzten Tagen ja auch schon gesagt. Da war sogar von Hölle und Weltuntergang die Rede.“
„Kann ich nachvollziehen. Corona, Putins Krieg, die Energieängste, Rezession und Preiserhöhungen … wir haben wirklich unruhige und schwierige Zeiten. Aber von ‚Weltuntergang‘ zu sprechen, halte ich doch für sehr weit hergeholt.“ Maren schüttelt ihren schönen Kopf und nimmt einen Schluck aus dem Weinglas. „Auch wenn manches ziemlich verwirrend und schwer ist, leben wir in Deutschland doch noch ziemlich gut.“
„Noch. Aber es kriselt.“ Ich proste ihr zu. „Hat nicht Luther das mit dem Apfelbaum gesagt? ‚Wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen!‘ Finde ich gut!“
Maren lacht. „Jens, ich staune. Du alter Heide und doch Luthers Gottvertrauen. Das spricht nun allerdings gegen die Untergangsstimmung im Lande.“
„Vielleicht müsste auch ich mal einen Leserbrief in unsere Zeitung setzen!“
Gerade haben wir die Leserbriefe gelesen. Vier davon nehmen meine Berichte über den Waldbrand auf, der überall in der Region Tagesgespräch ist und selbst im Fernsehen gezeigt wurde. Drei schreiben von Klimakrise und Versagen der Regierung. Einer der Beiträge fällt definitiv aus der Reihe. Er versucht gewissermaßen eine biblische Deutung.
Maren liest ihn mir laut vor:
„Weder von Klimakrise noch von Versagen der Forstbehörden oder von Politikern sollte man jetzt angesichts der Waldbrände reden. Die sogenannten Katastrophen unserer Tage sind vielmehr ‚Zeichen‘. Wofür? Für das Ende unserer Hybris, Raum und Zeit zu beherrschen, für eine wirkliche Zeitenwende – die allerdings völlig anders ausfällt als die unseres kurzsichtigen Kanzlers. Wir leben im Umbruch. Wie eine Schwangere ertragen wir Schmerzen und Leid, damit etwas Neues entsteht. Wer meint, diese neue Geburt noch aufzuhalten, wird die Wehen nicht überstehen. Wer das Kommen der neuen Zeit verzögert, leugnet oder gar bekämpft, wird mit der alten Zeit vergehen.“ A. Greifenstein
„Ziemlich abgedreht.“
Ich ahne bereits, wie unser Chef diesen Leserbrief einordnet. Er wird ihn als ‚religiöses Geschwafel‘ abtun.
Allerdings wird der Brief von ihm letztendlich trotzdem als positiv verbucht, da bin ich sicher.
Für Florian Heitmann sind weder Online-Kommentare noch irgendetwas anderes die Gradmesser für guten Journalismus, nur und einzig Leserbriefe. Sie allein zählen, wenn er an uns Reporter sein sparsames Lob verteilt. Ich bin insgeheim froh, dass auf meine Berichte von den Waldbränden nur diese vier Leser mit Briefen reagiert haben. Bei einer Flut solcher Reaktionen liefe ich Gefahr, von Florian allzu sehr gefeiert zu werden – was die kaum vermeidbare Einladung zum Genuss einer Flasche Dimple-Whisky aus seinem Versteck im Büro zur Folge hätte. Absturz garantiert.
Maren nickt. „Finde ich auch. Ohne dass dieser, oder diese Greifenstein es mit Namen nennt: Er oder sie scheint auf die biblische Botschaft vom Ende der Zeit anzuspielen.“
„Du meinst vermutlich die Endzeitreden Jesu oder die Texte aus der Offenbarung des Johannes.“
„Genau. Die biblischen Autoren sprechen auch von ‚Zeichen‘ und nehmen ebenfalls das Bild von der schmerzhaften Schwangerschaft auf, ohne die nichts Neues entsteht.“
„Du vermutest, der Leser sieht die Brände und alle anderen Katastrophen unserer Zeit als ‚Zeichen der Endzeit‘? Und er will sie nicht nur erklären, sondern sehnt sie sogar herbei?“
„So klingt es jedenfalls für mich. Er oder sie fordert ja gewissermaßen auf, solche Dinge einfach geschehen zu lassen. Sollten sie nicht geschehen, würde das Kommen des Neuen verhindert.“
„Steile Gedankenakrobatik, finde ich.“
Maren widerspricht. „Oder nur konsequent. Wenn Katastrophen notwendige Zeichen eines heilsamen Umbruchs sind, sind sie letztlich keine Katastrophen mehr. Sie sind dann zwingend erforderlich für das Kommen der neuen Zeit.“
„… und wer sich ihnen entgegenstellt, will die neue Zeit verhindern, blockiert gewissermaßen die Zukunft? Die Feuerwehr wird dann also zur Zukunfts-Blockade, weil sie es nicht einfach brennen lässt …?“
„Genau. Biblisch gesehen kommt Jesus Christus irgendwann wieder. Er wird dann seine neue Welt sichtbar aufrichten, sein Friedensreich, einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo alles wieder gut wird. Bevor dies geschieht, muss die alte Welt vergehen – und die ‚Zeichen der Endzeit‘ deuten darauf hin, dass diese Zeitenwende kurz bevorsteht.“
Maren prostet mir zu.
„Willkommen also in der Endzeit, mein lieber Jens!“
Ich muss ziemlich blöd und überrumpelt aussehen, als ich zögernd mein Glas hebe und sie anstößt.
„Aber ich kann dich beruhigen. Solche Endzeit-Spekulationen begleiten die Christenheit, seit es sie gibt. Zuerst dachten die Christen, Jesus kommt noch zu ihren Lebzeiten wieder. Als Zeichen der Endzeit wurde dann der Brand Roms und die Verfolgung der Christen durch die römischen Kaiser gedeutet.“
„Aber dann ging es eben doch weiter und Jesus kam nicht.“
„Richtig. Immer wieder wurden Katastrophen, Kriege, Hungersnöte, Seuchen und alles Schlimme als ‚Zeichen der Endzeit‘ interpretiert. Aber jedes Mal wurde die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft enttäuscht.“
Da wird auch dieser oder diese A. Greifenstein einst eines Besseren belehrt werden, denke ich.
Maren nickt. „Da bin ich mir sicher. Ob das Kürzel A. nun Anton heißt oder Antonia – er oder sie wird eines Tages erkennen, dass es trotz der Katastrophen immer weitergeht.“
„Dann glaubst du also nicht an die Wiederkunft Jesu?“
Maren lacht, trinkt ihr Glas mit einem großen Schluck leer, schaut mich mit ihren treubraunen Augen an und meint zärtlich:
„Doch. Aber wenn es soweit ist, gebe ich dir Bescheid!“
Soll einer die Frauen verstehen.
Jetzt steht sie auf und beendet damit abrupt unser Gespräch. Manchmal geschieht dies für mich völlig unerwartet. Maren hat einfach keine Lust mehr, oder sie hält das Thema für erschöpft, oder sie findet ein Telefonat, Bügeln oder Staubsaugen wichtiger, oder …
Dass ich mich je daran gewöhne, bezweifle ich.
Mittwoch, 21.09.
„Eberhard Steiner hat gesagt, in diesem Winter wird es sich entscheiden!“
Ich kann es nicht fassen. Ob mein Kollege Steini diesen Rechtsaußen von der DZP wegen der Namensverwandtschaft verehrt? Oder etwa aufgrund seiner Positionen im Wahlkampf zum Landtag? Steiner ist nach der Verhaftung seines Vorgängers Konstantin von Bering von der Deutschen Zentrums Partei, einer nationalistisch-rechtsradikalen Gruppierung, die in unserem schönen Niedersachsen mitreden möchte, spontan und kurzfristig als Spitzenkandidat aufgestellt worden.
Von Bering wurde des Mordes überführt, auch mit meiner bescheidenen Hilfe.
Nun frage ich mich, ob der junge Nachfolger wirklich eine so weiße Weste hat, wie er selbst und seine Partei ihn vermarktet. Auf Plakaten, im Regionalfernsehen und nun täglich bei Wahlveranstaltungen glänzt der Newcomer jedenfalls in seiner Rolle als Traum aller Schwiegermütter, Traumprinz jeder Singlefrau und Saubermann mit großer politischer Zukunft.
Elske schüttelt ihre blonden Locken und schaut Steini, der ihr gegenüber am Redaktionstisch sitzt, fast mitleidig an.
„Dein tolles Vorbild kandidiert für eine extrem rechte Partei. Die wollen ‚Deutschland first‘ und sich in Europa quer stellen. Die wollen der Ukraine nicht mehr beistehen. Die wollen in der Energiekrise so gut wie nichts tun, außer Atomkraftwerke wieder ans Netz bringen … aber das weißt du ja wohl alles selbst, lieber Steini, oder?“
Steini zuckt desinteressiert mit den Achseln. „Aber die wollen auch für Recht und Ordnung eintreten. Die setzen sich für uns Einheimische ein und die arbeitende Bevölkerung. Die stellen sich gegen den Filz von Politik, Industrie und Elite in diesem Land … Und außerdem ist Steiner doch ein wirklich netter, verbindlicher und engagierter Typ! Der kommt bei allen gut an.“
Elske verzieht ihr hübsches Gesicht.
Unser Chef räuspert sich hörbar.
Er sitzt an der Stirnseite des Tisches und füllt mit seinem stämmigen Körper, den komfortablen Stuhl in voller Breite aus.
„Steini, Elske. Schluss jetzt. Privat könnt ihr euch ja gerne über eure politische Meinung streiten, als Journalisten habt ihr neutral und unparteiisch zu agieren. Wir sitzen hier jetzt als Redaktionsteam einer unabhängigen Zeitung, nicht am Stammtisch! Also, reißt euch zusammen.“
Seine fleischige Hand wischt jeden Widerspruch weg. Er schaut mich an und seine Stimme duldet keinen Widerspruch.
„Besser, du machst das mit dem Auftritt der Kandidaten am Rathaus. Ich weiß, dass du alles andere als neutral bist, Jens – aber du bist der erfahrenste Profi unter uns und kannst deine privaten Gedanken zu Gunsten der journalistischen Neutralität kontrollieren.“
Oh je. Wenn sich Florian da man nicht irrt … Ich soll also die Berichterstattung der zentralen Wahlkundgebung übernehmen. Okay. Auch wenn mir diese DZP und erst recht der smarte Steiner extrem suspekt sind, werde ich versuchen, fair zu bleiben. Ich nicke also und Florian schiebt mir den Ausdruck mit vorliegenden Infos der Veranstalter zu.
Elske lächelt zufrieden, Steini schmollt. Florian geht zur Tagesordnung über.
Nach der Sitzung kommt Elske an meinen Schreibtisch.
„Ich finde es gut, dass du über den Wahlkampf berichtest und nicht der Chef oder gar Steini.“
„Und du hättest es nicht auch gerne gemacht?“
Ich weiß, dass Elske politisch sehr engagiert ist. Sie hält es vor allem mit den Grünen und unterstützt ‚Fridays for Future‘.
„Nicht unter diesen Umständen. Der Chef schätzt es schon richtig ein: Ich könnte mich nicht zurückhalten, was diesen Eberhard Steiner betrifft.“
„Verstehe. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, was sich nach Steiners Ansicht in diesem Winter entscheiden wird. Meint er die Gas- und Energieversorgung oder den Ukraine-Krieg?“
„Keine Ahnung. Vielleicht weiß Steini es ja. Er liest ja offenbar die Programme der DZP und saugt dem Steiner jedes Wort von den Lippen.“
„Na, ich werde am Donnerstag dann auch mal ein bisschen braune Sauce aufsaugen. Aussagen von Politikern, die eine genaue Vorgabe machen, bis wann sich was ‚entscheidet‘, sind der Stoff, aus dem meine journalistischen Träume sind.“
Elske lacht – und ich liebe ihre Grübchen, die funkelnden Augen und wie sie gluckst und klingt, wenn sie lacht.
„Ich verstehe! Man kann dann hinterher jemanden deftig in die Pfanne hauen, wenn es nicht passiert ist!“
Wir sind uns einig.
„Genau. Ich werde dir dann erzählen, wie’s so war.“
*
Den Tag verbringe ich in der Redaktion. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist eigentlich nur der Mittwoch mein Präsenztag geworden. Der Rest sind Außendienst und Homeoffice. Gegen drei treffe ich mich mit einem Informanten aus dem Kreishaus im Stadtgarten. Das Café dort hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Es gibt dort sogar Lifemusik und sie locken mit der zentralen Lage, einem tollen Innenhof und lecker Kuchen, Eis und Leckereien.
Unsere Region lechzt weiterhin nach Regen. Seit gestern ziehen Wolken auf. Gelegentlich gibt es sogar ein paar Tropfen. Es ist kälter geworden. Morgen oder übermorgen soll der lang ersehnte Regen dann endlich kommen. Heute jedoch ist es noch trocken und man kann draußen sitzen. Der Stadtgarten hat große Sonnenschirme aufgespannt. Die Tische sind allerdings nur zur Hälfte besetzt.
Das Kreishaus ist inzwischen in ein neues Gebäude, gleich hinter der Bahn, umgezogen. Es wurden viele Millionen investiert. Die Opposition wirft der Verwaltung vor, Geld zu verschwenden. Es gab Streit wegen der Beteiligung von Firmen ohne faire Ausschreibung. Wie alle Journalisten erhoffe auch ich mir Informationen über Hintergründe und möchte gerne investigativ recherchieren und einen Knüller landen … aber auch dieser Informant hat nichts dergleichen zu bieten. Alles scheint mit rechten Dingen zugegangen zu sein.
Folglich zahle ich, wir verabschieden uns und gegen vier Uhr fahre ich zurück nach Himmelstal.
Dass sie im Stadtwald ein Tempolimit von achtzig eingeführt haben, war damals umstritten. Heute genieße ich es. Vielleicht soll man nicht so schnell fahren, um den wunderschönen Buchenwald bewundern zu können. Im Frühling die zartgrünen ersten Spitzen, dann der dunkle Märchenwald im sattgrünen Sommer und bald wieder ein buntes Indian-Summer-Feeling, das selbst im geschlossenen PKW aufkommt.
Dass die Deutsche Bahn ausgerechnet hier eine neue Trasse bauen will, erscheint nicht nur mir völlig absurd!
*
Ich passiere gerade die immer noch einzige Ampelkreuzung im Flecken, da kommt ein Anruf.
„Jens? Wo steckst du gerade?“
Es ist Lennart.
„Ich bin auf dem Heimweg. Ist etwas passiert?“
„Wollte dich nur als Reporter beglücken.“
„Du hast einen besonderen Einsatz?“
Lennart arbeitet als Sanitäter beim Roten Kreuz. Er liebt Action und findet sie offenbar im Notdienst.
„Allerdings! Ich bin ganz in der Nähe von Himmelstal. Bei den Windrädern, dort wo sie die neuen bauen.“
„Mit dem Notarztwagen?“
„Richtig. Die Zentrale hat uns geschickt.“
„Also ist etwas passiert. Ein Unfall?“
„Ein Selbstmord, dachten wir zuerst. Oder sogar ein Mord, denke ich jetzt. Eine junge Frau hängt am Kran. Gerade kam die Feuerwehr, die sie runterholen soll.“
„Ich komme.“
Nur wenige Minuten später fahre ich die schmale Zubringerstraße zu den Windrädern. Sechs neue Anlagen haben sie gebaut, mit einer Leistung von je 3,5 Megawatt – genug um den Strombedarf von 25.000 Haushalten zu decken.
Um die langen Bauteile von der Straße auf die Wirtschaftswege zu bringen, musste ein Teil des höher gelegenen Ackers weichen und sie haben die Kurve abgeflacht. Es sind mächtige Windräder, mit einer Nabenhöhe von 121 Metern. Eine der Anlagen ist noch im Bau. Die Rotorblätter sind noch nicht montiert. Heute wird und wurde offenbar nicht gearbeitet, jedenfalls sind keine Betriebsfahrzeuge des Betreibers hier.
Ich parke hinter einem Polizei- und zwei Krankenwagen, schnappe meine Kameratasche und nähere mich dem Ort des Geschehens. Weiter vorn fährt eine Feuerwehr gerade ihre Leiter aus. Seitlich liegen die drei langen Flügel des Windrades. Was von Weitem und montiert zart und schmal wirkt, ist aus der Nähe betrachtet, wuchtig, stabil und extrem lang.
Aber mein Blick wird von etwas anderem gefesselt. Neben dem im Bau befindlichen Windrad steht ein Kran. Er wirkt geradezu filigran im Vergleich zu der mächtigen Säule daneben. Er ist sicher extrem lang, aber nicht richtig ausgefahren, nur etwa fünfzehn bis zwanzig Meter.
Auf halber Höhe hängt eine Person.
„Das ging ja schnell!“
Neben mir taucht wie aus dem Nichts mein Ziehsohn Lennart Pohlmann auf. ‚Ziehsohn‘ deshalb, weil er mir vor zwei Jahren geholfen hat, Miriams Baby zu retten.
Er hat sich damals als mein Sohn ausgegeben und mich als angeblichen Alt-Nazi in die braune Szene eingeschleust. So haben wir uns kennen- und lieben gelernt. Auch wenn er jetzt statt seiner zerrissen Jeans und dem Totenkopf-T-Shirt die seriöse Uniform eines Sanitäters trägt, sieht man ihm seine verwegene und teilweise verkorkste Vergangenheit noch an. Der Irokesenschnitt, diesmal mit hellblauem statt sonst orangem Hahnenkamp, der sonst extrem kurze Haarschnitt, das Totenkopf-Tattoo am Hals und der silberne Ohrring offenbaren sofort, dass Lennart, sagen wir, etwas sehr Besonderes ist.
„So sind eben die ‚rasenden‘ Reporter!“
Wir umarmen uns kurz aber herzlich.
„Sie ist tot.“ Er sagt es mit großer Anteilnahme.
Dann reicht mir ein Fernglas. „Auch wenn ich wegen der Vorschriften nicht raufgeklettert bin, um ihren Puls zu checken, sie muss dort bereits einige Stunden hängen. An einer Kette. Mit Hämatomen am Hals, die vermutlich nicht durch Hängen entstanden sind.“
Ich bin baff. Ja, das passt zu Lennart. Wäre er nicht mit einer Kollegin und unter diversen Sicherheitsbestimmungen hier, wäre er wohl hinaufgeklettert. Er sucht immer noch den Nervenkitzel. Nun nicht mehr für vermeintlich ‚Volk und Vaterland‘ im braunen Milieu, sondern als Sani für das Allgemeinwohl und den Einsatz für die Schwachen.
„Wow. Gut, dass du es nicht gemacht und dir somit nicht auch noch den Hals gebrochen hast! Du vermutest also, es war nicht Suizid sondern Mord?“
„Da bin ich ziemlich sicher. Die Kleine hätte es nicht geschafft, dort hinaufzuklettern. Sie ist eine zarte junge Frau. Ich schätze so um die fünfundzwanzig. Sie trägt Laufklamotten, ist vermutlich also Joggen gewesen. Irgendwie kommt sie mir sogar bekannt vor, aber es fällt mir einfach nicht ein, wo ich sie gesehen habe.“
„Ihr Sanis wart zuerst hier?“
„Ja. Die Notrufzentrale bekam den Anruf einer Frau, die mit ihrem Fifi Gassi ging und die Tote hat hängen sehen. Die Frau sitzt noch bei uns im RTW und meine Kollegin kümmert sich um sie. Die arme Frau hat einen Schock.“
Neben einem der Krankenwagen sitzt ein kleiner grauer Hund. Er sieht traurig und einsam aus.
„Die Polizei kam erst nach euch?“
„Ja. Wir haben sie angerufen, aber auch die Zentrale hatte sie bereits informiert. Hier angekommen, hat meine Kollegin dann noch die Feuerwehr informiert.“
Ich danke ihm nochmal, dass er angerufen hat und mache Fotos. Einer der Polizisten, bisher verborgen hinter dem Feuerwehrfahrzeug, schaut in meine Richtung. Aufgeregt winkt er und brüllt etwas Unverständliches. ‚Keine Fotos!‘ deute ich die Bewegung, mache allerdings weiter. Er kommt auf mich zu und jetzt erkenne ich ihn – und er mich.
„Jahnke! Sie schon wieder. Sie widersetzen sich polizeilichen Anordnungen. Das gibt eine Anzeige. Und nun machen Sie die Fliege und verschwinden Sie!“
Der Ordnungshüter vor mir ist mein ‚spezieller Freund‘ Hauptkommissar Westermann aus der Kreisstadt. Der stämmige Polizist regt sich schnell auf, hält sich für einen grandiosen Ermittler und mich für eine lästige und nervige private Konkurrenz, die das staatliche Gewaltmonopol bedroht.
Gern präsentiert sich Westermann, samt Abzeichen, als Ober-Sheriff der Heide.
„Oh, Herr Hauptkommissar!“ Ich setze ein bewusst freundliches Lächeln auf, weiß ich doch, dass ihn dies am meisten provoziert. „Wie soll ich wissen, dass ich hier nicht erwünscht bin? Es gab keine Absperrung. Haben Sie ja wohl vergessen.“
Die breite Stirn unter der Mütze samt der bärtigen Wangen Westermanns röten sich. Wütend schnauzt er mich an.
„Ob und wann wir absperren, entscheide immer noch ich! Aber ich habe Ihnen deutlich zu erkennen gegeben, dass Sie nicht fotografieren, sondern verschwinden sollen.“
„Sie meinen das Winken eben? Ich dachte, Sie begrüßen mich freundlich. Da hatte ich Sie ja noch nicht erkannt.“
Ich vermute, wenn ich so weitermache, platzt mein Gegenüber bald vor Wut. Oder er erschießt mich. Also lenke ich besser ein. „Aber ist ja gut! Ich gehe ja schon.“
Er greift mit einer Hand an den Gürtel. Neben seiner Dienstwaffe hängen dort Handschellen. Ein richtiger Sheriff eben. „Ich warte. Verschwinden Sie, bevor ich Ihnen Handschellen anlege und Sie einsperre.“
Ich habe, was ich brauche, also gehe ich. Lennart hat was bei mir gut. Wir vereinbaren, miteinander zu telefonieren. Vielleicht erfährt mein junger Freund noch mehr, wenn die Frau geborgen ist – und außerdem wollten wir uns schon lange mal wieder zum Klönen treffen.
Mein Golf rumpelt über den Wirtschaftsweg. Kurz vor der Einmündung in die Hauptstraße kommt mir ein schwarzer Audi entgegen.
Er trägt ein Lüneburger Polizei-Kennzeichen und ich weiß sofort, wer drinsitzt. Ich bleibe mitten auf dem Weg stehen, sogar ein bisschen quer. Der A4 hält und der uniformierte Fahrer springt heraus. Wütend bedeutet er mir, Platz zu machen. Gleich darauf öffnet sich die Beifahrertür. Auch ich steige aus. Der Fahrer schimpft. Der andere Mann kommt grinsend auf mich zu. Er trägt ein kariertes Hemd, eine abgegriffene braune Lederjacke und Jeans. Wir umarmen uns. Der Fahrer staunt.
„Mensch, Jens! Lange nicht gesehen. Aber logo, hier ist dein Revier, hier bist du zu Haus!“
„Und du der Eindringling. Wie schön, Schorse, dich zu sehen. Leider, wie oft, unter schlimmen Umständen.“
Mein Freund Schorse, mit richtigem Namen Georg Martens, ist Leiter der Mordkommission Lüneburg. In Jugendzeiten waren wir zusammen bei den Pfadfindern, danach hatten wir uns lange aus den Augen verloren und erst über kriminelle Vorfälle hier im Landkreis wiedergetroffen. Ich berichte ihm von der Toten am Kran.
Er stöhnt. „Als ob ich mit dem Professor nicht schon genug um die Ohren hätte!“
Er muss nicht erklären, was er meint. Vor etwa zwei Wochen wurde ein prominenter Professor der Leuphana-Uni tot aufgefunden. Er hatte irgendeine tödliche Substanz intus. Noch ist nicht geklärt, ob er sie selbst geschluckt hat oder sie ihm verabreicht wurde. Die Lüneburger Kollegen haben mehrfach darüber berichtet, hat doch der Mann die Bundesregierung in Zukunftsfragen beraten. Er war eine Koryphäe auf dem Gebiet der alternativen Energien und hat sich auch als Klimaforscher hervorgetan. Mein Freund Schorse muss mit einem weiteren Mord ‚am Hacken‘ mächtig unter Druck stehen.
„Willst du miterleben, wenn wir sie bergen?“
Dass er mich trotz aller Arbeitsbelastung einbezieht, ehrt mich. Es wäre eine gute Gelegenheit, dem Sheriff eins auszuwischen. Trotzdem entscheide ich mich dagegen. Es wird oben am Fundort sehr lange dauern – dabei habe ich die meisten Infos samt Fotos bereits.
Die Tote nicht aus der Nähe abzubilden, versteht sich ohnehin von selbst.
„Lass mal lieber“, antworte ich deshalb. „Ich will Westermann nicht weiter provozieren. Wenn du mir helfen willst, kommst du auf dem Rückweg bei mir vorbei oder rufst an, wenn du neue Infos hast.“
„Okay, Jens. Ich lass dir die Ergebnisse der ersten Untersuchung durch Frau Dr. Fuhrmann zukommen. Sie ist bereits unterwegs.“