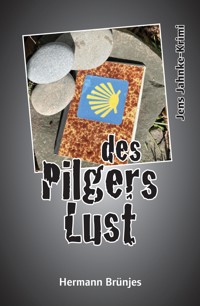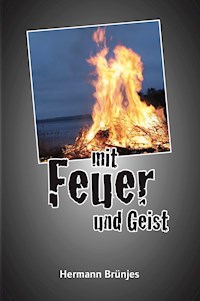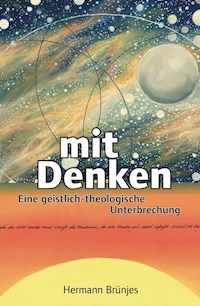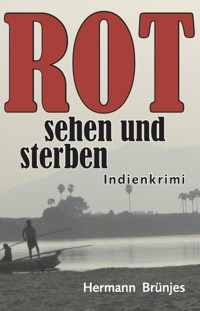0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Reisebeschreibung der besonderen Art:
Indien ohne Tempeltourismus, Ajuveda und Yogakurse. Indien auch ohne Strandidylle unter Kokospalmen, ohne Paläste aus Tausendundeiner Nacht, Elefanten und Tigern in Nationalparks, Bollywood und einer boomenden Wirtschaft mit Wachstumsraten von acht Prozent.
Indien eben anders.
Seit über 30 Jahren begleitet der Autor zusammen mit anderen eine christliche Kirche im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Die Eindrücke erzählen meist vom Leben im dörflichen Stammesgebiet entlang des Flusses Godavari. Eine Fülle kurzer Sequenzen, die nicht direkt zusammenhängen, hat der Autor meist direkt vor Ort aufgeschrieben. Zusammen ergeben sie ein Bild von einem Indien, an das sich Reisende gut erinnern - aber auch an ein Land, wie nur wenig Reisende es kennen. Indien hautnah, könnte man sagen. Indien zum Anfassen.
Für wen das Buch gedacht ist?
Für Liebhaber Indiens. Für Leute, die dieses aufregende Land erstmals oder besser kennenlernen möchten. Für Reisende und Neugierige. Für jene, die einmal die gewohnten Reisewege und Touristenrouten verlassen möchten und Indien wirklich "hautnah" begegnen wollen.
Am Ende der Sammlung gibt der Autor diverse Tipps für Indien-Reisende. Wenn einige davon helfen, eine Indien-Reise vorzubereiten und sich sicher im Land zu bewegen, hat es sich gelohnt! Ein Reiseführer im engeren Sinn ist dieses Buch allerdings nicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INDIEN hautnah
Impressionen im indischen Stammesgebiet
Danke allen, denen ich in Indien begegnet bin und jenen, mit denen ich unterwegs war. Die Fotos sind wie die Erinnerungen nur eine kleine Auswahl von Tausenden. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Indien ohne Tempeltourismus, Ajuveda und Yogakurse. Indien ohne Strandidylle unter Kokospalmen, kolonial geprägte Hotels mit Pool und Schlemmerbüffets. Indien ohne Entsetzen über verstümmelte Bettler, heimatlos umher streundende Kinder, Schmutz und Elend. Indien ohne die Paläste aus tausend und einer Nacht, Elefanten und Tiger in Nationalparks. Indien auch ohne Bollywood, ohne wirtschaftliche Erfolgsstories, ohne Computerspezialisten.
Indien, oder besser Indien-Beschreibungen ohne all dies - geht das überhaupt?
Ja, es geht.
Über dreißig mal war ich nun in Indien, meist in den südlichen Bundesstaaten. Die Entwicklung einiger Regionen konnte ich seit Beginn der Achtziger miterleben. Ja, ich kenne auch jenes Indien, wie Touristen und punktuelle Besucher es erleben. Die Faszination, die dieses Land auf seine Besucher ausübt, kann ich gut nachvollziehen. Außerdem habe ich manches gelesen, mit unzähligen Menschen in und über Indien gesprochen und mir selbst ein Bild von Vielem gemacht. Ich weiß, dass es "das Indien" eigentlich gar nicht gibt und man immer nur Bruchstücke wahrnimmt.
Ja, ich kann wohl sagen: Ich weiß immer mehr über Indien.
Allerdings: Mir scheint, ich verstehe immer weniger.
Indien bleibt für mich ein geliebtes, aber auch fremdes Land. Je intensiver ich ihm begegne, je mehr ich es "hautnah" an mich heran lasse, desto intensiver werden auch die Unterschiede spürbar. Dieses Land "tickt" anders - allemal, wenn man die Hauptrouten und -städte verlässt und in abgeschiedene Provinzen vordringt.
"Mein" Indien ist primär dörflich und abgeschieden. Die Menschen leben entlang des Stromes Godavari. Die meisten sind Adivasis und gehören einem der indigenen Volksstämme an, deren Lebensräume stark bedroht sind. Da wird hart gearbeitet, da wird gekämpft und gelitten, aber auch gelacht und gefeiert. Religion spielt wie überall in Indien eine große Rolle - aber es sind nicht Hindus, sondern Christen, denen ich primär begegne. Zusammen mit anderen begleite ich eine Partnerkirche im süd- und zentralindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Mitleben in ihren Hütten, Schlafen auf dem Boden, Essen mit den Händen und was auf dem Bambusblatt serviert wird ... Indien zum Anfassen.
Sollten Sie mehr über diese Region Indiens und die Christen dort wissen wollen, durchforsten Sie gerne unsere Homepage www.fmd-online.de Dort finden Sie auch aktuelle Infos. Die in diesem Buch abgedruckten Impressionen geben ja nur Szenen, Beobachtungen und Eindrücke wieder - und das bis lediglich 2007. Danach hat auch Indien sich weiter verändert ...
Die hier abgedruckten kleinen Artikel sollen zwar auch informieren, Ihnen jedoch vor allem viel Freude bereiten, Sie an selbst Erlebtes erinnern und vielleicht auch erstmals oder erneut neu "Lust auf Indien" machen. Also: Viel Spaß beim Lesen!
Ach ja: Außerdem gebe ich am Ende des Buches einige Tipps, wie man sich auf das Land vorbereitet und dort reisen kann. Ich freue mich sehr, wenn eine Anregung dabei ist, die Ihnen und euch hilft, sich in Indien sicher und bereichernd zu bewegen.
Wenn Sie noch mehr lesen möchten, empfehle ich meine auch bei BookRix erschienen Romane: Sie lassen Leserinnen und Leser in die fremde und faszinierende Welt entlang der Godavari eintauchen und bieten dabei spannende Unterhaltung. Ganz hinten habe ich noch einmal beschrieben, worum es in den Romanen geht.
1. Morgenstimmung - ein Dorf erwacht
Erwachen. Und einen frühen Morgen erleben, als ob die Schöpfung heute beginnt. Es ist kurz vor fünf und es dämmert. Hahnenschrei aus dem Nachbardorf, leise aber eindringlich. Jener Gockel neben meiner Pritsche erspart mir den Wecker als er seinem Kumpel antwortet. Vögel zwitschern, Hühner gackern. Frauen reinigen den Boden, mit Besen aus Bambusbinsen. Überall Fegegeräusche. Wie oft bin ich davon inzwischen aufgewacht, als Gast in einem der unzähligen Koyadörfer, bei den Ureinwohnern Indiens, den Adivasis? Das Sauberhalten des Bodens erfordert viel Arbeit. Mehrmals am Tag wird der aus einem Gemisch aus Dung und Lehm aufgetragene Boden, der sich schnell abnutzt, gereinigt. Staub, Kot von Ziegen und Hühnern, weggeworfenes Papier – es gibt viel zu beseitigen. Es staubt. Ich muss meine Sachen in Sicherheit bringen. Schnell stehe ich auf, schlüpfe in den traditionellen Lungi, eine Art Wickelrock für Männer, und setze mich, nachdem ich meinen Koffer geschlossen habe, vor die Hütte auf einen Klappstuhl aus Blech. Die Luft ist klar und überaus angenehm. Männer und Frauen gehen mit dem Wassergefäß in die Büsche. Ihr Gang hat etwas Besonderes: Gelassenheit und Ruhe ausstrahlend, beinahe meditativ. Toilettengang. Für mich war das zunächst ungewohnt, aber inzwischen genieße auch ich es: Da sitzen, den Blick über die von Nebel verhangenen Reisfelder und ein Flusstal schweifen lassen ... Ein Mann schneidet Bananenblätter als Futter für seinen am Weg angepflockten Wasserbüffel, eine Frau kippt den von gestern übrig gebliebenen Reis in eine Schale und gibt ihn den schwarzen Ziegen. Die Tiere sind neben Wald und ein wenig Ackerbau ihr Reichtum, ihre Lebensgrundlage. Geschickt das Wasser verteilend wäscht sich ein junger Mann Gesicht, Arme und Füße. Am Bambuszaun hängen Zahnbürsten im Körbchen. Die meisten Leute nutzen jedoch die Zweige eines speziellen Baumes zur Zahnhygiene. Zahn- und andere Ärzte gibt es hier nicht, nur eine einfache Krankenstation, in mehreren Kilometern Entfernung. Erste Klappergeräusche. Frauen bereiten das Frühstück vor. Kinder streifen durch das Dorf. Zwar fährt gegen sechs der Schulbus einer „St. Mary School“ vor, es steigt jedoch niemand ein, wenn auch inzwischen nicht nur die kirchlichen, sondern auch staatliche Schulen laufen. Felder, Palmen, Bambuszäune, Hütten, Höfe, Tiere und Menschen, alles bekommt durch den Morgen seine besondere Note und wird nie so erlebt wie zur frühen Stunde. Ob darin die Magie des Ostermorgens verborgen ist? Das Leben beginnt neu.
Gegen sieben fährt der erste Trecker vorbei und bringt Arbeiter und Arbeiterinnen auf die Felder. Ein harter und schwerer Tag beginnt für sie. Tagelöhner, die für etwas mehr als einen Euro bis zum Abend schuften. Obwohl die Sonne hinter aufsteigenden Wolken noch nicht zu sehen ist, wird es schnell warm. Der Morgen weicht dem Tag, der Neubeginn dem Alltag, der mit „stillem Zauber“ begnadete Anfang der Normalität.
Ich bin froh, dass ich in diesem Dorf von der manchmal nervenden „Zivilisation“ Indiens verschont bleibe, dem Geplärre morgendlicher Musik und dem Dauergehupe. Hier hat sich offenbar die Lebensweise der Stammesbevölkerung noch erhalten. Noch. Ein wenig.
2. Ankommen - nur einmal die Straße überqueren
Wie für alle Reisenden beginnt auch mein Aufenthalt in Indien in einer Stadt. Wo die Flughäfen sind, und der Zoll mit seinen Stempeln, und die Wechselstube in der ich einige Scheine tausche und die ich mit dicken Geldbündeln verlasse, und so richtig nette Hotelerfahrungen. Letztere zuletzt mit drei Sternen. Auf der Toilette sind weder Papier noch Handtücher. „Die bringen wir erst, wenn die Gäste da sind,“ sagt der Mann an der Rezeption mit seinem Dauerlächeln im Gesicht, „no problem!“. Praktisch, da kann man gleich das zweite Trinkgeld verteilen, nach dem fürs Koffertragen und Tür aufschließen und Fernseher anmachen. Und „no problem?“ Wenn ich das höre, weiß ich, dass ich in Indien und meine indischen Freunde in ihrem unnachahmlichen Improviasationselement angekommen sind. Na ja, und natürlich der Verkehr gehört zu den Städten wie der Pulsschlag zum Blutkreislauf. Bei meiner letzten Reise, zusammen mit einer Gruppe junger Leute, ein Grund für Christian, dass der gleich wieder nach Hause wollte. Er hatte das Pech, im Kleinbus vorne zu sitzen, in Hyderabad, der Hauptstadt des südindischen Bundesstaates Andhra Pradesh. Nur das Überqueren einer breiten Straße, zum Beispiel in der Nähe des Flughafens, ist dort aufregender als das Autofahren selbst.
Ja, nur einmal die Straße überqueren. Das sagt sich so leicht. Wie ein Strom quellen die Fahrzeuge über die je drei Spuren in eine Richtung an mir vorbei. Drei? Es sind so viele Spuren, wie Fahrzeuge nebeneinander passen. Im Abstand von zehn Zentimetern und weniger. Wie viele Ansätze ich mache, um einen ersten Schritt zu wagen? Ich zähle nicht. Gerade will ich losgehen, da braust ein dicker Bus heran. Dahinter ein LKW. Wieder wage ich es. Wildes Hupen durch ein Dreirad, „Auto“ genannt, aber eigentlich ist es eine Motorrikscha. Gleich fünf oder sechs dieser Minitaxis, von denen es in dieser Millionenstadt zigtausend gibt, rauschen hupend an mir vorüber. Ich springe einen Schritt zurück, um nicht von einem Motorradfahrer
erwischt zu werden, der mitsamt seiner Frau und zwei Töchtern unterwegs ist. Hilflos warte ich auf eine Lücke im Strom der Fahrzeuge. Sie entsteht nicht. Ich muss mich wohl doch an jenen Lebensmüden orientieren, die trotzdem gehen. Also los, gerade sind keine dicken Busse oder Lastwagen in Sicht. Ich gehe langsam, ganz wie ein vorsichtiger Schwimmer einen reißenden Strom betritt, einen Schritt hinein in den Verkehrsstrom. Es geht. Autos umfahren mich, Motorräder und Fahrräder machen einen Bogen, halten an, werden langsamer. Sie halten Abstand, wenn auch nur wenige Zentimeter. Ein Geländewagen scheint mich nicht zu sehen. Ich gehe einen Schritt zurück und damit scheint hier niemand zu rechnen, denn prompt werde ich beinahe von einer der Lastenrikschas (auch Dreiräder) angefahren. Also vorwärts, eine andere Möglichkeit bleibt ohnehin nicht mehr. Wie ein Torero im Angesicht des Todes warte ich jenen Moment des nächsten Schrittes ab und gleich wütenden Stieren gleiten die Fahrzeuge zum Greifen nahe an mir vorüber.
Längst habe ich keinen Sinn mehr für den furchtbaren Smog, der einem die Luft zum Atmen raubt. Irgendwann erreiche ich den Mittelstreifen. Dort gibt es eine 30 cm hohe Steinbrüstung. Ruhepause. „Keep the city clean!“ fordert mich ein Schild auf. Ja, das haben sie geschafft in Indien, jedenfalls fast. In den letzten Jahren haben Müllabfuhr und Begrünung das Bild der Großstädte deutlich verändert. Sogar die heiligen Kühe mussten die Innenstädte verlassen. Hier, an dieser Stelle, hätten sie auch keine Chance. Wie ich. Ich bin nun beidseitig von Fluten umgeben. Doch weiter. Losgehen, stehen bleiben, Handzeichen, dezent zurückweichen, einen winzigen Schritt nach vorn um in nächster Reihe zu stehen. Jeden gewonnenen Zentimeter verteidigen. Noch zwei Schritte. Angst vor dem Bus, der ohne Rücksicht auf mich zudonnert. Hupen in allen Tonlagen. Stoßgebete. So komme ich denn doch auf die andere Seite der Straße und bei einiger Übung geht es immer besser. Ich merke, dass die Verkehrsteilnehmer zwar jede Lücke ausnutzen, mir jedoch das Gleiche zugestehen und eher defensiv als offensiv fahren. Hurra, ich lebe noch! Auf dem Rückweg probiere ich es an einem Zebrastreifen. Das gleiche lebensgefährliche Unternehmen, so als ob es ihn nicht gäbe.
Immerhin, daran, dass diese Zeilen entstehen, merkt man, dass ich selbst das Überqueren der Straße gesund überstanden habe. Was soll mir nun noch passieren?! Fliegen erscheint mir dem gegenüber wie ein Spaziergang im Park. Und jene Dörfer entlang des mächtigen Flusses Godavari wie ein Teil des Paradieses – wenn auch nach dem Sündenfall.
3. Esther Rani - von der Stammespriesterin zur Bischöfin
An der Godavari, 350 km östlich von Hyderabad. Touristen kommen neuerdings sogar in diesen Teil der Welt, Weiße allerdings nicht, außer uns Kirchenleuten. Von Rajamundhri aus, am Delta des über 1.400 km langen Stromes gelegen, fahren bunte Boote flussaufwärts. Nach einigen Stunden erreichen sie Perentapalli, eine kleine pantheistische Tempelanlage mitten im Stammesgebiet. Hier hat Esther Rani in den sechziger Jahren eine Ausbildung zur Priesterin erhalten. Schon ihre Mutter war Priesterin ihres Dorfes Arukuru, am Sabari, einem wunderschönen Nebenfluss des Godavari, am Rande des Dschungels, gelegen. Von der Mutter auf die Tochter. Oft werden priesterliche Berufungen an die Kinder weitergegeben und mit ihnen auch Kenntnisse über Heilkräuter, religiöse Symbole, Götter und Macht. Arische Völker, aus dem Norden kommend, haben jenes Wissen und auch den Kultus der Naturvölker übernommen und mit ihren Religionen vermischt. Daraus entstanden ist der Hinduismus. Die Stammesleute selbst aber haben sie vertrieben und als Nicht-Menschen diffamiert, ausgebeutet und sowohl an den Rand der Gesellschaft als auch in die abgelegensten Gebirgsregionen des indischen Subkontinents getrieben. Und nun kommen sie, die Hindus und Stadtmenschen als Touristen genau dorthin. Und als Händler und Großbauern. Und als Landvermesser. Und als Ingeneure und Geologen und Politiker. Esther, Angehörige des Koya-Stammes, muss sich mit ihnen herumstreiten. Allerdings nicht mehr als Stammespriesterin.
Heute ist sie Pastorin und Präsidentin ihrer Kirche. Von der heidnischen Priesterin zur christlichen Bischöfin. Ein langer und aufregender Weg. Esther wurde 1981 getauft. Ich war damals dabei. In einem mit roten und weißen Seerosen bewachsenen Teich wurde sie untergetaucht. Wie in biblischen Zeiten. Nebenan tranken Rinder von demselben Wasser. Für Esther begann ein neues Leben und eine überaus turbulente Biografie. Sie zerstörte ihr Götzenbild und erklärte es allen, die es hören wollten oder auch nicht: „Das sind alles von Menschen gemachte Götter! Ich glaube jetzt an den, der uns gemacht hat!“ Danach bedrohte man sie, mied sie, stieß sie aus. Doch sie blieb. Eine Gemeinde entstand. Und wuchs.
Acht Jahre später. Esther nimmt mich mit in eines der Dörfer, wo sie als „Bibelfrau“ regelmäßig christliche Familien besucht. Nach zwei Stunden Fußmarsch durch den Dschungel und immer bergauf, erreichen wir Gondikotagudem. Mir schmerzen die Füße. Zwei Jugendliche massieren sie mir. Das tut gut. Wir beten für eine Frau, die mit Fieberkrämpfen auf einer Pritsche liegt. Hier gibt es keinen Arzt. Die Leute haben oft nicht das Geld für den Bus – und um den zu erreichen benötigen sie mehrere Stunden. Also liegt diese Frau dort schon einige Tage und leidet. Wenn sie Malaria Tropika hat, wäre das tödlich für sie. Gott, hilf!
Ich bin total kaputt von der Wanderung, schlafe ein wenig. Als ich aufwache, ist es dunkel. Über mir tausend Sterne. Eine Frau bringt mir süßen Tee, dann Reis und Chickencurry. Bis heute ist das Essen in den Stammesdörfern unglaublich scharf, auch wenn ich mich inzwischen an manches gewöhnt habe. Ich habe Hunger. Bei meiner letzten Reise am Anfang diesen Jahres sagte eine Frau zu mir: „Du kannst ja inzwischen richtig gut mit den Fingern essen!“ Ich fragte zurück, ob das früher nicht so war. „Es war nur lustig!“ antwortete sie diplomatisch und in ihrem indischen Englisch klingt das auch ziemlich lustig. Also in Gondikotagudem vor vielen Jahren muss es „nur lustig“ gewesen sein. Ich danke der Frau, die mich dort bedient. Und plötzlich erkenne ich sie. Es ist jene Kranke, für die wir gleich nach unserer Ankunft gebetet haben. Das Fieber ist weg.
Draußen haben sich junge Frauen, eher noch Mädchen versammelt. Sie tanzen im Schein einiger Öllampen. Zwei Männer schlagen Trommeln. „Re re la ...“ Es ist ein Loblied, mit christlichem Text zu einheimischer Melodie. Und dann singen sie einen Protestsong. „Der Wald wird gerodet, das Wasser vergiftet, die Lebensgrundlage zerstört und wir werden vertrieben und verachtet. Wer hilft uns? Wer rettet uns? Die Schönheit und die Liebe dieser Mädchen würden wir ihm geben.“