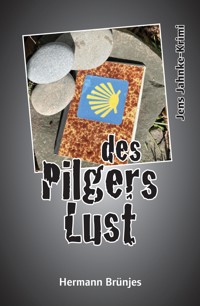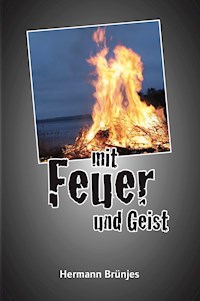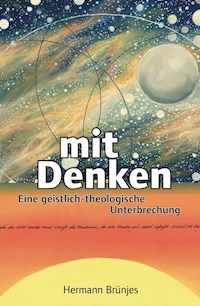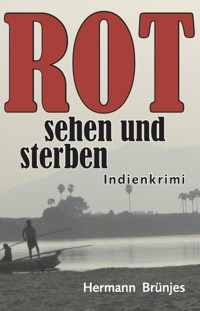2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Polizist wird erschossen, ein Wachmann erdolcht. Jedes Mal werden zwei Weiße am Tatort gesehen. Chidambaram, Chef einer Polizeistation in der indischen Provinz, muss viel einstecken, bevor er die Karriereleiter hinaufsteigen kann.
Sie beginnen ihre Reise noch wie geplant und tauchen in die fremde und zugleich faszinierende Welt Südindiens ein. Dann jedoch folgen Max und Tobias einem mysteriösen Inder, den sie in Dubai kennengelernt haben. Sie folgen ihm in ein Indien jenseits der Touristenrouten und dessen, was sich die beiden Deutschen in ihrer Fantasie hätten ausmalen können. Sie werden ahnungslose Opfer eines Spiels um Macht und Interessen, werden verstrickt in den Befreiungskampf eines Stammesvolkes, des Terrors verdächtigt und von der Polizei gejagt. Sie geraten in die Hände von Rebellen und hinter ein tödliches Geheimnis.
Die Handlung dieses spannenden Romans ist frei erfunden und könnte doch so oder ähnlich geschehen sein. Es ist Abenteuerroman, Politkrimi, Reiseerzählung und Liebesgeschichte zugleich. Sensibel nimmt der Autor dabei auch die
Entdeckungen und Gefühle von Erstbesuchern des Subkontinents auf und das Buch enthält zudem eine Menge Hinweise für den Besuch eines der faszinierendsten Länder unserer Welt. So wird es zu einem Indienroman der besonderen Art und hochaktuell dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Abstecher
Ein Indien-Roman
Gewidmet meinen lieben Freundinnen und Freunden in Indien. Ihr habt mir über Jahre den Stoff geliefert, aus dem Abenteuer, Herausforderungen und Spannung entstehen - aber auch Träume, Faszination, Glaube und Liebe. Danke. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenProlog
»Eindeutig eine Stichverletzung!«
Der Mediziner schob das Laken zurück und zeigte auf einen breiten Einschnitt unterhalb des Herzens. »Hier hat jemand mit voller Wucht zugestoßen. Es muss ein starker Mann gewesen sein, mit einem schweren, langen Messer.«
Chidambaram beugte sich über den unbekleideten Leichnam des dürren, alten Mannes.
»Woher weißt du, dass die Waffe lang gewesen sein muss?«
Der Arzt packte den Toten an einem Arm und drehte ihn mit geübtem Griff auf die Seite. Der Rücken wurde sichtbar. Dort gab es einen ähnlichen, rotgeränderten Schnitt, nur etwas schmaler.
»Deshalb!«, sagte er und ließ den Körper wieder in Rückenlage gleiten. Er ging zum Nachbartisch.
Dort lag ein zweiter Leichnam. Als er das Laken gen Fußende geschoben hatte, sagte der Arzt:
»Dieser hier ist erschossen worden. Warten Sie bitte!«
Er ging an einen hüfthohen Schrank, der an einer Wand unter schmalen Fenstern stand, die den sonst fast kahlen Raum in ein fahles Licht tauchten. Chidambaram bemerkte, dass auf dem Schrank neben Schalen, medizinischen Instrumenten und einigen dicken Büchern auch eine Flasche stand, die einer Whiskyflasche auffallend ähnlich war. Sie bemühen sich nicht einmal, den Alkohol zu verstecken, dachte er. Doch er sagte nichts. Der Arzt sah in seinem schmuddeligen Kittel zwar nicht gerade sauber und hygienisch steril aus, hatte aber weder eine Fahne noch benahm er sich irgendwie alkoholisiert. Im Gegenteil, er machte durchaus einen fachlich kompetenten Eindruck.
»Diese beiden Projektile habe ich ihm aus der Brust gezogen«, sagte der Mediziner.
Er nahm eine der beiden Kugeln mit der Pinzette aus der Schale und zeigte sie dem Inspektor.
»Kaliber 5, 45 mm«, bemerkte dieser nachdenklich. »Die typische Munition einer AK 47, der Kalaschnikow.«
»Eine Kugel hat das Rückenmark zertrümmert, die andere ist in die Lunge eingedrungen. Ich schätze, ihr Kollege war sofort tot.«
»Und der andere Tote?«
»Der könnte noch einige Stunden gelebt haben, hat jedoch viel Blut verloren und konnte sich deshalb nicht mehr rühren.«
Es klang brutal. Es war brutal, dachte Chidambaram.
Als er wieder im vor der Klinik abgestellten Polizeijeep saß, griff er zu seinem Diktiergerät, das ihm Kollegen anlässlich seiner Ernennung zum Polizeichef von Ashwaropeta geschenkt hatten.
»3. Januar, 10.30 Uhr. Ergebnis einer ersten ärztlichen Untersuchung in der Klinik Ashwaropeta: Inspektor Satyam Rao wurde von zwei 5, 45 mm Projektilen in Lunge und Rückenmark getroffen. Er war nach Aussage des Polizeiarztes sofort tot. Sowohl die Zeugenaussagen der gestern am späten Abend des 2. Januars in die Schießerei verwickelten Polizisten als auch die benutzte Munition legen nahe, dass es sich um einen Terroranschlag der Naxaliten handelt.«
Er machte eine Pause. Ein Ochsenkarren, beladen mit Reisstroh, zockelte vorbei. Der Junge hinter den Zeburindern schien im Stroh zu schlafen, statt das Gefährt zu lenken. »Die Ochsen kennen ihren Weg“, dachte Chidambaram, »wir Menschen haben damit oft größere Probleme.“ Er diktierte weiter:
»Der Wachmann der Indira-Sagar-Siedlung dagegen wurde erstochen. Die dazu benutzte Klinge muss so lang gewesen sein, dass sie am Rücken wieder austreten konnte, also mindestens fünfundzwanzig Zentimeter. Auf Grund der Wunde schätzen wir die Breite der Tatwaffe auf drei Zentimeter. Der Täter muss stark gewesen sein. Der Stich wurde von oben nach unten ausgeführt. Folglich saß der Wachmann, als er angegriffen wurde, oder der Täter war wesentlich größer als sein 168 cm großes Opfer. Der Zeitpunkt seines Todes stimmt mit dem der Sprengung des Gebäudes in Gullavai überein. Der Mann wurde gestern Nacht gegen 2.00 Uhr, also nur wenige Stunden nach dem Überfall in Kukunuru, erstochen.«
Er sah aus dem Fenster und dachte über seine nächsten Schritte nach. Wenn er zurück in seinem Büro war, würde er die Zeugenaussagen noch einmal durchgehen. Die unterschiedlichen Todesursachen legten nahe, dass es sich um verschiedene Täter handelte. Oder auch nicht. Einziges Verbindungsglied der Morde war, dass sie fast zeitgleich geschahen und drei übereinstimmende Hinweise von Zeugen. Einer kam von Polizisten der überfallenen Polizeistation, einer von zwei Jugendlichen, die in der Nähe des zerbombten Gebäudes lebten und einer von Teilnehmern einer Demonstration gegen den Polavaram-Staudamm. Sie alle hatten einen grauen Jeep gesehen. In den ersten zwei Fällen sprachen die Zeugen von zwei weißen Männern, die mit diesem Jeep unterwegs gewesen waren. Wie diese ausgesehen hatten, konnte niemand genau beschreiben. Wie Weiße eben aussahen. Einer soll sehr stämmig gewesen sein, der andere normal. Der Inspektor wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Delikat, äußerst schwierig«, dachte er. »Wenn Weiße auftauchten, war besondere Sorgfalt bei den Ermittlungen angesagt.«
26. Dezember: Fremde in der Nacht
»Da ist er wieder!«
Plötzlich stieß Tobias seinen Freund derbe in die Seite. Aufgeregt zeigte er auf eine der unzähligen schwarzgelben Motorrikschas, die sie bei stockendem Verkehr gerade überholt hatte.
»Hey, ich glaube, er verfolgt uns!«
Er hatte das Gesicht des Mannes zwar nur für einen kurzen Augenblick von der Seite gesehen, trotzdem war Tobias überzeugt, dass es jener Inder war, den sie in Dubai getroffen hatten. »Ich glaube, das war eben dieser Krishna aus Bristol!«
»Unmöglich!«
Max sah jetzt nur noch einen dunklen Haarschopf hinter der Plastikscheibe der Kabine. Er rieb sich die Stelle seiner stattlichen Hüfte, in die sein jüngerer Freund gerade geboxt hatte.
»Zwischen viereinhalb Millionen Einwohnern willst du ausgerechnet diesen Krishna wiedergesehen haben? Es gibt hier Tausende solcher Rikschas – und da soll in dieser dort vor uns der Typ vom Fluss sitzen?«
»Du hast Recht«, murmelte Tobias, wenn auch nicht ganz überzeugt.
»Die sehen ja auch irgendwie alle gleich aus.«
Allerdings, auch wenn sein Verstand und sein bester Freund Max es ihm ausreden wollten, ein merkwürdiges Gefühl blieb. Er hatte bereits im Flughafen den Eindruck gehabt, von diesem Mann ständig beobachtet zu werden. Tobias nahm sich deshalb vor, wachsam zu bleiben. Irgendetwas war mit diesem Krishna nicht in Ordnung, das spürte er.
Gestern hatten sie endlich ihren lang ersehnten Traumurlaub angetreten, sozusagen als besonderes Weihnachtsgeschenk. Viele Freunde hatten dringend abgeraten, gerade jetzt nach Indien zu reisen. Die furchtbaren Bombenattentate von Bombay hatten gezeigt, dass nun auch Indien im Fadenkreuz islamischer Terroristen lag. Man war dort offenbar nur knapp an einem Krieg zwischen zwei Atommächten vorbeigeschrammt. Und man wusste nie, wozu Völker in jener Region der Welt fähig waren, wenn Politiker erst die Kontrolle über fanatische Massen verloren. Doch sie hatten die Warnungen als Panikmache abgetan. Sie hatten ihre Sachen gepackt und wie Kinder auf den Weihnachtsmann auf den Tag ihrer Abreise gewartet. Und nun waren sie mit einem uralten Taxi auf dem Weg in ihr erstes indisches Quartier.
Für Tobias Grunert war es die erste Reise, die ihn außerhalb von Europa führte. Der schlanke, jetzt achtundzwanzig Jahre alte Steuerberater war zwar mit seinen Eltern in den typischen Urlaubsländern am Mittelmeer gewesen, niemals jedoch in einem wirklich anderen Kulturkreis. Entsprechend aufgeregt war er vor dem Abflug. Genau genommen konnte er trotz gründlicher Vorbereitungen auf Indien bereits seit dem zweiten Adventssonntag nicht mehr schlafen. Damals hatte er im Spätprogramm die Wiederholung einer Indien-Reportage von Klaus Kleber gesehen: Indien unaufhaltsam. Wie ein kleiner Junge freute er sich seitdem auf Weihnachten.
Anders Max Hoyer. Um seinen Schlaf brachte ihn selten etwas. Reisefieber schon gar nicht. Als Informatiker hatte er bereits dienstlich in Amerika zu tun gehabt, genauer in New York und Washington. Dort hatte er Filialen einer deutschen Bank mit neuer Software beglückt. Doch auch Maximilian, wie er mit vollem Namen hieß, war niemals zuvor in Asien gewesen. Er war mit knapp über dreißig älter als sein Freund. Wegen seiner kräftigen Statur hatte er Platzprobleme auf dem schmalen Sitz der Touristenklasse. Ihn allerdings als ‚dick’ zu bezeichnen, täte ihm Unrecht.
Als sie die Boeing 777 der Emirates Airlines in Dubai verlassen hatten, brauchte deshalb vor allem Max erst einmal einige Minuten, bis seine Knochen wieder im Lot waren.
»Das nächste mal entweder einen Platz am Ausgang oder einen in der Business Klasse, wie ich es sonst gewohnt bin!« hatte er vor sich hin gegrummelt.
»Kannst ja mal bei Microsoft anfragen, ob sie dir einen Sitz sponsern. Vielleicht zahlen sie dir sogar noch den Urlaub! So einen spritzigen Softwaremann wie dich wollen die sich doch sicher warm halten.«
»Von wegen. Die stellen eher einen Inder ein. Der ist billiger.«
Das Gespräch war unterbrochen worden. Sie hatten den Sicherheitscheck für ankommende Fluggäste erreicht.
»Wieso überprüfen die uns noch einmal? Sieh’ mal, sogar die Gürtel sollen wir rausziehen und die Schuhe durchleuchten lassen. Tobi, das können die uns doch nicht antun!«
Max verzog das Gesicht. Sich bücken, das war nichts für ihn. Tobias reagierte nicht. Er hatte seine Schuhe bereits in der Hand, legte sie zusammen mit dem Gürtel und seiner Jacke in die Plastikkiste und stellte seinen kleinen Rucksack auf das Band. Max folgte ihm und schimpfte dabei vor sich hin.
Dann waren sie in Dubai, besser gesagt im Flughafen, im nagelneuen Terminal drei.
»Wow!«
Selbst Max konnte sich ein Staunen nicht verkneifen.
»Was dazu wohl unser nichtreligiöser Sinnsucher sagen wird?«
Er meinte damit einen Sitznachbarn aus dem Flugzeug. Der sehr kleine Mann hatte eine Kappe wie ein Moslem getragen, behauptete jedoch, er würde nach Indien reisen und dort einen heiligen Berg besuchen. Er wäre schon öfter dort gewesen. Als Tobias wissen wollte, ob er Hindu sei, hatte sich der Pilger jedoch distanziert und gemeint, es sei besser, sich keiner Religion zu verschreiben, sondern einfach an die Liebe und das Göttliche zu glauben und einfach und schlicht leben. So würden auch keinerlei Barrieren zwischen Menschen aufgebaut.
»Ich vermute, der kriegt hier gleich einen Kultur- und Konsumschock!« antwortete Tobias und sah sich nach dem kleinen Mann um.
Sie erkundeten den Terminal. Welch eine Pracht! Überall zollfreier Einkauf. Technik vom Feinsten, Kleidung, Lederwaren, Schmuck - selbst alkoholische Getränke und Zigaretten hatte das moslemische Emirat zu bieten. Der Reichtum glitzerte und strahlte aus jedem Winkel des prächtigen Terminals.
»Schau mal!«
Max hatte schon bei Verlassen des Flugzeugs auf ein Schild von Thyssen Krupp hingewiesen.
»Nicht nur die Gangways sind aus Deutschland, auch die bei den Ölscheichs beliebtesten Autos.«
Ein Mercedes und ein BMW der Oberklasse waren ausgestellt. Für Lose im Wert von je 100 Dollar könnte man sie mit guten Chancen gewinnen.
»Als ob die mit ihrem Öl nicht schon genug verdienen, nun müssen sie auch noch die Touristen ausnehmen.«
Tobias fand so manches ungerecht, was die Verteilung von Geld anging. Als Finanzbeamter hatte er inzwischen manch Einblick bekommen, der ihm gar nicht gefiel.
Als sie die letzte Stunde der Wartezeit bei einem Cappuccino in einem Restaurant gesessen hatten, hatte Max in Richtung Theke genickt. Dort saß ein großer Mann mit Brille und sprach mit der Bedienung, einer wirklich hübschen Asiatin.
»Unser Sextourist ist schon wieder im Geschäft.«
Tobias erkannte ihn sofort. Es war jener Single vom Gangplatz gegenüber. Sie waren nicht nur mit dem Sinnsucher, sondern auch mit diesem Bangkok-Reisenden ins Gespräch gekommen. Er hatte erzählt, dass er geschäftlich nach China müsse, zunächst jedoch einen Stop in Bangkok mache. Dort habe er, der Single, eine feste Freundin. Wie der Sinnsucher stolz das Foto seines geliebten heiligen Berges auf dem Handy präsentierte, so dieser Mann seine hübsche asiatische Freundin.
»Wirklich aufregend, so eine Reise! Wer weiß, was wir noch alles erleben! Vielleicht findest du ja auch mal jemanden und bringst dann ein nettes Foto mit nach Hause.«
Tobias spielte damit auf ein Thema an, von dem er wusste, dass Max darüber nicht gerne sprach. Während er, Tobias, in festen Händen war, konnte Max irgendwie niemanden finden. Dabei war er doch richtig nett, klug und hatte einen guten Job. Und zu fett war er nun auch nicht.
»Aber keine Asiatin!« entgegnete Max.
»Wer weiß, vielleicht aber ´ne hübsche Inderin.«
Ohne Zweifel, es könnte eine spannende Reise werden.
Und dann hatten sie ihn das erste Mal getroffen.
»Entschuldigen Sie«, hatte er in bestem Englisch höflich gefragt, »ist dieser Stuhl noch frei?«
Sie hatten genickt und er sich gesetzt. Wie genau sie ins Gespräch gekommen waren, wußten sie später nicht mehr. Jedenfalls stellte sich heraus, dass der Mann ebenfalls nach Chennai fliegen würde.
»Ich heiße Rama Krishna Rao«, hatte er sich vorgestellt.
Er war schlicht und unauffällig gekleidet und sah irgendwie aus wie alle Inder, jedenfalls mit europäischen Augen betrachtet: Nicht besonders groß, eher schlank als stämmig, mit hellem Hemd und dunkler Hose gekleidet, mit einem Schnurrbart unter der breiten Nase und einem goldenen Ring am Finger. Er war nett. Also unterhielten sie sich mit ihm. Er schien aufrichtiges Interesse an ihnen zu haben. Also erzählten sie, was sie so machten, woher sie kamen, was sie in Indien vorhatten und dass sie noch niemals dort waren. Er hatte sehr aufmerksam zugehört und immer wieder Fragen gestellt.
Irgendwann war Tobias dann aufgefallen, dass nur sie von sich erzählt hatten, jedoch noch nichts von ihrem Gegenüber wussten.
»Und Sie?« hatte er deshalb gefragt. »Erzählen Sie doch auch ein wenig von sich.«
Krishna Rao hatte sich zwar darauf eingelassen, gab allerdings nur sehr allgemeine Dinge preis. Er kam tatsächlich aus England. Er lebe in Bristol, erzählte er und unterrichte Geografie an der Universität. Er war von London nach Dubai geflogen und wollte nun in seine Heimat, um anlässlich des Pongal-Festes Verwandte zu besuchen. Er käme aus der schönsten Gegend Indiens! Als er das sagte, strahlte er dermaßen, dass Tobias und Max es ihm sofort glaubten und neugierig wurden, wo wohl diese Gegend sein könnte.
»Woher kommen Sie denn genau?«
»Aus dem Bundesstaat Andhra Pradesh. Der Staat liegt nördlich von Tamil Nadu. Aber ihr habt ja unsere Hauptstadt Hyderabad auf eurem Programm und wisst das. Der Staat ist, abgesehen von seiner Küste und der Hauptstadt, nicht so aufregend. Aber dort gibt es einen großartigen Fluss. Und der fließt durch die schönste Gegend Indiens.«
Dieser Inder hatte es vermocht, die beiden Deutschen neugierig zu machen. Man sah ihnen an, dass sie alles über Indien erfahren wollten, was in drei Wochen möglich war.
»Godavari heißt er. Übersetzt bedeutet das ‚göttlicher Fluss’. Die Godavari ist mit ihren mehr als 1.400 Kilometern einer der längsten Ströme Indiens. Sie fließt über weite Strecken durch Landschaften, die wie überall in Zentralindien von Landwirtschaft oder Brachland geprägt sind. Das ist also nicht besonders aufregend. Doch 200 Kilometer, bevor sie den Golf von Bengalen erreicht, durchquert sie ein wunderschönes Gebirge. Von dort komme ich.«
Die beiden Deutschen hatten von der Godavari noch niemals etwas gehört. Sie kannten den Indus und den Ganges, sonst eigentlich keinen weiteren Fluss. Doch, die Narmada! Dort ging es doch einmal um den Protest gegen einen Großstaudamm – oder? Hatten sich nicht Eingeborene, vor allem Frauen, aus Protest gegen den Damm an großen Bäumen fest gekettet? So genau wussten sie es nicht.
Um den Flug nicht zu verpassen, mussten sie zum Gate gehen. Krishna hatte sie begleitet, da er ja dasselbe Ziel hatte. Dass sich der Mann merkwürdig verhielt, hatte Tobias zu der Zeit noch nicht bemerkt. Im Wartebereich erzählte Krishna weiter von seiner Heimat. Es gebe dort in den Bergen noch viele wilde Tiere, sogar Tiger. Riesige Bäume, Bambus, Wasserfälle, idyllische Dörfer der Eingeborenen... es schien, als wolle ihr neuer Bekannter seine Heimat für Touristen erschließen, vor allem für junge, kraftvolle Männer mit Abenteuergeist im Herzen. Was Krishna erzählte, hörte sich wirklich überaus interessant an und wäre sicher einen Kurztrip wert. Allerdings schien diese Gegend unerreichbar für fremde Touristen, die weder die Sprache dieser Leute beherrschten, noch Kontakte dorthin hatten, noch die Zeit, von Indienurlaubern ausgetretene Pfade zu verlassen. Aber interessant wäre es schon...
Die Zeit in Dubai war schnell vergangen, die während des Fluges von dort nach Indien leider nur sehr langsam. Sie wurden müde. Krishna Rao saß weiter hinten im völlig ausgebuchten Flieger, also würden sie sich wahrscheinlich nicht wiedersehen. Die Freunde sprachen noch kurz über ihre neue Bekanntschaft. Sie fanden beide, dass dieser Krishna ein interessanter Typ war und dass seine Erzählung sie inspiriert hatte.
Schade, dass dieser Fluss völlig abseits ihrer Route lag und die von Krishna beschriebene Gegend jetzt, allemal hier oben auf über elf Kilometer Höhe, so unwirklich wie die Märchen aus tausend und einer Nacht erschien.
Irgendwann fiel zuerst Max und kurz darauf auch Tobias in einen unruhigen Halbschlaf.
Als sie die Maschine in Chennai verließen, roch es anders als im Märchen und sah auch anders aus. Nach Weihnachten duftete es auch nicht. Es roch nach Bohnerwachs und noch irgendetwas.
»Mottenkugeln oder Klosteine«, meinte Max sarkastisch.
»Dem Teppich nach zu urteilen ist es eher Verwesung.«
Tobias zeigte auf den ausgeblichenen und vielfach bekleckerten grauen Bodenbelag.
»Das Ankommen in Dubai war wie ein Bummel in den Edelboutiquen der Mönckebergstraße«, meinte Max, als sie in langer Schlange eine uralte klapprige Rolltreppe hinunter fuhren, »hier dagegen komme ich mir vor wie nach dem Ausverkauf eines Second-Hand-Ladens auf St. Pauli.«
Den ‚interessanten Typen’ hatten sie wieder gesehen, als er sich ganz hinten in der Nachbarreihe vor den Schaltern der Einreisekontrolle anstellte. Auch Krishna hatte sie entdeckt und es schien Tobias, als habe er nach ihnen Ausschau gehalten. Der Inder kam auf sie zu. Irgendetwas hielt er in der Hand.
»Hier ist meine Visitenkarte!« sagte er und reichte ihnen eine kleine, eng bedruckte Karte. Eine Adresse aus Bristol war angegeben und mit der Hand waren zwei indische Mobilnummern auf die Rückseite geschrieben.
»Ich lade euch ein! Wenn ihr wollt, kommt doch und seht, wovon ich euch erzählt habe. Es ist nicht bequem bei mir, doch ihr werdet erleben, was ausländischen Touristen sonst so gut wie nie zugänglich gemacht wird.«
»Aber wir haben schon ein volles Programm!« sagte Tobias, nahm jedoch trotzdem die Karte.
»Ihr könnt ja zuerst etwas Tourismus machen. Aber dann solltet ihr mich besuchen. Ruft an, wenn ihr in Hyderabad seid. Von dort ist es nur ein kleiner Abstecher. Ich sage euch dann, wie ihr reisen müsst und helfe euch bei der Anreise. Ihr solltet allerdings auf jeden Fall noch vor dem Pongal-Fest kommen, also bis zum 13. Januar.«
Die kurze Begegnung war abrupt beendet worden, weil die Deutschen zum Schalter mussten. Dort wartete auf sie ungeduldiger und mürrischer Staatsdiener, Herr über einen altmodischen Computerbildschirm, eine beachtliche Sammlung von Stempeln und die Einreise ins Land von Tausend und einer Nacht.
Krishna hatte noch einmal gewunken und ihnen zugerufen:
»Gute Reise!«.
Die beiden hatten einen Stempel in ihren Pass und auf das Einreiseformular bekommen und ihre Füße dann mit staatlichem Segen erstmals auf indischen Boden gesetzt. Was diesen Segen anging, war Krishna noch längst nicht dran. Sie verloren ihn aus den Augen, als sie den Kontrollraum verließen, um ihre Rucksäcke vom Gepäckband zu holen.
»Den sehen wir wohl nie wieder!«
Max hatte sehr sicher geklungen.
»Na, dann fröhliche Weihnachten!« hatte Tobias gesagt, als sie mit geschulterten Rucksäcken aus dem Flughafen traten. Allerdings war es hier ganz und gar nicht weihnachtlich. In Hamburg hatte es noch geschneit, bei minus zwei Grad. In Dubai war immerhin ein Weihnachtsmann durch den mit Girlanden und künstlichen Weihnachtsbäumen geschmückten Airport gelaufen. Hier in Chennai mochte es bereits jetzt, gegen neun Uhr morgens, an die 25°C warm sein. An der Absperrung vor der Tür drängten sich unzählige braune Gesichter. Weiße Hemden über dunklen Hosen dominierten. Dazwischen, wie bunte Blumen auf eintöniger Wiese, leuchteten einzelne Saris. Erst die Frauen brachten Farbe ins Bild. Einige Ärmel, aus denen dunkle Arme ragten, hielten den Ankommenden Schilder entgegen, auf denen Namen von Reisenden standen und die von Hotels. Die beiden Freunde marschierten wie auf dem Präsentierteller an den Wartenden vorbei, verfolgt von hunderten dunklen Augenpaaren. Fahrer von Taxis und Autorikschas versuchten, Kunden zu werben und standen offenbar in harter Konkurrenz zueinander. Die zwei Weißen waren besonders beliebt, rochen sie doch nach Geld und Ahnungslosigkeit.
»Taxi!« »Taxi!« »Auto!«
Es gelang Max, sich die meist kleinen und schmächtigen Fahrer vom Leib zu halten. Einen Kopf größer als sie und doppelt so breit, bahnte er sich und seinem Freund unerschrocken den Weg durch die Menge.
»Excuse me!« »No need!« »Thank you!«
Sich entschuldigend und doch klar abweisend, waren die zwei durch die drängelnden Leute vor der Absperrung marschiert. Gut, dass sie durch Reiseführer und Freunde, die bereits in Indien waren, auf diese Situation vorbereitet waren. Nicht auf Angebote eingehen. Zeigen, dass man weiß, was man will. Lieber ein Taxi am offiziellen Schalter bestellen und vorab bezahlen, als sich übers Ohr hauen lassen.
Ins Schwitzen kamen sie trotzdem. Schon die plötzlichen Sommertemperaturen trieben ihnen den Schweiß ins Gesicht. Die Menge war weniger dicht als zunächst angenommen. Auf der Straße vor der Halle wurde es ruhiger.
Weiter hinten entdeckte Tobias ein Schild: Taxis. Vor dem kleinen Schalter hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Tobias und Max reihten sich dort ein.
Der Parkplatz gegenüber stand voller Autos. Als Taxi war keines von ihnen gekennzeichnet. Japanische Modelle wie Toyota, Hyundai und Mitsubishi konnten die Deutschen sofort identifizieren, ebenso einen Ford Escort und zwei repräsentative Skoda Oktavia. Fremd waren ihnen die indischen Fabrikate von Maruti und Tata. Letztere bauten den Kleinwagen Indika, aber auch Jeeps, Kleinbusse und Vans. Einen Nano, jenen Kleinwagen für nur eintausend Euro, der in der internationalen Presse im letzten Jahr für Furore gesorgt hatte, fanden sie nicht.
»Der ist wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Markt«, meinte Max und hatte damit Recht. Von der Ankündigung bis zur Umsetzung konnte es dauern. Die Kunst des Wartens würden auch diese beiden Europäer in Indien noch lernen müssen.
»Bitte ein Taxi zum YWCA in die Stadt.«
Der Mann hinter der Luke schien Max tatsächlich verstanden zu haben. Während sie vorher am Gepäckband auf die Rucksäcke gewartet hatten, waren sie abwechselnd zur Wechselstube gegangen und hatten einige Euro eingetauscht. Jetzt wanderten davon die ersten 450 Rupien von einer weißen in eine dunkle Hand. Der Mann gab Max einen Fahrschein und das Wechselgeld. Max hatte es noch nicht eingesteckt, da stand schon ein Fahrer vor ihnen.
»Come, come!« forderte der dünne Mann im hellbraunen Anzug die beiden auf. Sie folgten ihm. Und dann standen sie vor ‚ihrem’ Taxi. Es war ein alter Ambassador. Vermutlich war dieser Oldtimer einmal weiß gewesen, nun hatte der Lack jedoch manche Kratzer, Beule und Schürfwunde und präsentierte sich in mattem Grau. Skeptisch sah Max das Fahrzeug an.
»Und der soll es bis in die Stadt schaffen?«
Er schüttelte seine braunen Locken.
Der Fahrer hatte schon den Kofferraum geöffnet. Ein Schlüssel war dazu nicht erforderlich, da er ohnehin nicht mehr schloss und mit einem Draht festgebunden wurde. Die Rucksäcke landeten neben einem profillosen Ersatzrad auf einer staubigen Wolldecke. Vermutlich war diese schon vor dreißig Jahren im Neufahrzeug mitgeliefert worden und niemand hatte sie seitdem ausgeschüttelt, geschweige denn gereinigt.
»Hoffentlich geht das gut!«
Tobias wies auf den rechten Vorderreifen. Ob auch der schon seit der Auslieferung am Fahrzeug steckte? Tiefe Furchen gaben den Blick auf das innere Gewebe frei. In diesem Mantel steckte offenbar ein Schlauch. Profil gab es keines mehr.
Sie stiegen ein. Die Polster waren zerschlissen. Zum Schutz hatte der Fahrer eine durchsichtige Plastikfolie darüber gelegt, die nach kurzer Zeit am Körper klebte. Früher musste dieses Unikum einmal ein komfortables Fahrzeug für Reiche gewesen sein. Der Himmel war kunstvoll gearbeitet, versehen mit Ornamenten und Fransen. Heute verkündigte das Vehikel seine Botschaft von Reichtum und Lebensqualität nur noch ganz, ganz leise. Bis der Motor sich zu Wort meldete.
Es dauerte einen Moment, bis der alte Dieselmotor ansprang. Dann umso kräftiger.
»Die erteilen jetzt bestimmt Start- und Landeverbot!« kommentierte Max die dicke Dieselwolke, die sie plötzlich einhüllte wie der berüchtigte Londoner Nebel den Tower. Aber es ging los. Die Kiste fuhr sogar, wenn auch die Lenkradschaltung krachte, der Motor stotterte und spuckte wie ein alter Drache und das Lenkrad wahrscheinlich mehr als zwanzig Zentimeter Spiel hatte. Der Fahrer schien seinen Drachen jedoch im Griff zu haben.
Sie waren von der durchwachten Nacht und wegen der Zeitumstellung müde und ein wenig benommen. Vielleicht hatten sie deshalb während der ersten halben Stunde auf der Fahrt vom Flughafen zum Gästehaus der internationalen Frauenbewegung kaum ein Wort gesprochen. Vielleicht hatte es aber auch an den Eindrücken gelegen, die so plötzlich und völlig überraschend auf sie eingestürmt waren. Ja, man hatte sie gewarnt, vor allem vor dem Straßenverkehr in Indien. Aber davon Hören und es selber erleben, waren zweierlei.
Sie saßen hinten. Max sah am Fahrer vorbei über den Beifahrersitz nach vorn, Tobias zur Seite aus dem Fenster.
Sie bogen auf eine breite Straße ein. Rechts auf einer großen Fläche Brachland spielten Jugendliche Kricket. In einem kleinen Wald, unter niedrigen aber ausladenden Bäumen, waren Hütten eng an eng errichtet worden. Sie schienen nur notdürftig aus Lumpen, Blech und Abfall zusammengezimmert zu sein. Kinder spielten an großen Pfützen, Frauen wuschen Wäsche darin. Gleich darauf kamen sie an einem großen, modernen Gebäude vorbei. Ein riesiges Plakat pries besonders komfortable und sichere Autos an: BMW. In der Niederlassung standen eine 3er Limousine und ein X3 Geländewagen.
»Eben noch ein Slum, jetzt unser deutscher Export!«
Max sagte es mehr zu sich selbst als zu Tobias.
Je weiter sie Richtung Stadt kamen, desto dichter war der Verkehr geworden. Was hier alles unterwegs war! Unglaublich! Nicht nur moderne Fahrzeuge, auch uralte Lastwagen, mit bunten Mustern und Fratzen bemalt; schief auf der häufig löchrigen Straße liegende Busse, deren Fenster vergittert waren und aus deren Türen riesige Menschentrauben quollen; unzählige Zweiräder als Transportmittel für einzelne Berufstätige bis hin zu fünfköpfigen Familien; dürre Gestalten schoben Fahrradrikschas, in denen Schulkinder in Uniformen saßen; ähnliche Fahrradkonstruktionen wurden zum Transport von irre langen Eisenstangen, riesigen zusammengebundenen Topfstapeln oder meterhoch aufgetürmte Plastikstühlen benutzt; auf einem offenen Lastwagen erlebten braune Rinder ihre wahrscheinlich letzte Reise zum Schlachthof; dazwischen Radfahrer, Fußgänger, Kühe, Hunde, Lumpen- und Papiersammler und sogar Hochzeitskutschen.
Die beiden staunten. Gleichzeitig klammerten sie sich an Sitz und Lehne fest. Die ‚Sicherheitsabstände’ waren atemberaubend. Zehn Zentimeter schien bereits eine Lücke zu sein, die irgendwer ausnutzen konnte. Also blieb man schön beieinander. Die geraden Straßen innerhalb der Stadt wurden zwar halbwegs zivilisiert befahren, wann immer jedoch eine Ampel oder Kreuzung kam, schoben sich alle Verkehrsteilnehmer zu einem einzigen Klumpen zusammen. Wenn dann auf Rot Grün folgte, löste sich dieser wieder auf und strömte auf die nächste Barriere zu, um dort erneut zu verklumpen.
Nicht nur der Verkehr, auch die Kulisse dieser Stadt war aufregend vielfältig. Häuser aller Größe und Form, meist mit flachem Dach; riesige Kästen aus Glas und Stahl, mit weiten Auffahrten und Sicherheitspforte; Geschäftshäuser mit Läden aller Art auf mehreren Etagen; alte, aus der Kolonialzeit stammende Fassaden mit Schnitzwerk und Balkonen; dann wieder winzige Wohnhäuser, eingezwängt zwischen mehrstöckigen Geschäftshäusern, die sich zum Teil noch im Bau befanden.
»Sieh Dir diese Gerüste an!«
Als sie an einer Ampel gehalten hatten, ragte der graue Rohbau eines mehrstöckigen Gebäudes neben ihnen gen Himmel. Die Decken waren nicht mit Stahl-, sondern mit Holzstangen abgestützt. An einer Seite hatten die Arbeiter ein Gerüst aus Bambus an der Wand hochgezogen, vier oder fünf Stockwerke hoch!
Schon war es weiter gegangen. Staunend und ungläubig hatten die zwei ihre ersten zwanzig Kilometer auf Indiens Straßen zurückgelegt. Überall waren Plakate. Plakate in jeder Größe, Farbe und Form. Plakate an Wänden, auf riesigen rostigen Stahlgestellen, an Bäumen, an Bussen... Man versuchte hier offenbar, sich im Ringen um Aufmerksamkeit zu überbieten. Das Ergebnis war ein Gesamtbild, das die einzelnen Angebote in sich aufsog wie ein Mosaik seine einzelnen Teile.
»Unglaublich«, hatte Max immer wieder vor sich hin gemurmelt. »Ich glaub, ich bin im Film! Ich habe nie so atemberaubende Weihnachten erlebt.«
Und dann hatte Tobias in jener Rikscha, die nun irgendwo dort vorne im dichten Verkehr fuhr, jenen Krishna gesehen – oder auch nicht. Je mehr er darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien es ihm. Warum sollte dieser Inder ihnen folgen? Und warum sollte er sich nicht zu erkennen geben? Je mehr er allerdings auf sein Gefühl achtete, desto unbehaglicher wurde ihm. Was, wenn sie doch verfolgt wurden?
Plötzlich bog ihr Taxi in eine Einfahrt ein. In einem Häuschen am Tor saß ein Wachmann in dunkelgrüner Uniform. Auf einem Schild stand ‚Young Woman’s Christian Association’.
»Hier ist der YWCA!« informierte der Fahrer sie und war sichtlich stolz, dass er es mit seinem Oldtimer geschafft hatte.
Das Gelände war eindrucksvoll. Hohe Bäume und eine Art Parkanlage prägten das Bild. Im Hintergrund lagen mehrere Gebäude, die zwar einen frischen Anstrich gebrauchen konnten, jedoch viel besser aussahen, als manche der Geschäfte und Wohnblöcke, die sie unterwegs gesehen hatten. Besonders schön fanden sie das Hauptgebäude, auf den ein nett gemachter Weg mit Blumenbegrenzung und gelb oder rosa blühenden Büschen zuführte. Dies war, wie sie sofort sahen, das Gästehaus.
Als sie ausstiegen, mussten sie sich erst einmal recken. Tobias warf einen Blick über die Schulter. Dort draußen fuhr eine Rikscha vorbei, so langsam, als habe sie kein Ziel. Die Insassen waren leider nicht zu erkennen. Wieder beschlich Tobias das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. Als er sich umdrehte und die Rikscha prüfend anschaute, beschleunigte sie plötzlich und verschwand im dichten Verkehr.
Ihr Fahrer drehte den Draht am Kofferraum auseinander, öffnete ihn und übergab ihnen ihre Rucksäcke. Sie wollten schon gehen, sahen jedoch, dass der Mann keine Anstalten machte, sich zurück in sein Taxi zu bewegen. Aha, ein Trinkgeld.
»Gib du ihm was! Ich habe das Taxi bezahlt.«
»Ich habe nur größere Scheine.«
Tobias kramte in seinem Brustbeutel.
»Der Kleinste ist ein Fünfziger.«
»Dann gib ihm den. Es sind doch nur 90 Cent!«
Der Fahrer sah extrem glücklich aus, bedankte sich mit mehreren Verbeugungen und qualmte davon.
»Tolles Auto!« meinte Max, als er seinen Rucksack aufnahm. »So eine Kiste müsste man sich neu kaufen und in Deutschland zulassen. Würde echt Aufsehen erregen.«
Sie betraten das im Kolonialstil gebaute Anwesen. Am Eingang standen Topfpflanzen verschiedener Art und Größe. Die Halle war groß und geräumig und auch sie war ganz im Kolonialstil gehalten: Rattanmöbel, Glastische, Raumteiler aus Edelholz mit Einlegearbeiten, nur schwach leuchtende Lampen.
Die Frau an der Rezeption lächelte sie freundlich an. Sie trug einen dunkelblauen Sari mit einem roten Endstück, dass sie sich wie einen Schal über den Kopf gelegt hatte.
»Sie haben reserviert?«
Die Schönheit sprach mit typisch indischem Akzent. Sie checkten ein und fanden die Prozedur ziemlich umständlich: Zwei Formulare ausfüllen, Pass abgeben, Kreditkarte vorlegen... Alles wurde in einen Computer eingegeben, alles registriert.
»Die wollen sogar den Namen und den Beruf des Vaters wissen!« bemerkte Tobias entsetzt.
»So ein Quatsch! Das müssen sich irgendwelche Beamte ausgedacht haben, die sonst nichts zu tun haben. Oder die ehemaligen Kolonialherren, die alles unter Kontrolle halten wollten!«
Die Frau rief einen jungen Mann, der wegen eines Anzuges mit Stehkragen sofort als Page zu erkennen war. Der schnappte sich beide Rucksäcke und bat die neuen Gäste mitzukommen. In einem klapprigen Aufzug fuhren sie in den ersten Stock. Der Junge führte sie in ihr Zimmer, stellte das Gepäck ab, öffnete den Vorhang, machte den Fernseher und die Klimaanlage an und stellte sich mit einer Miene, die mit der des Taxifahrers identisch war, an die Tür.
»No money«, sagte Max freundlich. Einen noch größeren Schein wollte er nun nicht verteilen. »Later, later!«
Der Junge machte zwar ein enttäuschtes Gesicht, zog jedoch ab.
Max ließ sich auf das Bett fallen.
»Indien, wir sind jetzt da!«
Er sah hundemüde aus.
»Na, dann fröhliche Weihnachten!«
Obwohl sie wegen der im Zimmer sehr laut hörbaren Straßengeräusche häufiger aufgewacht waren bekamen ihnen die drei Stunden Schlaf, die sie sich gönnten, sehr gut. Am Nachmittag verließen sie das Gästehaus, um ihre erste Exkursion ins Land ihrer Träume anzutreten. Tobias musste noch etwas auf Max warten und kam in der Lobby ins Gespräch mit einer jungen Frau. Sie kam aus Schweden und hatte in einem Kinderheim irgendwo im Süden ein Praktikum gemacht. Sie war eine hübsche Blondine und trug wie viele junge Mädchen in Indien einen roten Punjaby, also eine bequeme Hose mit einem bunten Kleid darüber.
»Das nächste Mal solltet ihr im neuen CVJM-Gästehaus übernachten«, empfahl sie.
»Dort ist es wesentlich ruhiger und total komfortabel. Nur weil ich hier das Essen besser finde, bin ich noch mal hierher gekommen.«
Tobias begriff schnell, wie es lief. Du kommst in ein fremdes Land. Du triffst Leute. Und du profitierst von deren Tipps. Sandra, so hieß die hübsche Schwedin, empfahl ihm, unbedingt die Stadt Kanchipuram zu besuchen. Die stehe zwar nicht so ganz obenan im Reiseführer, sei aber eine der bedeutsamsten heiligen Tempelstädte Indiens. Wer Interesse am Hinduismus habe, käme an dieser Stadt nicht vorbei. Und wenn sie nach Mamallapuram fuhren, empfahl Sandra weiter, sollten sie unterwegs an der Krokodilfarm Halt machen. Das lohnte sich! Tobias schrieb sich die Namen auf. Max kam die Treppe herunter geschlurft.
»Immer dieselben, die Glück bei den Frauen haben!« sagte er auf Deutsch. »Die Verheirateten! Wir Singles gehen leer aus.«
Sandra lachte und Max erschrak, als sie in passablem Deutsch antwortete:
»Er war eben zuerst da! Und wer zuerst kommt, flirtet zuerst!«
Sie tranken einen Kaffee zusammen und erzählten sich von ihren Eindrücken über dieses Land, den überaus frischen und denen der zwar viel jüngeren, aber in Indien erfahrenen Frau. Sandra bot ihnen an, sie bis in ein Kaufhaus zu begleiten, wo sie auch weiteres Geld tauschen könnten.
»Danach«, sie zuckte bedauernd die Schultern, »muss ich euch verlassen, denn ich bin mit einigen Frauen im Womens College verabredet. Ich empfehle euch, anschließend mit einem Auto an den Strand zu fahren. Das muss man einfach erlebt haben – gerade am Abend!«
»Auto? Was für ein Auto? Du meinst ein Taxi?«
Sandra lachte.
»Eine Motorrikscha meine ich! Die heißen hier ‚Auto’.«
Als sie die Lobby verlassen wollten, rief die Frau an der Rezeption sie zurück:
»Mr. Hoyer! Mr. Grunert! Hier ist eine Nachricht für Sie. Es war jemand für sie da, wollte Sie aber nicht in Ihrer Mittagspause stören.«
Verblüfft sahen Max und Tobias sich an.
Wer sollte sie hier besuchen? Sie kannten weder jemanden in diesem Land, noch wusste jemand, wo sie unterkommen würden. Die Frau reichte einen Umschlag herüber. Tobias öffnete ihn und las den englischen Text, der in feiner Schrift dort stand:
»Noch einmal herzlichen Dank für die guten Gespräche. Ich hoffe sehr, dass ihr die ersten Eindrücke meines Landes verkraftet und den Verkehr überstanden habt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns wieder sehen und ihr an meinen Fluss kommt. Bitte meldet euch doch von Hyderabad aus. Gruß, Rama Krishna Rao.«
Erstaunt und fragend sahen die beiden Freunde einander an.
»Also war es doch dieser Krishna!« meinte Tobias. »Ich wusste es doch! Hat mich mein Gefühl also nicht betrogen!«
»Ja, wahrscheinlich hattest du Recht. Aber warum ist er uns gefolgt?«
»Ist er vielleicht ja gar nicht. Ich glaube, die Straße etwas weiter hinunter liegt der Hauptbahnhof, die Central Station. Vielleicht ist er dorthin gefahren und nur zufällig hier vorbei gekommen.«
»Vielleicht.« Jetzt schien auch Max das Ganze merkwürdig zu finden. »Aber dann konnte er immer noch nicht wissen, dass wir ausgerechnet hier wohnen!«
Da Sandra bereits draußen wartete, gingen sie hinaus. Sie war inzwischen zur Pforte gegangen und hatte eine Autorikscha heran gewunken. Sie verhandelte mit dem Fahrer.
»Fünfzig!« sagte der energisch.
»Dreißig oder Taxameter!« forderte Sandra.
Als er nicht darauf eingehen wollte, tat sie, als wolle sie ein anderes Auto herbeirufen. Das wirkte.
»Okay, dreißig«, sagte der Fahrer und wies in die Kabine.
Sie quetschten sich auf den Rücksitz und nahmen Sandra in die Mitte.
»Die wollen erst mal viel mehr als üblich. Vor allem Ausländer werden leicht übers Ohr gehauen. Die Fahrer meinen, alle Weißen seien superreich und verlangen Fantasiepreise. Selbst mit dreißig Rupien ist dieser hier noch gut bedient. Bei Nutzung des Taxameters käme es günstiger, aber das ist dann tatsächlich knapp für die Fahrer, zumal wenn sie auch noch eine Familie zu ernähren haben.«
Der Fahrer hatte vor sich über dem Lenker außer der unentbehrlichen Hupe drei Aufkleber an die Scheibe geklebt. Max fragte Sandra, ob sie wisse, wer das sei – außer Jesus. Sie lachte.
»Das haben die meisten der Fahrer. Dieser hier ist mit Sicherheit Hindu. Der Mensch mit dem Elefantenkopf dort in der Mitte ist Ganesha. Er ist einer der Lieblingsgötter der Hindus, weil er klug und gleichzeitig stark und stur ist. Der Typ mit der erhobenen Hand auf der linken Seite ist Saibaba. Eigentlich war er ein heiliger Mann, ein Lehrer für Pilger. Die Leute haben aus ihm aber einen Gott gemacht. Das geht hier in Indien recht schnell. Na ja, und links, das seht ihr ja, das ist Jesus.«
Max und Tobias waren verwirrt. Sie kannten sich in religiösen Dingen nicht besonders aus, fanden es jedoch sehr merkwürdig, dass dieser Fahrer als Hindu auch Jesus verehrte. Sandra lachte und als ob sie Gedanken lesen konnte, sagte sie:
»Das sehen viele von ihnen ganz locker. Weihnachten betet man eben zu Jesus – und das hatten wir ja gerade. Zum Lichterfest Diwali kommen die Hindugottheiten dran und zwischendurch wird Saibaba verehrt. Ganz wie es passt. Jener Gott, der mir gerade Glück bringt, hat gewonnen.«
Sich jetzt weiter zu unterhalten, war schwierig. Um sie herum hupte, brummte und klapperte es. Es war Feierabendverkehr. Manchmal standen sie vor einer Ampel und kamen bei Grün dann nur wenige Meter voran. Der Fahrer nutzte zwar jede Lücke, trotzdem dauerte die Fahrt über vierzig Minuten. Der Qualm unzähliger Fahrzeuge raubte ihnen beinahe den Atem. Wie es jemand zu seinem Beruf machen konnte, hier herumzufahren, war Tobias ein Rätsel. Wahrscheinlich konnten sich die Leute das nicht aussuchen.
Ihm fiel auf, dass Max sich immer wieder umsah, so als ob er in dem Gewühle jemanden suchte.
»Er ist nicht mehr da, er hat uns diese Nachricht hinterlassen und ist in sein Märchenland verschwunden!«
Sandra schaute ihn etwas verständnislos an. Max grinste und nickte.
Die Schwedin brachte sie zu einem großen Einkaufkomplex namens Spencers Plaza.
»Hier könnt ihr Geld tauschen und wenn ihr wollt auch einkaufen. In den Andenkenläden solltet ihr unbedingt handeln. Sonst gibt es auch Festpreise. Der Laden hier ist zwar teuerer als der Pondibasar und andere typisch indischen Einkaufsstraßen – aber dafür kriegt ihr eine bessere Qualität und habt alles an einem Ort.«
Die Männer staunten über die Größe dieses Einkaufsparadieses. Auf vier Etagen in drei großen Gebäuden konnte man sich leicht verlaufen. Große Kaufhäuser und kleine Geschäfte, Supermärkte und Restaurants, Souvenirshops und kleine Servicebetriebe wechselten sich ab. Lederwaren, Klamotten, HighTech, Schmuck... nichts, was es hier nicht gab.
Sie beschlossen aber, sich nicht schon jetzt mit Andenken oder anderen Schnäppchen zu belasten. Sie hatten noch viel vor. Souvenirs, hatte Sandra ihnen erklärt, bekam man ohnehin günstiger im staatlichen Handarbeitsladen Victoria, der einige Meter weiter unten an der Mount Road lag. Auf jeden Fall sollten sie sich niemals von den Rikschafahrern überreden lassen eines der superteuren Geschäfte aufzusuchen, denen die Fahrer oft als Schlepper dienten.
Die beiden tauschten ihr Bargeld zu einem guten Kurs, bummelten etwas herum und genossen dann einen echten Cappuccino. Sie hatten sich mit Sandra verabredet, die zwischenzeitlich einige Einkäufe gemacht hatte. Da das Café ganz oben im Bereich der Restaurants lag, konnten sie es auch im Wirrwarr der Gänge und Stockwerke schnell finden.
»So etwas gibt es erst seit wenigen Jahren«, erklärte die Schwedin. »Bis Ende der Neunziger hatte Indien sich total abgeschottet. Jetzt findest du in den Großstädten sogar Mac Donalds.«
Wie verabredet, verließ Sandra sie kurz darauf.
»Du hast uns echt geholfen!« sagte Tobias. »Danke! So war das Ankommen hier ein wenig leichter!«
Sandra lachte.
»Wer immer in Indien ankommt, bekommt erst einmal einen Kulturschock. Aber keine Angst, der vergeht schnell und dann werdet ihr merken, in welch faszinierendem Land ihr seid.«
Sie verabschiedeten sich per Handschlag. Kurz darauf war ihr schwedischer Schutzengel in einem der gelben Dreiradtaxis verschwunden.
»Tja, wieder eine Chance vertan.«
Tobias wusste, dass Max es zwar mit einem Grinsen im Gesicht sagte, es jedoch wirklich bedauerte. Sein Freund war mit seinem Singledasein keineswegs glücklich und sehnte sich nach einer Partnerin.
»Schade«, sagte Tobias nur. »Aber wer weiß, was noch passiert! Komm, wir nehmen uns ein Taxi und ab zum Strand!«
Vor Spencers Plaza standen viele Autorikschas.
»Hast du schon gesehen«, meinte Max, »dass hinten ‚Piaggio’ drauf steht? Wahrscheinlich haben die Inder eine Lizenz gekauft und bauen sie selbst. Jedenfalls müssen sich die Italiener damit eine goldene Nase verdient haben.«
Tobias ging zu einem der gelben Autos und sprach einen älteren Mann in hellbrauner Uniform an, der wartend auf dem Fahrersitz saß und ihm freundlich entgegen lächelte.
So lernten sie ihn kennen, den glücklichsten Mann der Welt.
»Ich fahre euch, wohin ihr wollt!«
Dann reichte er beiden die Hand und stellte sich vor:
»Ich heiße Ramesh, willkommen in meinem Taxi!«
Er sprach englisch und war überaus freundlich.
»Hoffentlich bleibt der auch bei den Preisverhandlungen so sympathisch«, meinte Max auf Deutsch.
»Ihr zahlt, was ihr wollt!« sagte Ramesh, als habe er Max verstanden. »Ich mache keine festen Preise und ich verlange nichts. Was es euch wert ist, das gebt ihr!«
Zuerst vermuteten sie einen Verkaufstrick, was es sicher auch war, aber der hagere Mann mit den freundlichen Augen strahlte irgendwie Vertrauen aus. Also stiegen sie ein und ließen sich ans Meer fahren. Ramesh erzählte ihnen, dass er vor vielen Jahren aus Sri Lanka gekommen war und das Auto sein Eigen nannte. Er kam damit gut zurecht, zählte er doch wegen seiner Englischkenntnisse viele Ausländer zu seinen Kunden. Er hatte sich ein Mobiltelefon angeschafft, war seitdem besser zu erreichen und bekam folglich mehr Fahrten. So hatte er im Konkurrenzkampf unter den über hunderttausend Autorikschas eine halbwegs gute Chance. Tobias musste noch einmal nachfragen:
»Wie viele?«
»Allein in Chennai etwa hunderttausend. Die meisten davon sind in der Hand weniger Firmen, die die Fahrer gnadenlos ausbeuten und dabei steinreich werden. Das ist eine richtige Mafia. Wie gut, dass ich mein eigenes Auto habe und eine Zulassung ebenfalls!«
Ramesh lachte ständig, machte Witze über seine Kollegen, fragte nach der Familie seiner Kunden und fuhr mit bewundernswerter Ruhe durch den dicksten Verkehr. Seltsamerweise benutzte er dabei kaum die Hupe.
Sie kamen an einem riesigen Monument vorbei. Es hatte die Form einer Lotusblüte.
»Das ist unserem verstorbenen Chiefminister geweiht«, sagte Ramesh. »Der hat viel für das Land getan, also haben sie eine Pilgerstätte daraus gemacht.«
Man sah Männer und Frauen, die sich die Schuhe auszogen, andächtig zur Mitte der Gedenkstätte gingen und dort im Gebet verharrten.
»Erstaunlich, dass sie einen ehemaligen Staatschef anbeten wie ihre Götter.« Max konnte nicht begreifen, wieso Politiker dermaßen verehrt wurden.
»Allerdings sterben manche von ihnen auch früh. Nehmt nur Rajiv Gandhi oder auch einige der Landeschefs. Wenn man den Zeitungen glaubt, bekommt man das Gefühl, bei uns in Indien gäbe es mehr Terroristen als Taxifahrer!« Ramesh lachte über seinen eigenen Witz.
»Da geht es mir schon besser. Mich will niemand ermorden. Also, zum Glück bin ich nicht Staatschef, sondern Taxifahrer geworden!«
Am Strand stellte Ramesh sein Dreirad ab. Nachdem seine Fahrgäste ausgestiegen waren, setzte er sich selbst hinein.
»Ich warte auf euch! No problem!«
Der Parkplatz war voller Autos. Auch Busse standen dort. Die Beiden gingen zum Strand. Es war bereits dunkel. Das Meer sah man nicht.
»Hier muss irgendeine Großveranstaltung sein!«
Tobias irrte sich. Hier war nichts als normaler Strandbetrieb, allerdings auf indisch. Hunderte von Buden bildeten eine Gasse vom Parkplatz über den Strand bis ans Wasser. Fliegende Händler verkauften Muscheln, Cooldrinks, Mineralwasser, Fisch, Plastikspielzeug, Götterbilder und jeden Kitsch, den man sich denken konnte. Am Strand entlang ritten junge Männer auf mageren, jedoch erstaunlich dynamischen Pferden und boten Touristen an, einen Ritt zu wagen. Gegen Geld natürlich. Einige besonders pfiffige Geschäftemacher gruben Kuhlen in den Sand, bis Grundwasser kam. Dies schöpften sie ab und verkauften es für wenige Paisa an durstige Kundschaft. Es waren am Strand sogar kleine Karussells aufgebaut, die per Hand gedreht wurden. Kinder amüsierten sich zur Freude ihrer Eltern.
Staunend marschierten die Deutschen durch den losen Sand. Inzwischen war es dunkel geworden. Am Ufer ging es recht steil hinunter. Die Wellen rollten heran. Die Kämme leuchteten im Mondlicht und wurden von den Lichtern der Buden angestrahlt. Allerdings leuchteten sie nicht weiß, sondern schienen grau oder gar schwarz eingefärbt.
»Das stinkt ja wie eine Güllegrube!« Max rümpfte die Nase. »Da wird irgendwo ganz kräftig die Umwelt verschmutzt!«
Den indischen Strandliebhabern schien das nichts auszumachen. Baden tat hier ohnehin niemand. Man vergnügte sich auch so. Mädchen standen in Gruppen mit den Füßen im Wasser und kreischten, wenn die heranrollenden Wellen ihre flatternden Kleider durchnässten. Kinder plantschten in den auslaufenden Schaumkronen, ängstlich bewacht von ihren Eltern. Junge Männer schäkerten mit Mädels herum, als wäre es ihre eigene und nicht Sache ihrer Eltern, sich eine Braut zu suchen.
»Na, hier ist ja echt was los!« strahlte Max. »Aber komm, so ganz ist das nicht meine Vorstellung von erholsamem Strandleben.«
Sie beschlossen, nicht über die beleuchtete Gasse, sondern weiter südlich quer über den Strand zurück zu gehen. Dabei wurde ihnen allerdings mulmig zumute. Es gab hier draußen außer dem blassen Licht des Mondes keine Beleuchtung. Dunkle Gestalten hockten neben Fischerkähnen, die am Ufer lagen. Weiter hinten flackerten Feuer am Strand. Hunde streiften über den hier überaus schmuddeligen Sand auf der Suche nach Fressbarem. Zweimal lieferten sie sich unter lautem Geheul böse Schlachten, jagten dabei in großem Tempo über die freie Fläche und ließen sich von den beiden Zweibeinern keineswegs beeindrucken. Eines der Tiere, ein magerer, schwarzer Rüde, blieb stehen und fletschte die Zähne. Kurz darauf wäre Max fast über einen Mann gefallen, der in einer Senke seine Notdurft verrichtete. Hinter einigen der auf den Strand gezogenen Boote meinten sie, sich bewegende Gestalten zu sehen und einmal kam tatsächlich eine Gruppe Männer schweigend auf sie zu. Einige von ihnen sogen an kurzen Zigarren und die aufflammende Glut ließ ihre Gesichter gespenstig aufleuchten.
»Lass uns hier bloß schnell verschwinden!« sagte Tobias und ging so schnell, dass Max kaum noch mitkam. »Bevor wir Ärger kriegen, sie uns überfallen oder entführen!«
Max ließ sich das nicht zweimal sagen. Zwar war er den indischen Leichtgewichten vermutlich körperlich überlegen, doch darauf ankommen lassen wollte er es lieber nicht. Also gingen sie schnellen Schrittes den Lichtern der Straße entgegen.
Endlich kamen sie beim Parkplatz an. Und tatsächlich, Ramesh war noch da. Er wartete.
»Ehrlich gesagt, da hab’ ich eben wirklich Schiss gehabt.«
Mit Blick auf Ramesh ergänzte Max: »Aber wenn man diese dunklen Gestalten dann persönlich kennt, wirken sie gar nicht mehr so bedrohlich.«
Etwas später, als sie sich an einem Teestand noch eines der heißen Getränke gönnten und ihm eines spendierten, behauptete Ramesh, er sei der glücklichste Mann der Welt!
»Glücklicher als Bill Gates!« fügte er hinzu.
»Wieso denn das?«
»Weil ich frei bin! Was hat schon Bill Gates vom Leben! Trotz seines vielen Geldes – kann er sich einfach an den Strand setzen und in seinem Auto schlafen? Kann er sich zwischendrin ein Mützchen Schlaf gönnen? Oder entscheiden, dass er heute mal blau macht? Ich glaube nicht. Überall Sicherheitspersonal, immer Angst vor Entführern oder Räubern, auf Schritt und Tritt von Medien und Neidern beobachtet, niemals frei!«
Ramesh beeindruckte die beiden. Sie gaben ihm, als er sie direkt vor dem Gästehaus absetzte, zweihundert Rupien und er ihnen seine Telefonnummer.
Als Max und Tobias an diesem Abend ins Bett gingen, hatten sie kaum noch Kraft, von der hübschen Sandra zu schwärmen und Max fiel nicht einmal mehr eine spitzfindige, sarkastische oder ironische Bemerkung über den Strandspaziergang ein. Bevor er einschlief, dachte Tobias an Rama Krishna Rao, jenen undurchsichtigen Fremden vom Flughafen. Wo mochte dieser Krishna wohl geblieben sein? Warum war er hinter ihnen hergefahren? Warum hatte er erkundet, wo sie wohnten? Ging es wirklich nur darum, sie einzuladen, einen Abstecher an die Godavari zu machen? Tobias kam sich unfair vor, weil er sogar am Strand an Krishna gedacht hatte. Er schien schon unter Verfolgungswahn zu leiden.
Irgendwann schlief er ein. Als er mitten in der Nacht noch einmal aufwachte, hörte er Max schnarchen. Er stieß seinen Freund an. Max murmelte etwas wie: »Schnell weiter! Nur nicht anhalten!«
27. Dezember: Krishnas Butterball
Noch vor dem Frühstück versuchte Tobias, dem Boy im Gästehaus beizubringen, wie eine saubere Toilette auszusehen hatte. Er zeigte ihm die Toilette, nahm einen Lappen, wischte, kratzte, erklärte, spülte... und merkte nicht, dass der Boy zwar freundlich nickte, aber kein Wort und keine Geste wirklich verstand. Max stand in der Tür zum Bad und grinste.
»Tobias, wir werden Indien durch unseren Besuch nicht ändern!«
Diesmal klang er etwas belehrend und sein Freund reagierte entsprechend.
»Aber ich werde mich wegen Indien auch nicht ändern! Mein Klo muss sauber sein!«
»Meinst du wirklich, wir kommen hierher und werden nicht verändert? Du siehst diese Menschenmassen, die überquellenden Städte, die Kontraste, das Chaos – und gehst davon völlig unberührt nach Hause? Kann ich mir nicht vorstellen!«
»Wir werden ja sehen.«
Der Skeptiker Tobias wollte sich alle Optionen offen lassen.
Chennai war eine moderne Stadt, ohne Zweifel. Hier pulsierte das Leben. Shopping, Kultur, Musik, Industrie – Stadtmenschen mussten sich hier einfach wohl fühlen. Doch obwohl sie aus Hamburg kamen, zog es die beiden Abenteurer aufs Land.
»Ich will sehen, wie Indien wirklich ist«, sagte Max beim Frühstück und würzte sein Omelette noch mit einer Prise Salz nach, obwohl es doch bereits chilischarf war.
»Angeblich leben trotz der gigantischen Millionenstädte 80 Prozent der Menschen auf dem Land. Und das will ich sehen! Hier in Chennai können wir uns am Schluss unserer Reise noch etwas umsehen und dann auch Souvenirs kaufen und Shoppen gehen.«
Tobias war einverstanden. Ihm ging das Gehupe und Gedränge schon nach dem ersten Tag auf die Nerven.
Sie nahmen sich einen Mietwagen mit Fahrer. Diese Art des Reisens erschien ihnen angemessen, wollten sie doch frei und beweglich bleiben. Die Tagesmiete für den fast neuen Ford Fiesta mit Klimaanlage war nicht höher als der Stundenlohn eines Informatikers wie Max. Tobias wollte seinem Freund vorrechnen, wie sich dessen Gehalt ausmachte, wenn man es mit dem Einkommen von Ramesh verglich. Max lehnte dankend ab.
»Du willst mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Wahrscheinlich wird mir schwindelig, wenn ich ausrechne, wie lange Ramesh seine Kunden für meinen Tagesverdienst durch den Smog kutschieren müsste.«
Sandra hatte ihnen den Wagen schon gestern über eine Agentur vermittelt und ihnen außerdem einige gute Tipps für eine Rundfahrt gegeben.
»Wenn ihr euch nur zwei Tage für diese Gegend Zeit nehmt, dann solltet ihr euch nicht zu viel vornehmen. Zuerst fahrt ihr am besten zur Central Station und besorgt euch Zugfahrkarten für Hyderabad. Direkt vor Abfahrt des Zuges kriegt ihr keine Tickets mehr. Die müsst ihr immer vorbuchen. Danach...«
Dann hatte sie einen Vorschlag für die Tour gemacht und die beiden Männer wollten es genauso machen.
Der Fahrer des Mietwagens war ein älterer Herr fast ohne Haare. Er strahlte Gelassenheit und Ruhe aus, was den beiden gut tat. Leider sprach er kein Englisch. Sein Name erschien ihnen unaussprechbar. Also nannten sie ihn einfach »Driver“. Zum Glück fuhr er genauso beruhigend wie er aussah. Beim Fahrstil der anderen Verkehrsteilnehmer erschien dies fast wie ein Wunder – aber sie kamen mit »Driver“ sicher und sogar relativ flott durch den dicksten Verkehr dorthin, wo sie wollten.
Das mit den Tickets klappte gut. Dieser Bahnhof, eindrücklich im viktorianischen Stil und in rotem Klinker offensichtlich noch von den Engländern erbaut, hatte es in sich! Max freute sich schon auf die Abreise mit dem Zug. Dann hatten sie mehr Zeit, sich dieses Treiben anzusehen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren immens. Hunderte Polizisten in hellbraunen Uniformen standen herum, teilweise mit Pistolen und Gewehren bewaffnet. Auch Frauen waren darunter. Kontrollschleusen wie am Flughafen verbreiteten ein Gefühl der Sicherheit. Trotzdem war es wahrscheinlich ohne Probleme möglich, eine Kofferbombe irgendwo abzustellen. Die Wirkung wäre entsetzlich. Tausende liefen, standen, lagen oder saßen in den Hallen herum. Bei aller Faszination des bunten Treibens beschlich die beiden Europäer ein ungutes Gefühl. Wenn hier passiert, was in Bombay geschah...
Als Ausländer wurden sie freundlich aber bestimmt in den ersten Stock geleitet, wo es einen speziellen Fahrkartenschalter für sie gab. Alles klappte reibungslos und bald hatten sie ihr Ticket von Chennai nach Hyderabad in der Tasche. Bereits nach einer Stunde konnte sich Driver mit seinem Ford wieder auf den Weg machen.
Eine weitere Stunde später hielten sie irgendwo auf freier Strecke. In großen Lettern stand auf dem Schild vor dem Eingang eines durch Mauer und Zaun abgegrenzten Areals: »Crocodile–Park«. Vor dem Eingang parkten zwei Touristenbusse und mehrere PKW’s.
»Ob sich das wirklich lohnt?«
Max war skeptisch. Ein paar Krokodile – was sollte es da schon zu sehen geben? Für wenige Rupien erhielten sie eine Eintrittskarte. Eine Erlaubnis, Fotos zu machen, kostete extra. Soviel hatten die beiden schon von Indien begriffen: Hier machte man Geld, wo immer es ging. Aber das war letztlich in Deutschland nicht anders. In der Hoffnung, auch entsprechende Motive zu erhalten, investierte Tobias die wenigen Rupien in eine Fotoerlaubnis.
Am ersten Gehege des Rundweges hatte er den Eindruck, sein Geld für Nichts ausgegeben zu haben. War dort überhaupt etwas zu sehen? Doch, dort bewegte sich etwas im schlammigen Tümpel. Plötzlich hob sich eine lange Schnauze mit einem Gnubbel am Ende aus dem Wasser.
»Äh, dieses Biest hätte ich gar nicht gesehen. Baden gegangen wäre ich in dieser Brühe allerdings sowieso nicht.«
Ein riesiges Gehege auf der anderen Seite war möglicherweise überbevölkert. Zuerst sahen sie aus wie in Beton gegossen. Reglos lagen sie in der Sonne, grau mit weißen Zähnen, übereinander, nebeneinander, kreuz und quer, alle etwa anderthalb Meter lang. Salzwasserkrokodile. Plötzlich schnappte ein vermeintliches Betonmaul nach dem Bein eines Nachbarn. Andere schnappten zurück. Schnelle Bewegungen, die die Besucher kaum mit den Augen verfolgen konnten. Tumult, Unruhe.
Ein Tierpfleger näherte sich mit einem Eimer. Die Tiere mussten einen ausgesprochen sensiblen Geruchssinn besitzen. Hunderte Schläfer wurden plötzlich zu Fressmaschinen. Als der Mann einige Fleisch- und Knochenstücke ins Gehege warf, schnappten die schnellsten und stärksten der Echsen sie bereits aus der Luft weg. Sie schossen, angetrieben von ihren starken Schwanzmuskeln, nach oben und klatschten dann bereits kauend wieder auf die Tiere unter ihnen. Die zwischen starken Kiefern zermalmten Knochen knackten. Wie alle anderen Besucher, denen diese Fütterung vorgeführt wurde, hielten auch Max und Tobias respektvoll Abstand.
Soviel brutale Urinstinkte konnten selbst Max beeindrucken.
»Wie hat der Crocodile-Dundee das bloß gemacht? Rennt zu Fuß über eine ganze Krokodilflotte und erreicht lebend das andere Ufer!? Unmöglich!«
Erst recht beim stattlichsten Vertreter dieser Krokodilart, der halb an Land, halb im Wasser eines großen Geheges vor sich hindöste. Dieses Salzwasserkrokodil sollte einem Fischerboot zwischen Sri Lanka und Indien in die Netze gegangen sein.
»Erstaunlich, dass der Kahn nicht mit Mann, Maus und Krokodil gesunken ist«, meinte Max und schüttelte den Kopf. Der Koloss war 12 Meter lang. In Worten: Zwölf Meter!
Und doch war dieses Untier noch nicht die Krönung des Rundganges. Vor allen Gehegen standen Schautafeln und Erklärungen. Jetzt wies Tobias auf eine von ihnen. Sie informierte über vier oder fünf nette kleine Krokodile, die nur so zwei bis drei Meter lang wurden.
»Schau mal, die leben in der Godavari.«
»Hey, das ist doch Krishnas Fluss! Der scheint uns ja tatsächlich zu verfolgen. Nun sogar in Krokodilgestalt!«
»Na«, lachte Tobias, »fressen wird er uns ja wohl nicht! Und wenn doch, ist er satt, nachdem er dich verspeist hat. Ich habe da nichts mehr zu befürchten!«
Max schoss noch ein paar Fotos. Als sie den Park verließen, hatte er so viele unzähmbare Monster digitalisiert wie weder vor- noch nachher in seinem Leben.
Ihr Hotel hieß ‚Mamallaram Ressort’. Sie hatten die Straße, die parallel zum Meer auf den höher gelegenen Sanddünen verlief, Richtung Meer verlassen und dort eingecheckt. Ihr Zimmer war schlicht, aber sauber. Und das Beste: Durch einen lichten Pinienwald hindurch hatte man einen direkten Blick aufs blaue Meer.
»Vielleicht haben wir hier doch viel zu wenig Zeit eingeplant!« meinte Max selbstkritisch, als sie auf der Terrasse des Restaurants saßen, einen süßen Masala-Tee tranken und aufs Meer blickten.
»Wir haben ja später noch Zeit. Am Schluss der Reise können wir die Besichtigung Chennais ja abkürzen und hier noch zwei Tage ausruhen. Jetzt aber ist mir noch nicht nach Ausruhen zumute. Für einen Strandurlaub müssten wir nicht nach Indien reisen!«
Mit dem Mietwagen waren sie flexibel und nicht auf Busse oder Motorrikschas angewiesen. Nach einem Tee, den sie auf der Terrasse mit Meerblick genossen, ließen sie sich in den Ort fahren, direkt zum Prunkstück Mamallapuram, seinen aus Granitfelsen geschlagenen Tempelanlagen.
»Ist ja irre! Hier haben die Architekten aus dem ersten Jahrhundert wirklich Einmaliges geschaffen und ich verstehe, dass es zum Weltkulturerbe erklärt wurde!«
Max war begeistert, als sie auf dem eingezäunten Gelände ihre Runde machten. Für Tobias war das umso erstaunlicher, da sein immer der Gegenwart zugewandter Freund doch von Kirchen und Tempeln nicht besonders viel hielt. Diese hier waren allerdings wirklich etwas Herausragendes. Ihre Erbauer hatten die Tempel samt den dazugehörigen Figuren aus riesigen Felsen herausgeschlagen. Elefanten, Stiere und Affen, Götterfiguren von Shiva, Vishnu und anmutigen Göttinnen, sie alle waren kunstvoll und manchmal in Lebensgröße in Granit geschlagen und bis heute hervorragend erhalten.
»Irre, guck mal, die haben alle ein anderes Dach und auch die Säulen und der Aufbau sind verschieden. Da haben die wohl erst einmal ausprobiert, welches Design der Hinduismus bekommen soll.«
Tatsächlich hatten sie es hier mit Modellen für Tempelbauten zu tun. Ein Meisterwerk der Architektur!
Sehr interessant fand Tobias den Fußweg, der von den Modellen in Richtung Stadt führte. Sie kamen an unzähligen kleinen Werkstätten vorbei, wo Steinmetze ihre Produkte herstellten. Überall wurde vor den Augen der Touristen gehämmert, gesägt und gefeilt – und natürlich auch gefeilscht. Götterfiguren aller Art, aber auch Gefäße, Tiere und abstrakte Skulpturen wurden hier gefertigt. Sie sahen überdimensionale Figuren, die einer ägyptischen Pyramide würdig gewesen wären, aber auch winzig kleine Kunstwerke, wo der Stein filigran bearbeitet war und innerhalb eines Körpers noch zwei oder gar drei andere kleinere Figuren herausgearbeitet waren.
»Hey, schau dir das mal an!«
Tobias hielt einen schwarzen Ganesha hoch. Der saß vor einem Apple-Computer und bediente mit dem noch intakten Stoßzahn die Tastatur.
»Da soll mir einer sagen, die Religion dieser Leute sei rückwärtsgewandt.«