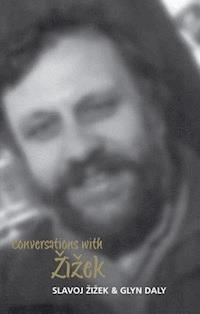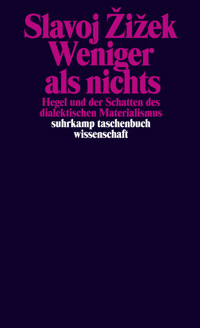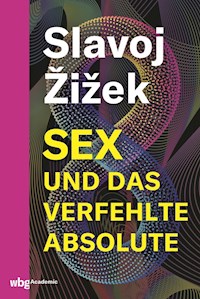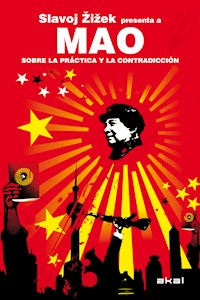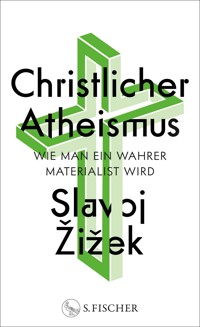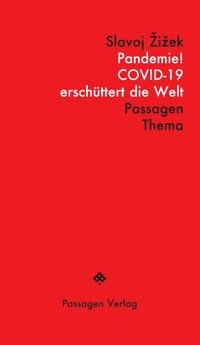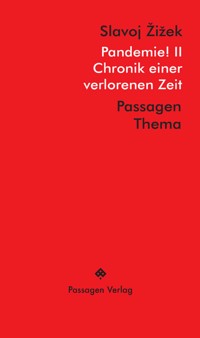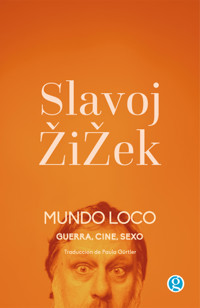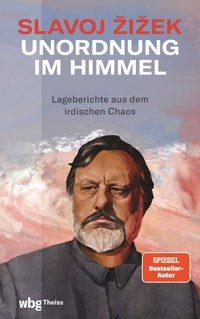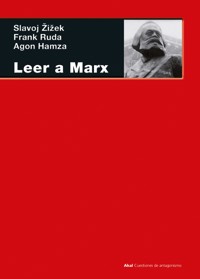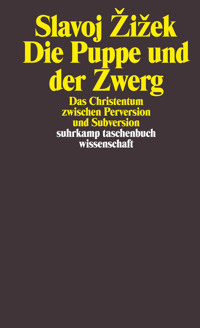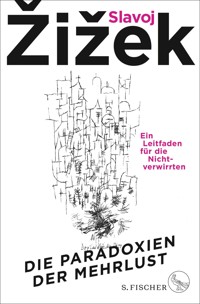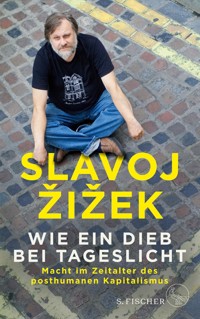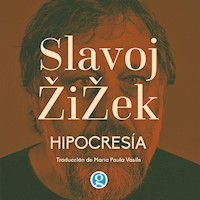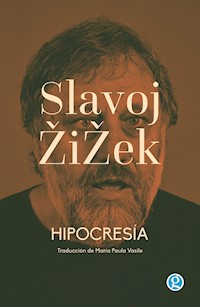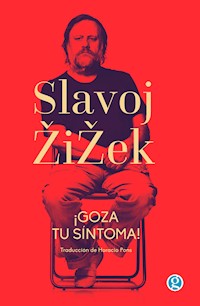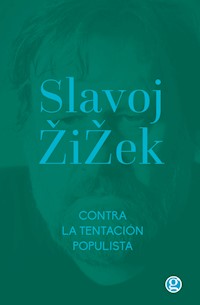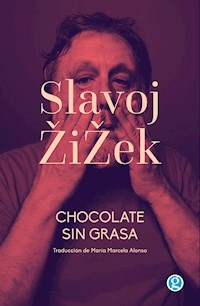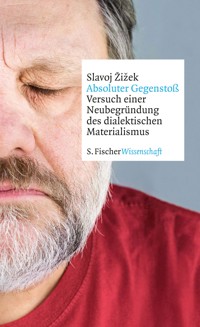
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der bekannte Philosoph und Kulturkritiker Slavoj Žižek schließt mit seinem neuen Buch ›Absoluter Gegenstoß. Versuch einer Neubegründung des dialektischen Materialismus‹ an seine umfangreiche Hegel-Neudeutung ›Weniger als Nichts‹ aus dem Jahr 2014 an. Ausgehend von Hegel unternimmt er nichts weniger als eine Neubestimmung des philosophischen Materialismus: In drei Teilen entfaltet er sein Vorhaben, Hegels Begriff des absoluten Gegenstoßes zu einem allgemeinen ontologischen Prinzip zu erheben. Ausgehend von einer kritischen Lektüre Badious und Althussers über eine Auseinandersetzung mit dem Hegel'schen Absoluten skizziert Žižek die Grundzüge einer Ontologie des »den«, des »Weniger-als-nichts«, um eine neue Grundlegung des dialektischen Materialismus zu formulieren. Ein so aufregender wie zentraler Beitrag zur zeitgenössischen Philosophie, mit Witz und Verve vorgetragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Slavoj Žižek
Absoluter Gegenstoß
Versuch einer Neubegründung des dialektischen Materialismus
Über dieses Buch
Dem philosophischen Materialismus in all seinen Formen ist es bislang nicht gelungen, die zentralen theoretischen und politischen Herausforderungen der modernen Welt in sein Gedankengebäude einzupassen. Das will Slavoj Žižek in seinem neuen Buch ändern: In drei Teilen entfaltet er sein Vorhaben, Hegels Begriff des absoluten Gegenstoßes zu einem allgemeinen ontologischen Prinzip zu erheben. Ausgehend von einer kritischen Lektüre Badious und Althussers über eine Auseinandersetzung mit dem Hegel’schen Absoluten skizziert Žižek die Grundzüge einer Ontologie des »den«, des »Weniger-als-nichts«, um eine neue Grundlegung des dialektischen Materialismus zu formulieren. Ein so aufregender wie zentraler Beitrag zur zeitgenössischen Philosophie, mit Witz und Verve vorgetragen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Slavoj Žižek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt Philosophie an der Universität von Ljubljana in Slowenien und an der European Graduate School in Saas-Fee und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen ›Was ist ein Ereignis?‹ (2014) und ›Das Jahr der gefährlichen Träume‹ (2013).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Für Jela, unter Wiederholungszwang
Einleitung: »Da ist allerdings Sand im Getriebe«
Materialismus, alt und neu
Gegen einen deflationierten Hegel
Die Ungleichheit
Dialektische Historizität
Teil I Jenseits des Transzendentalen
Kapitel 1 Versuch einer materialistischen Theorie der Subjektivität
Kant avec Althusser
Die erzwungene Wahl der Freiheit
Das antizipatorische Subjekt
Kapitel 2 Von Kant zu Hegel
Die ontische Frage
Der hegelianische Weg
Der gerahmte Rahmen
Kapitel 3 Die Wunde
Das Steckenbleiben
Der Sündenfall
Der antikoloniale Gegenstoß
Die Gewalt des Anfangs
Der absolute Gegenstoß
Zwischenspiel I Die Inszenierung der weiblichen Hysterie
Die Kunst und das Unbewusste
Die Sackgassen der Atonalität
Der »Traumgedanke« von Erwartung
Teil II Das hegelianische Ereignis
Kapitel 4 Ereignis-Wahrheit, Ereignis-Sex
Die drei Ereignisse der Philosophie
»La vérité surgit de la méprise«
Der Kreislauf des Werdens
Das Unbehagen in der Sexualität
Kapitel 5 Sein, Nichtwissen, absolutes Wissen
Wissen, Tod, Unwissenheit, Opfer
Quantenwissen
Ist das absolute Wissen Hegels Docta ignorantia?
Kapitel 6 Gottes gespaltene Identität
Götter des Realen
Das Band des Wortes
Die Historisierung Gottes
Gott im Kampf mit sich selbst
Der Prothesengott
Zwischenspiel II Lubitsch, Poet der zynischen Weisheit?
Drei Weiße und zwei Schwarze
Die Lehre aus einem Golfspiel am See Genezareth
Der Fall – noch einmal
Weshalb wir eine Puppe heiraten sollten
Wo genau steckt eigentlich der Ärger im Paradies?
Zynische Weisheit
Teil III Hegel jenseits von Hegel
Kapitel 7 Spielarten der »Negation der Negation«
Der Selbstmord als Akt der Annahme des Unmöglich-Realen der Freiheit
Die zwei Schmetterlinge
Zwischen den zwei Unmöglichkeiten
Die »Synthese nach unten«
Gegen das »Hölderlin-Paradigma«
Kapitel 8 »Es gibt eine Nicht-Beziehung«
Zwei Filme über Subjektivität
Die Notwendigkeit eines Schornsteinfegers
Begehren, Trieb, Deleuze, Lacan
Das Absolute
Kapitel 9 Von hier zum den
Zwischen den und Clinamen
Das den und das Eine
Von ISR zu a, S(A),
Sinthom, objet a,
Für Jela, unter Wiederholungszwang
Einleitung: »Da ist allerdings Sand im Getriebe«
Im fünften Kapitel seines Werks Materialismus und Empiriokritizismus beruft sich Lenin auf Engels’ Behauptung, der Materialismus müsse mit jeder neuen wissenschaftlichen Entdeckung seine Form verändern, und wendet das Argument auf Engels selbst an:
»Engels sagt ausdrücklich: ›Mit jeder epochemachenden Entdeckung schon auf naturwissenschaftlichem Gebiet‹ (geschweige denn auf dem der Geschichte der Menschheit) ›muß er‹ (der Materialismus) ›seine Form ändern.‹ […] Eine Revision der ›Form‹ des Engelsschen Materialismus, eine Revision seiner naturphilosophischen Sätze enthält folglich nicht nur nichts ›Revisionistisches‹ im landläufigen Sinne des Wortes, sondern ist im Gegenteil eine unumgängliche Forderung des Marxismus.«[1]
Heute sollten wir diesen Grundsatz entsprechend auch auf Lenin anwenden: Seine Abhandlung Materialismus und Empiriokritizismus wurde eindeutig nicht der Aufgabe gerecht, den philosophischen Materialismus auf die Stufe der Relativitätstheorie und der Quantenphysik zu heben, und sie hilft uns auch nicht, andere Durchbrüche, wie die Freud’sche Psychoanalyse, zu begreifen, ganz zu schweigen von den Fehlschlägen des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Dieser Aufgabe versucht sich das vorliegende Buch zu widmen, indem es eine Neubegründung des dialektischen Materialismus vorschlägt. Das Wort »dialektisch« ist hier im Sinne des griechischen dialektika (ähnlich wie semeiotika oder politika) zu verstehen: nicht als allgemeiner Begriff, sondern als »dialektische (semiotische, politische) Angelegenheiten«, als ein inkonsistentes (nichtganzes) Gemisch. Aus diesem Grund sind die einzelnen Kapitel dieses Buches Anwendungen – keine Erläuterungen – des dialektischen Materialismus; dieser ist nicht das Thema des Buches, er wird vielmehr darin praktiziert. Der Titel Absoluter Gegenstoß bezieht sich auf einen Ausdruck, den Hegel nur an einer einzigen, wenn auch entscheidenden Stelle über die Logik der Reflexion verwendet, um die spekulative Identität der Gegensätze in der Bewegung zu bezeichnen, durch die ein Ding aus seinem eigenen Verlust hervorgeht. Die prägnanteste poetische Formulierung des absoluten Gegenstoßes findet sich (kaum überraschend) bei Shakespeare, und zwar in seinem unheimlichen Drama Troilus und Cressida (5. Aufzug, 2. Szene):
»O Wahnsinn der Gedanken,
Der Gründe aufstellt für und gegen sich,
Durch schnöde Anmaßung! Wo sich Vernunft
Empört und nicht vernichtet, wo Verlust
Alle Vernunft mit fortreißt ohn’ Empörung«.[2]
Im Stück beziehen sich diese Zeilen auf Troilus’ selbstwidersprüchliche Argumentation, als er von Cressidas Untreue erfährt: Er bringt abwechselnd Gründe für und gegen das vor, was er zu beweisen versucht; seine Beweisführung durchkreuzt seine eigene Argumentationslinie, aber offenbar ohne sich selbst zunichtezumachen; und seine Unvernunft gewinnt den Anschein von Vernunft, ohne dass es widersprüchlich erscheint. Eine Ursache, die gegen sich selbst vorgeht, ein Grund, der mit der Empörung (über sich selbst) zusammenfällt … Die Zeilen beziehen sich zwar auf die weibliche Widersprüchlichkeit, sie können aber auch als Kommentar zur heimlichen Allianz zwischen der Würde des Gesetzes und dessen obszöner Übertretung verstanden werden. Denken wir an Shakespeares gängige Vorgehensweise, in den Königsdramen die »großen«, würdevoll inszenierten Königsszenen mit Auftritten einfacher Leute zu ergänzen und dadurch dem Ganzen eine komische Perspektive zu verleihen. In diesen Dramen machen die lustigen Zwischenspiele die edlen Szenen durch den Kontrast stärker; in Troilus und Cressida wird jedoch jeder, selbst der edelste Krieger, vom Aspekt des Lächerlichen »kontaminiert«, so dass wir jeden der Charaktere als entweder blind und jämmerlich oder skrupellos und intrigant ansehen können.
Die »operative Kraft« hinter dieser »Enttragödisierung«, der eine Akteur, dessen Eingreifen das tragische Pathos unterminiert, ist Ulysses. Das mag angesichts seiner ersten Intervention beim Kriegsrat im ersten Aufzug überraschend klingen: Die griechischen (beziehungsweise »Grecian«, wie es bei Shakespeare, den Sprachstil von George W. Bush vorwegnehmend, heißt) Heerführer versuchen dort zu erklären, warum es ihnen nach siebenjähriger Belagerung noch immer nicht gelungen ist, Troja zu besiegen und zu zerstören; Ulysses tritt dabei als klassischer Vertreter der »alten Werte« auf und sieht den Grund für das Scheitern der Griechen in deren Vernachlässigung der zentralisierten hierarchischen Ordnung, in der jeder Einzelne seinen festen Platz hat. Woher rührt also jener Zerfall, der den grauenvollen demokratischen Zustand der Beteiligung aller an der Macht herbeiführt? An einer späteren Stelle des Stücks (3. Aufzug, 3. Szene) versucht Ulysses Achilles zu überzeugen, sich wieder an der Schlacht zu beteiligen, und bedient sich der Metapher der Zeit als einer zerstörerischen Kraft, die schrittweise die natürliche Ordnung unterminiert: Im Laufe der Jahre würden seine Heldentaten schnell vergessen, der eigene Ruhm verblasse angesichts der neuen Helden – wenn er also weiter als strahlender Kriegsheld dastehen wolle, müsse er wieder in die Schlacht ziehen:
»Die Zeit trägt einen Ranzen auf dem Rücken,
Worin sie Brocken wirft für das Vergessen,
Dies große Scheusal von Undankbarkeit.
Die Krumen sind vergangne Großtat, aufgezehrt
So schleunig als vollbracht, so bald vergessen
Als ausgeführt. Beharrlichkeit, mein Fürst,
Hält Ehr’ im Glanz; was man getan hat, hängt
Ganz aus der Mode, wie ein rost’ger Harnisch,
Als armes Monument, dem Spott verfallen. […]
Nie hoffe Wert für das, was war, den Lohn;
Denn Schönheit, Witz,
Geburt, Verdienst im Kriege, Kraft der Sehnen,
Geist, Freundschaft, Wohltat, alle sind sie Knechte
Der neidischen, verleumdungssücht’gen Zeit.«[3]
Ulysses’ Strategie ist zutiefst ambivalent. Auf den ersten Blick wiederholt er nur sein Argument über die Notwendigkeit der »Abstufung« (der geordneten gesellschaftlichen Hierarchie) und stellt die Zeit als eine zersetzende Kraft dar, die die alten Werte untergräbt – ein erzkonservatives Motiv. Bei genauerer Lektüre wird jedoch deutlich, dass er seinem Argument eine einzigartige zynische Wendung verleiht; denn wie soll man die Zeit bekämpfen und die alten Werte am Leben erhalten? Nicht dadurch, dass man einfach an ihnen festhält, sondern indem man sie durch die obszöne Realpolitik[1] grausamer Manipulation, durch Betrug, durch das Ausspielen eines Helden gegen einen anderen ergänzt. Nur diese schmutzige Unterseite, diese versteckte Disharmonie kann die Harmonie aufrechterhalten. Ulysses spielt mit Achilles’ Neid – also genau mit dem Gefühl, das für die Destabilisierung der hierarchischen Ordnung verantwortlich ist, da es anzeigt, dass jemand mit seiner untergeordneten Stellung innerhalb des Sozialkörpers unzufrieden ist. Dieses heimliche Spiel mit dem Neid – unter Verletzung genau der Regeln und Werte, die Ulysses in seiner ersten Rede feiert – ist notwendig, um den Wirkungen der Zeit entgegenzusteuern und die hierarchische Ordnung der »Abstufung« aufrechtzuerhalten. Dies wäre somit Ulysses’ Version der berühmten Worte Hamlets: »Die Zeit ist aus den Fugen: Schmach und Gram / Daß ich zur Welt, sie einzurichten, kam!«[4] – die einzige Möglichkeit, »sie einzurichten«, liegt darin, der Übertretung der alten Ordnung mit deren inhärenter Transgression entgegenzuwirken, mit einem heimlich zum Schutz der Ordnung begangenen Verbrechen. Der Preis dafür ist, dass die Ordnung, die bestehen bleibt, nur noch ein Hohn ihrer selbst, eine blasphemische Imitation von Ordnung ist.
Hegel verwendet den Begriff »absoluter Gegenstoß« in seiner Erläuterung der Kategorie des Grundes, wo er eines seiner berühmten Wortspiele anbringt, indem er das Substantiv »Grund« mit dem Verb »zugrunde gehen« verknüpft:
»Die Reflexionsbestimmung, indem sie zugrunde geht, erhält ihre wahrhafte Bedeutung, der absolute Gegenstoß ihrer in sich selbst zu sein, nämlich daß das Gesetztsein, das dem Wesen zukommt, nur als aufgehobenes Gesetztsein ist, und umgekehrt, daß nur das sich aufhebende Gesetztsein das Gesetztsein des Wesens ist. Das Wesen, indem es sich als Grund bestimmt, bestimmt sich als das Nichtbestimmte, und nur das Aufheben seines Bestimmtseins ist sein Bestimmen. – In diesem Bestimmtsein als dem sich selbst aufhebenden ist es nicht aus anderem herkommendes, sondern in seiner Negativität mit sich identisches Wesen.«[5]
Auch wenn diese Zeilen unverständlich klingen, ist die ihnen zugrundeliegende Logik klar: In einer Reflexionsbeziehung wird jeder Begriff (jede Bestimmung) durch einen anderen (sein Gegenteil) gesetzt (vermittelt), die Identität durch die Differenz, die Erscheinung durch das Wesen und so weiter – in diesem Sinne ist es »aus anderem herkommend«. Wenn das Gesetztsein sich selbst aufhebt, wird das Wesen nicht mehr durch einen äußeren Anderen, durch sein komplexes Beziehungsgeflecht zu seiner Andersheit und zu der Umwelt, in der es entstanden ist, bestimmt. Es bestimmt sich vielmehr selbst, es ist »der absolute Gegenstoß seiner in sich selbst« – die Lücke oder Unstimmigkeit, durch die es seine Dynamik erhält, ist absolut immanent.
Das Ziel dieses Buches ist es, um es traditionell zu formulieren, den spekulativen Begriff des absoluten Gegenstoßes zu einem allgemeinen ontologischen Prinzip zu erheben. Es fußt auf dem Axiom, dass der dialektische Materialismus der einzig wahre philosophische Erbe dessen ist, was Hegel als die spekulative Stellung des Gedankens zur Objektivität bezeichnet. Alle anderen Formen des Materialismus, einschließlich des »Materialismus der Begegnung« des späten Althusser, des wissenschaftlichen Naturalismus und des neodeleuzianischen »neuen Materialismus«, scheitern an diesem Ziel. Die Konsequenzen aus dem Axiom werden in drei Schritten systematisch entwickelt: 1) der Schritt von Kants Transzendentalismus zu Hegels Dialektik, das heißt vom transzendentalen »Korrelationismus« (Quentin Meillassoux) zum Denken des Absoluten; 2) die eigentliche Dialektik: absolute Reflexion, Zusammenfallen der Gegensätze; 3) der hegelianische Schritt über Hegel hinaus zum Materialismus von »weniger als nichts«.
Teil I beginnt mit einer kritischen Analyse zweier repräsentativer nichttranszendentaler materialistischer Subjektivitätstheorien (Althusser, Badiou). Das zweite Kapitel behandelt dann die transzendentale Dimension und beschreibt den Schritt vom kantianischen transzendentalen Subjekt zum hegelianischen Subjekt als »Disparität« im Herzen der Substanz. Das dritte Kapitel beinhaltet einen ausführlichen Kommentar zu Hegels Grundaxiom, dass der Geist die Wunden, die er der Natur zufügt, selbst heile.
Teil II behandelt das Hegel’sche Absolute. Zunächst beschreibt es die zutiefst ereignishafte Natur des Absoluten, das nichts anderes ist als sein eigenes Gewordensein, um sich dann dem Rätsel des Hegel’schen absoluten Wissens zu widmen: Wie sollen wir diesen Begriff hinsichtlich des dialektischen Grundparadoxes der negativen Beziehung zwischen Sein und Wissen interpretieren, also hinsichtlich eines Seins, das auf dem Nichtwissen basiert? Abschließend werden die Schwierigkeiten des Hegel’schen Gottesbegriffs in den Blick genommen.
Teil III wagt einen hegelianischen Ausflug in das unbekannte Terrain jenseits von Hegel. Am Anfang werden die unterschiedlichen, ja sogar widersprüchlichen Versionen der Hegel’schen Negation der Negation vorgestellt; anschließend geht es um die entscheidende dialektische Umkehrung von »Es gibt keine Beziehung« zu »Es gibt eine Nichtbeziehung« – den Übergang, welcher der Hegel’schen Bewegung von der dialektischen zur spekulativen Vernunft entspricht. Das Buch endet mit einigen Hypothesen über die verschiedenen Ebenen des Gegensatzes, die für jede Seinsordnung konstitutiv sind, und skizziert die Grundzüge einer neuen hegelianischen »Dentologie« (einer Ontologie des den, des »Weniger-als-nichts«). Zwischen diesen drei Schritten liefern zwei Zwischenspiele – eines über Schönbergs Erwartung und eines über die Meisterwerke Ernst Lubitschs – künstlerische Beispiele für den konzeptuellen Inhalt des Buches.
Fußnoten
[1]
Im Original deutsch.