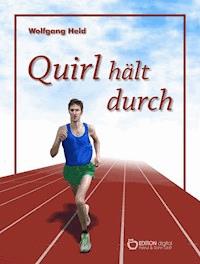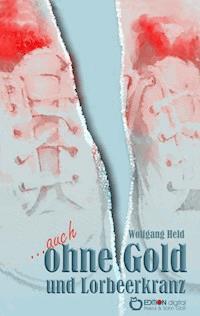6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Reich und mit sich und der Welt zufrieden, erfährt der dänische Schäfer Bertel Björkborg - der Sinn seines Daseins besteht in der Sorge für das Wohl der von ihm allein aufgezogenen Tochter -, dass sein Kind bei einem Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten des Heiligen Landes Opfer eines Terroranschlages geworden ist. Seinen Fäusten mehr vertrauend als den Gesetzen, verlässt er seine Heimat, um den Tod seiner Tochter zu rächen. Im abenteuerlichen Geschehen von Nachforschungen und Verfolgungen wird Bertel Björkborg mit der schwierigen Lage der Länder im Nahen Osten konfrontiert. Er gewinnt Einblick in die einem Europäer fremde und unverständliche arabische Mentalität, lebt mit den Beduinen, gerät in palästinensische Flüchtlingslager und erfährt von illegal stattfindenden Sklavenauktionen. Wolfgang Held bereiste mehrfach den Orient. Sach- und Milieukenntnis sowie die unaufdringliche Verarbeitung gesellschaftlichen und historischen Geschehens prägen diesen Roman. Neben spannender Unterhaltung wird zeitgeschichtliche Information geboten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Al-Taghalub
Gesetz der Bärtigen
ISBN 978-3-95655-575-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1981 im Verlag Das Neue Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2020 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Vorwort
Die in diesem Roman erzählten Schicksale und Ereignisse sind im Jahr 1968 angesiedelt. Zu diesem Zeitpunkt standen die Bewohner der Länder des Nahen und Mittleren Ostens noch tief unter den Eindrücken des sogenannten Sechstagekrieges, der am 5. Juni 1967 um 7.45 Uhr mit israelischen Luftangriffen auf ägyptische Militärflugplätze begonnen und bis zum Abend des 10. Juni 1967 von ägyptischer, syrischer und jordanischer Seite fast 18 000 Gefallene und Vermisste gefordert hatte. Aus den von Israel dabei eroberten arabischen Gebieten wurden bis September 1967 nahezu 350 000 dort beheimatete Menschen vertrieben.
Die Romanhandlung spielt während jener geschichtlichen Etappe, in der die palästinensische Widerstandsbewegung zersplittert war und die PLO (Palestine Liberation Organisation) sich noch nicht zur wirksamen, international einflussreichen und anerkannten Dachorganisation der für die Rechte des arabischen Volkes von Palästina kämpfenden Kräfte und Gruppierungen entwickelt hatte.
Historisch belegte Ereignisse und Prozesse bilden den Hintergrund dieses fiktiven Geschehens, dessen handelnde Personen, Schauplätze und Namen nur unbeabsichtigt und zufällig Analogien im Bereich des realen Geschehens finden könnten.
Und vernichtet wird,
Wer nicht zur Verteidigung seiner Wasserstelle
Mit seinen Waffen dreinschlägt,
Und Schlimmes wird dem angetan,
Der anderen nichts Schlimmes zuzufügen vermag.
Zuhair bin Abi Salma
in „Mu’allakat“ (8.Jh.)
1. Kapitel
„Ihr sollt nicht um mich weinen. Wenn ich morgen sterbe, dann für Palästina. Mir ist nicht wichtig, wie unser künftiger Staat aussehen wird. Ich will mein Vaterland befreit sehen, das allein ist schon den höchsten Einsatz wert.“
Hassan Kassem, geboren in Obergaliläa, in einem Brief an seine Schwester Fatima
Auf splittertrockenem, steinigem Boden löst jeder Schritt kleine Brocken ab, die talwärts rollen. Das scheppernde Geräusch klingt in der Stille wie dünner Trommelwirbel. Mattes Licht einer schmalen Mondsichel hebt unzählige bizarre Konturen aus dem Hang hervor. Kantige Felsen und buschige Tamariskensträucher werfen reglose, gespenstische Schatten ins Zwielicht.
Die beiden zum Tal hinabsteigenden Gestalten kommen nur langsam vorwärts. Ausgespülte Spalten lauern. Hier zu stürzen kann leicht böse Folgen haben. Felsige Absätze täuschen zuverlässigen Halt vor und bersten dann unter den Sohlen wie morsches Gezweig. Jeder Meter der pfadlosen, stark abschüssigen Berglehne birgt eine neue Gefahr. Dazu sind die Männer schwer bepackt. Sie tragen auf Brust und Rücken verteilt zwei tiegelähnliche Behälter. Außerdem haben sie erbeutete UZI-Maschinenpistolen und kurzstielige Feldspaten bei sich.
Bis zur Straße, die sich durch das Tal windet, bleibt noch reichlich eine Steinwurfweite. Der vorausgehende Mann hält inne und schaut zurück. Er ist wie sein Gefährte gekleidet. Verwaschenes Kakihemd, enge, lehmfarbene Leinenhose, knöchelhohe Schnürstiefel, der Kopf eingehüllt in eine schwarz und weiß gemusterte Kufiya, das Kopftuch arabischer Männer, das von einem Ring aus Ziegenhaar gehalten wird. An seiner Brust baumelt neben dem dunklen Metallbehälter ein Fernglas. Er hebt es an die Augen und sucht die Berggipfel im Nordosten ab.
„Siehst du das?“, fragt Hassan Kassem seinen um einige Jahre jüngeren Begleiter. Er selbst ist auch noch keine fünfundzwanzig Jahre alt. Seine Hand weist nach Nordost. Der Jüngere kneift die Lider zusammen. Zwischen den schmalen Schlitzen glimmt beherrschte Leidenschaft. Er stößt einen kurzen, verächtlichen Zischlaut aus und gibt damit zu verstehen, dass er die allerersten Zeichen des heranziehenden Tages auch ohne optische Hilfsmittel erspäht.
„Eigentlich sollten wir um diese Zeit längst auf dem Rückweg sein“, beanstandet Hassan Kassem. „Selbst wenn Allah dir und mir sieben Hände geben würde, könnten wir nicht vor Sonnenaufgang hinter den Bergen sein. In spätestens anderthalb Stunden sehen die Hundesöhne hier in dieser Gegend alles, was sich bewegt. Jede Eidechse.“
Der Jüngere brummt unwillig und geht weiter. Hassan Kassem holt ihn mit zwei Schritten ein. Er übernimmt wieder die Führung.
„Das Kommando habe ich, Omar al-Khatib“, erinnert er leise, aber sehr bestimmt. „Gehen wir zu der Biegung dort vor, da haben wir nach beiden Seiten die weiteste Sicht.“
Die Straße führt von Nahariya am Mittelmeer in zahllosen, zuweilen halsbrecherischen Windungen nahe entlang der südlibanesischen Grenze durch die wilde, biblische Landschaft Obergaliläas. Man gelangt auf diesem Weg bis hin zum Kibbuz Dan und der Quelle des Jordans am Tell Dan, dem Hügel der Richter.
Das Tal wurde von der Gruppe „Qibya“ für die Aktion ausgewählt. Der Platz ist für das Vorhaben besonders gut geeignet, weil die Fahrbahndecke hier überall eine Menge Schäden aufweist. Manche der Schlaglöcher dehnen sich bis zur Größe eines Wagenrades aus. Nur sehr verstreut sind Spuren kümmerlicher Reparaturen erkennbar.
Hassan Kassem bleibt stehen. Er greift in die Brusttasche und bringt eine Taschenlampe zum Vorschein. Seine Hand schirmt den Lichtkegel ab. Sekundenlang huscht Helligkeit über die Straße.
„Ich hier, du dort drüben, klar?“, flüstert der Anführer.
Der Jüngere nickt und eilt zu der angewiesenen Stelle. Er kniet nieder, hantiert mit seinem Feldspaten, murrt dabei kaum hörbar. Auch Hassan Kassem höhlt hastig eines der Schlaglöcher tiefer aus. Sein Blick fliegt immer wieder die Straße entlang. Bei glattem, dickem Bitumenbelag wäre es unmöglich gewesen, in einem knapp bemessenen Zeitraum vier schwere Panzerminen sicher vor den argwöhnischen Blicken einer israelischen Patrouille zu verstecken.
Es dauert nur einige Minuten, bis Hassan Kassem und der junge Omar al-Khatib die ersten beiden Minen entsichert und dann mit dem ausgehobenen Schotter sorgfältig bedeckt haben. Was an Steinen und Erde übrig ist, wird auf die zuvor ausgebreiteten Kopftücher gekehrt. Kein verdächtiges Anzeichen für irgendwelche Arbeiten an der Fahrbahn darf zurückbleiben. Die Israelis sind misstrauisch. Die kleinste Unvorsichtigkeit kann den Erfolg des Unternehmens gefährden. Die Männer wissen das. Sie wollen die Erdreste nachher auf dem Rückweg zwischen den Felsen verstreuen.
Jeder Handgriff der beiden Araber verrät vielfache Übung. Die Führung der „Qibya“, einer der zahlreichen Splittergruppen des palästinensischen Widerstandes, wählt keinen Opferbereiten ohne vorheriges hartes, wochenlanges Training für einen Einsatz aus. Die kleine kampfentschlossene Schar hat sich den Namen eines Dorfes gegeben, dessen Ruinen am Westufer des Jordans liegen. Seit dem Sechstagekrieg im vergangenen Jahr ist das ganze Gebiet dort von den Israelis okkupiert, aber bereits im Oktober 1953 waren zionistische Terroristen über die Gemeinde Qibya hergefallen und hatten fünfundsiebzig arabische Bewohner umgebracht. Nur wenige Zeitungen in der Welt waren damals bereit gewesen, den Augenzeugenbericht eines katholischen Geistlichen zu verbreiten. Die internationale Öffentlichkeit zeigte zu jenem Zeitpunkt nur wenig Interesse an Enthüllungen zionistischer Massaker. Die Opfer des Überfalls gerieten jedoch nirgendwo im Nahen und Mittleren Osten in Vergessenheit. Die Männer der „Qibya“ beschworen bei jedem Sonnenaufgang und -untergang das Andenken der fünfundsiebzig ermordeten Männer, Frauen und Kinder.
Wer sich dem Eid der Opferbereiten unterwarf, feierte zuvor mit den Familienangehörigen Abschied. Ein Totenfest. Vom Tag des Beitritts zur „Qibya“ sollte ein junger Mann von seinen Eltern und Geschwistern, von Nachbarn, Freunden und Bekannten nicht mehr zu den Lebenden gezählt werden. In diesen Stunden weinten die Mütter. Die Alten sprachen von dem gewaltigen Lohn, den Allah für alle spendete, die auf seinem Weg, gegen Angreifer und Totschläger kämpfend, siegten oder starben.
Vor ihrem Einsatz hatten Hassan Kassem und Omar al-Khatib nicht nur gelernt, mit Minen umzugehen. Sie waren barfüßig durch brennende Benzinpfützen gelaufen, um gegen Gefahren und Schmerzen furchtlos zu werden. Dicht an den Boden gepresst, hatten sie mit anderen Opferbereiten geübt, unter flachgespanntem Stacheldraht vorwärts zu kriechen, während der Ausbilder mit einer Maschinenpistole Geschossgarben dicht über die Köpfe hinwegfeuerte. Männer der „Qibya“ sollten bereits vor dem ersten Kampfauftrag mit Gefechtslärm vertraut sein. Keiner durfte im Zirpen der Kugeln die Nerven verlieren.
Jeder Opferbereite der „Qibya“ muss nach dem Training unzerbrechlich und scharfgeschliffen sein wie ein Dolch des berühmten Waffenschmieds Mohammed ibn Sari aus Dschof, erklärte der einarmige Anführer und verzog keine Miene, wenn bei den Übungen einer der jungen Männer vor Erschöpfung zusammenbrach oder gar von einer Kugel gestreift wurde. Im Verlauf der Ausbildung hatte es öfter ernsthafte Verletzungen und einmal sogar einen Toten gegeben. Auch sein Name war auf die Liste der Märtyrer gesetzt worden.
„Achtung!“, warnt Hassan Kassem plötzlich. Omar al-Khatib hat das helle, tanzende Licht ebenfalls sofort entdeckt. Es nähert sich aus östlicher Richtung. Ein Fahrzeug oder auch mehrere. Der Ältere flucht leise.
„Los, weg!“, befiehlt er. „Dein Tuch! Und die Erde schnell über das Loch! Hörst du nicht? Das Tuch! Bist du blind?“
Zwei Scheinwerferpaare tauchen das Tal und die Straße vom Osten her in Tageshelle. Voran fährt ein mit drei Uniformierten besetzter Militärjeep. Zwischen den Vordersitzen und dem Fond befindet sich, auf einem Träger montiert, ein bewegliches Maschinengewehr. Einer der Soldaten umklammert die Griffe der schussbereiten Waffe. Der neben dem Fahrer sitzende Patrouillenführer schaltet in kurzen Abständen einen kleineren, aber sehr leistungsstarken und schwenkbaren Scheinwerfer ein. Er sucht mit dem weitreichenden grellen Strahl die Umgebung beiderseits der Straße ab.
Dem Jeep folgt in knappem Abstand ein Lieferwagen, hochbeladen mit Obststiegen, die bei jedem Schlagloch bedrohlich ins Wanken geraten. Zwischen den Lippen des Mannes am Lenkrad klemmt eine Zigarette. Auch er hat eine schwarz-weiße Kufiya um seinen Kopf geschlungen. Offenbar ein Araber, der im Dienst eines Transportunternehmens Früchte und Gemüse aus den nahen Kibbuzim Biram, Yron oder Malkiya nach Nahariya bringt. In den zahlreichen Hotels des beliebten Badeortes an der Küste gibt es ständigen Bedarf für frische Ware.
Blitzschnell suchen die beiden Männer der „Qibya“ Deckung. Hassan Kassem erhält Schutz hinter einem fast mannhohen Wall aus stacheligen Opuztien. Omar al-Khatib zwängt seinen schmalen Körper in eine der vielen tiefen Rinnen, die nach den starken Regenfällen im Januar und Februar von ungebändigten Sturzbächen in den Boden gepflügt worden sind. Die beiden Opferbereiten wagen kaum zu atmen. Jeder hat den Finger am Abzug der Waffe. Die Motorgeräusche kommen näher. Es erscheint den jungen Arabern so, als würde die Geschwindigkeit des Jeeps gedrosselt, aber es ist nur beklemmende Spannung, die ihnen jede Minute zur kleinen Ewigkeit ausdehnt.
Die Fahrzeuge fahren in Richtung Nahariya, also auf der den versteckten Minen gegenüberliegenden Straßenseite. Wenn dennoch eines der Räder auf einen entsicherten Druckzünder geriete, könnte das noch keine Explosion auslösen. Der Sprengmechanismus reagiert erst unter der Tonnenlast eines Panzers oder eines anderen überschweren Gewichtes. Damit sollte ausgeschlossen bleiben, dass irgendein bedeutungsloser Personenwagen oder womöglich bloß ein Eselkarren in die Luft flog. Derartige hochwirksame Minen kosteten im geheimen internationalen Waffengeschäft eine Menge Geld. Hinter der „Qibya“ stand keine der starken, einflussreichen arabischen oder außerarabischen Interessengruppen. Sie verfügte deshalb nur über sehr geringe finanzielle Mittel. Ein paar spärliche Spenden bessergestellter Familienangehöriger, einige Einnahmen aus kunstgewerblichen Arbeiten der Frauen und Halbwüchsigen, mehr kam nicht zusammen. Deshalb spielte neben allen militärischen Erwägungen bei den Kommandounternehmen der Gruppe auch der effektivste Einsatz aller erworbenen Kampfmittel eine bestimmende Rolle.
Hassan Kassem und Omar al-Khatib bleiben von der israelischen Streife ebenso unentdeckt wie die unter der Straßendecke verborgenen Minen. Die beiden jungen Männer warten, bis von den Fahrzeugen nichts mehr zu hören und zu sehen ist. Hinter den Bergkuppen im Nordosten zieht Morgenröte herauf. Von einer Minute zur anderen ist die Luft erfüllt vom Gezwitscher der Vögel. Der Tag kommt auf schnellen Flügeln. Noch bevor die letzte der vier Minen entsichert und getarnt ist, liegt die Straße im Sonnenlicht.
„Das schneidet uns den Rückweg ab“, stellt Hassan Kassem fest und blinzelt gegen die grelle Helligkeit. „Wir müssen so weit wie nur möglich hinauf in die Berge!“
Sie klettern hastig. Je höher sie kommen, um so zerklüfteter ist der Steilhang. Nicht weit unterhalb der Kammlinie des Höhenzuges wählt Hassan Kassem einen Schlupfwinkel. Zwei zeltartig gegeneinandergestellte Felsplatten geben nach allen Seiten und auch gegen Entdeckung aus der Luft Schutz, zudem behalten die Opferbereiten von dort aus die Straßenbiegung und ein ganzes Stück der aus Richtung Nahariya heranführenden Strecke im Blickfeld.
Es ist eng im Versteck. Die beiden Männer verschnaufen. Sie atmen schnell und keuchend. Jeder kann den Schweiß des anderen auf der eigenen Haut fühlen. Die Zeit verstreicht. Sonnenhitze flimmert über dem Hang. Die Steine glühen. Hassan Kassem beobachtet durch sein Fernglas die Straße. Zweimal in einer Stunde knattert dicht über sie hinweg ein Armee-Hubschrauber. Die israelischen Grenzposten stehen jenseits des Hanges. Von dort haben sie weite Sicht auf libanesisches Gebiet. Tagsüber ist ein unbemerktes Überschreiten der Grenze so gut wie unmöglich. Angehörige anderer, größerer Befreiungsgruppen hatten solche Versuche bereits mit hohen Verlusten bezahlt. Von der „Qibya“ war noch keine Einsatzgruppe in das feinmaschige Netz der Isrealis geraten. Eine ihrer Kampfregeln lautete: Gegen eine Übermacht des Feindes ist die Nacht das beste Schwert des Tapferen!
Der Himmel über Obergaliläa strahlt in gläsernem Blau. Ein Apriltag ohne Wind und Wolken. Die Atmosphäre in dem schmalen Felsspalt lastet stickig und bleischwer auf den beiden Männern. Winzige, beißwütige Ameisen krabbeln ihnen über Arme und Nacken. Durst beginnt sie zu quälen. Omar al-Khatib rekelt sich misslaunig. Sofort zischt sein Gefährte.
„Eine Zunge aus Stein, aber quirlig wie ein Ziegenschwanz!“ „Lass mich Wasser holen!“
Es ist der erste Satz, den der Jüngere seit Mitternacht über die Lippen bringt. Er zieht die Knie an und will das Versteck verlassen. Hassan Kassem reißt ihn schroff zurück.
„Nimm dich zusammen, Sandhase!“, fährt er ihn leise an. „Und wenn wir wie im Backofen schmoren, ist das immer noch besser, als die Hundesöhne auf dem Hals zu haben. Wir werden nicht vertrocknet sein bis zur Dunkelheit.“
Omar al-Khatib versucht, seinen Arm aus dem Griff des Gefährten zu bekommen, doch Hassan Kassem lässt nicht los.
„Was du tun willst, ist nicht mutig, sondern zeugt von Schwäche und Dummheit … Selbst wenn sie dich nicht entdecken und du tatsächlich irgendwo in der Nähe eine Quelle findest, ich glaube nicht, dass dort dann auch ein Kanister steht. Du würdest dich vollsaufen und eine Stunde später das gleiche Feuer wie jetzt in der Kehle haben.“
Omar al-Khatib kneift die Lider zusammen, als blase ihm Wind feinen Sand ins Gesicht. Belehrungen mag er nicht. Kritik, auch berechtigt, verletzt ihn. Gleichfalls missfällt ihm, wenn ihn jemand Sandhase nennt. Er ist Beduine. Die Gleichsetzung mit dem ängstlichen Langohr der Wüste beleidigt ihn. Nur widerwillig streckt er die Beine aus und gibt sein Vorhaben auf. Er versinkt erneut in Schweigen.
Hassan Kassem wartet eine Weile, bevor er leise erklärt: „Ich wollte dich bestimmt nicht verletzen, Omar.“ Er hält, während er spricht, das Fernglas vor die Augen. „Mir kriecht das Blut genauso bleiern durch die Adern. Wir hätten eine Wasserflasche mitnehmen sollen, aber wer konnte wissen … Mein Fehler! Wo bleiben diese verfluchten Harami nur?“
Für Hassan Kassem war dies bereits der vierte Einsatz im israelischen Machtbereich. Bei der „Qibya“ galt die Regel, für Zweimannaktionen keinen Neuling ohne einen erprobten Anführer einzusetzen. Das sollte gültig bleiben, solange es in der Gruppe noch Opferbereite ohne Kampferfahrung gab, und das waren noch fast ein Dutzend junger, entschlossener Männer. Hassan Kassem hatte sich widerspruchslos dem Befehl gefügt, der ihm Omar al-Khatib zum Begleiter bestimmte. Begeistert war er von dieser Entscheidung freilich nicht. Man wusste in der Gruppe zu wenig über diesen wortkargen Jüngling, der sich niemandem enger anschloss und keine Freunde besaß. Bekannt war nur, dass er zu einem Unterstamm der Murwarkat-Beduinen gehörte, die zu einem kleineren Teil im Gaza-Gebiet sesshaft geworden waren, in ihrer Mehrheit jedoch nach wie vor mit ansehnlichen Schaf- und Kamelherden die kümmerlichen Weideflächen zwischen der Wüste Negev und der Großen Nefud im Norden Arabiens durchstreiften. Weil er mit jedem Wort knauserte, hatte bisher noch kein Gruppenmitglied herausbekommen, was ihn eigentlich bewegte, in der „Qibya“ zu kämpfen. Er war der einzige Beduine in der Gruppe, und man begegnete ihm deshalb mit starker Zurückhaltung. Jedermann kannte die fragwürdige Rolle der Beduinen-Schwadronen, die in Saudi-Arabien und Jordanien zuverlässige Stützen der Monarchien bildeten, und nicht nur dort hatten sich Wüstenstämme in kritischen politischen Situationen mit den jeweils konservativsten, reaktionärsten Kräften verbündet. Viele sesshafte Araber sahen in den Wüstenbewohnern so etwas wie zivilisatorisch weit zurückgebliebene Verwandte, deren Existenz und ungebundene Lebensweise einerseits peinlich war, andererseits aber auch tief im Herzen einen Funken Stolz auf die noch von den Stämmen streng bewahrten, edlen arabischen Tugenden glimmen ließ.
Ich erfahre noch, was in dir tickt, Sandhase, denkt Hassan Kassem. Wenn wir beide diese Sache hier hinter uns haben, werden wir wie Geschwister sein, verlass dich darauf. Und Brüder sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Von mir weißt du sowieso schon alles. Wenn wir beieinander sitzen und am Kaffee nippen, dann bin ich derjenige, dem die anderen zuhören. Ich rede zu viel, was du zu wenig redest. Mein Vater war genauso.
Die Straße unten im Tal lag verödet im gleißenden Licht. Hassan Kassem lässt das Fernglas sinken. Er denkt an seinen Vater. Ein strenger Zug härtet sein Gesicht und macht ihn auf eigentümliche Art dem verschlossenen, unzugänglichen Gefährten ähnlicher.
Die Familie Kassem lebte, wie von Generation zu Generation überliefert war, schon zur Zeit des großen Erdbebens im Jahre 1759 in Mahad, einer malerischen, auf einem der hohen Berge im oberen Galiläa gelegenen Stadt, von deren Höhen man bei einigermaßen guter Sicht den See Genezareth, das Mittelmeer und im Norden den schneebedeckten Gipfel des Dschebel ech Schech sehen konnte. Auch das zweite starke Beben im Jahr 1837, das den Ort fast völlig in Trümmer legte, vermochte zwar die armselige Behausung der Kassems erneut zu zerstören, doch vertreiben ließ sich die Familie dadurch nicht. Sie baute die Lehmhütte ein drittes Mal noch massiver und geräumiger auf, entschlossen, an diesem Platz festzuhalten, solange noch Kraft in ihnen war. Mahad ist unser Brot, hatte Hassan Kassems Großvater den Enkeln immer wieder eingeschärft, hier sind unsere Wurzeln, hier ist die Nahrung, ohne die wir nicht leben können!
Zu Lebzeiten jenes Großvaters von Hassan Kassem hatte die von dem Schriftsteller Theodor Herzl gegründete zionistische Weltorganisation damit begonnen, die Einwanderung jüdischer Siedler vor allem aus Ost- und Südosteuropa nach dem damals noch zum Osmanischen Reich gehörenden Palästina zu organisieren. Ziel war die Inbesitznahme möglichst großer Landflächen und die allmähliche Verdrängung der seit Jahrhunderten dort ansässigen Araber. Auf diese Weise sollten im Laufe der Zeit die Grundlagen zur Bildung eines eigenständigen jüdischen Staates geschaffen werden.
Die armen Leute im Araberviertel von Mahad hatten zu jener Zeit noch keine Ahnung von derartigen Plänen. Ebenso wie die Kassems erfuhren auch ihre arabischen Nachbarn in diesen Jahren noch nichts von dem Brief, den der britische Außenminister Arthur James Balfour am 2. November 1917 an den Zionistenführer Rothschild geschrieben hatte. In dieser Erklärung sagte der konservative, spätere Earl of Balfour die britische Unterstützung bei der Gründung einer jüdischen Heimstatt in Palästina zu. Die Zionisten werteten dieses Versprechen, das freilich die Determination des Wortes „Heimstatt“ diplomatisch vermied, als Freibrief zur Durchsetzung ihrer Absichten. Von nun an scheuten sie in Palästina auch vor Gewaltanwendung gegen das dort sesshafte arabische Volk nicht mehr zurück.
Kamil Kassem, Hassans Vater, besuchte noch die Koranschule, als Berichte von blutigen Zusammenstößen zwischen einheimischen Arabern und jüdischen Siedlern immer häufiger die Gemüter bewegten. Dabei stieg die Zahl der Einwanderer ständig. Das Reisegeld zahlte die internationale jüdische Bourgeoisie. Aus diesen Kreisen kamen Millionenbeträge zur Finanzierung der von den Zionisten gegründeten landwirtschaftlichen Niederlassungen oder industriellen Unternehmen in Palästina.
Die Familie Kassem blieb von all diesen Entwicklungen lange unberührt. Wenn im Kaffeehaus über die Kämpfe gegen die Einwanderer gesprochen wurde, machte auch der angesehene Mechaniker Kamil Kassem seinem Zorn mit heftigen Worten Luft, aber das bedeutete keineswegs Bereitschaft zur Teilnahme an solchen Aktionen. Hassans Vater war kein kämpferischer Mensch. Er hatte nie in seinem Leben ein Gewehr in der Hand gehabt, er besaß nicht einmal einen Dolch.
Erst einige Jahre nach dem ersten Weltkrieg, als Palästina unter britische Verwaltung gekommen war, gab es in Kassems Reparaturwerkstatt Anzeichen dafür, dass die zahlreichen andersgläubigen Zuwanderer nach und nach die gewohnten Verhältnisse in Hahad umgestalteten. Jüdische Kunden blieben aus. Wer von ihnen die Schiffchenwelle einer Nähmaschine gerichtet haben wollte oder einen Fahrradrahmen schweißen lassen musste, der ging nun in die neuen, modern ausgestatteten Werkstätten des „Golden-hands-service“. Dort arbeiteten sechs qualifizierte Mechaniker aus Ungarn, Österreich und Polen. Es gab eine Lehrlingswerkstatt, ein Büro mit einer Buchhalterin und eine kleine Kantine. Araber wurden nicht eingestellt. Man beschäftigte nur Juden. Für Kunden hingegen galten keine rassischen oder religiösen Vorbehalte. Wer zahlen konnte, wurde fachmännisch und zuverlässig bedient. Hassan Kassems Vater spürte das bald an den wöchentlichen Einnahmen.
Gegen Ende der Zwanzigerjahre wuchs der Einfluss führender Geldleute der USA auf die zionistische Bewegung. Die Einwanderungszahlen kletterten. 1936 betrug der jüdische Bevölkerungsanteil in Palästina bereits 31 Prozent. In den weiten, von Arkaden umsäumten Höfen der Moscheen ging ein Satz von Mund zu Mund: Wenn wir jetzt untätig bleiben, sind wir bald nur noch Geduldete in unserem eigenen Land!
Die jüngeren Araber in den Dörfern und Städten formierten sich zuerst zum Widerstand. Ich will leben, dachte Kamil Kassem in jenen Wochen. Ich will eine Frau haben und viele Söhne, die mir in meinen späten Jahren das Herz wärmen sollen. Ich will mit meinen Nachbarn in Frieden leben. Waffen mag ich nicht, aber ich werde mich damit auch nicht aus meiner Stadt vertreiben lassen. Ich bin kein räudiger Hund, den man verscheuchen kann. Ein Mann, der im Kampf sein Leben verliert, behält über seinen Tod hinaus einen sauberen Namen. Einer, der seine Heimat verlässt oder sich zum Knecht machen lässt, wird womöglich hundert Jahre alt und ist trotzdem übler dran als ein Toter. Die Leute werden ihn verachten wie einen zahnlosen, feigen Köter. Ein Ehrloser, dem der Weg ins Paradies ewig verschlossen bleibt. Ich werde den Kopf nicht senken, wenn meine Brüder mich rufen! Aber Großvater Kassem ließ nicht zu, dass ein Familienmitglied nachts aus dem Haus ging. Wir Kassems haben keine Mäuseherzen, erklärte er, doch ebenso wenig soll uns jemand den Verstand von Mäusen nachsagen dürfen. Mahad ist immer noch groß genug für Araber und Juden. Ein paar Kunden weniger sind kein Grund, die neuen weißen Häuser der Siedler oben am Jordan in die Luft zu sprengen oder die britischen Soldaten der Mandatsverwaltung in Hinterhalten umzubringen. Wenn sie einen Kassem dabei töten, dann haben sie uns schon besiegt, bevor Recht und Unrecht gewogen werden. Allein wer lebt, vermag sich mit seinen Händen und Zähnen an dem Platz festzuhalten, wo er geboren worden ist und bleiben will. Dort in der Ecke findet ihr Kannen, deren Löcher zugelötet werden müssen! Seht das Vorderrad, in dem ein halbes Dutzend neue Speichen eingezogen werden müssen. Arbeit genug! In Mahad herrscht Frieden, und so soll es bleiben – Inscha’allah!
Hassan Kassems Vater fügte sich dem Willen des Alten, doch dieser Gehorsam schmerzte, wenn Kunden oder Bekannte von Kampfaktionen der palästinensischen Widerstandsgruppen erzählten. Als Antwort darauf bildeten die jüdischen Siedler die Terrororganisationen Irgun Zwai Leumi und die Sterngruppe. Auch noch zu Beginn des zweiten Weltkrieges hielten die Kämpfe in Palästina britische Truppenverbände fest, deshalb entschloss sich die Londoner Regierung schließlich, entsprechend den immer energischer werdenden arabischen Forderungen, die jüdische Einwanderung einzuschränken. Diese Entscheidung wurde von den Zionisten als Kampfansage aufgefasst. Sie verstärkten weltweit ihre Aktivitäten. Eine zionistische Konferenz wurde nach New York einberufen. Im Mai 1942, als Hassans Vater heiratete, forderten die Teilnehmer der Konferenz in den USA die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina und die Aufstellung einer jüdischen Armee. Damit gaben sie den zionistischen Terrorgruppen das Signal, die bewaffneten Aktionen gegen die arabische Bevölkerung zu verstärken.
Je unerträglicher wir den Kameltreibern das Leben im Land Davids machen, um so eher wird es den Staat Israel geben, sagte ein Irgun-Zwai-Leumi-Anführer vor einem Überfall auf ein Beduinenlager.
In Mahad blieb es immer noch still, Kamil Kassem wurde von seiner Frau mit einer Tochter enttäuscht, und der Großvater hustete immer häufiger Blut. Kaum jemand in den Lehmhütten der Stadt, wo es weder Elektrizität noch Wasserleitungen gab, interessierte sich für die Vorgänge in Europa, die im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit lagen. In Nürnberg deckte der Internationale Militärgerichtshof schonungslos die ungeheuerlichen Gräueltaten des faschistischen Deutschlands auf und machte den Hauptkriegsverbrechern den Prozess. Die Sympathien von Millionen erschütterter Menschen in allen Kontinenten gehörten dem gepeinigten Volk der Juden. Wer irgendwo in der Welt von Jerusalem sprach, vom palmengeschmückten Frühlingshügel am Mittelmeer oder von den Kibbuzim nahe dem Brunnen, den einst Abraham für den Preis von sieben Schafen grub, der kannte auch die Namen von Auschwitz, Treblinka und Majdanek. Sechs Millionen Ermordete. Sechs Millionen unüberhörbare Anwälte der Jahrtausendealten Sehnsucht des Volkes Israel. Und in Palästina loderte Hass. Fast in jeder Stunde starben dort Menschen bei bewaffneten Zusammenstößen. Juden und Araber. Manche mit einer Waffe in der Hand, andere unvorbereitet während einer Mahlzeit, mitten in einem Spiel oder beim Pflanzen eines Baumes. Auch in Mahad explodierten Bomben.
Obwohl das Blutvergießen die Stadt auf den Höhen nun doch erreicht hatte, bezeigte Kamil Kassem Allah jeden Tag fünfmal Dankbarkeit. Seine Frau hatte ihm schon ein Jahr nach der Geburt der Tochter den so heiß ersehnten Sohn geschenkt: Hassan!
Auf den Knien des Großvaters lernte der Kleine aufrechtes Sitzen, und wenig später wagte er an den welken Händen des Alten die ersten, vorsichtigen Schritte.
Am 11. Mai 1947 legte Kamil Kassem seinen greisen Vater so, dass er nach Süden blickte. Der Alte starb, wie es der Koran vorschrieb, mit dem Gesicht in Richtung der heiligen Städte Mekka und Medina.
Vier Wochen vor diesem Tag hatten die Vereinten Nationen eine Kommission bestimmt, deren Aufgabe darin bestand, die Verhältnisse in Palästina zu prüfen und Vorschläge für eine friedliche, allen Interessen gerecht werdende Lösung auszuarbeiten. Als sich die siebenunddreißig in Mahad lebenden Mitglieder der Familie Kassem vierzig Tage nach dem Tod des Alten noch einmal zu einer Trauerfeier zusammenfanden, gab es noch keine Nachrichten aus New York. Erst am 29. November 1947 fasste die UNO-Vollversammlung mit Mehrheit den Beschluss, Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu teilen. Überall im Land feierten die jüdischen Siedler einen Sieg. Für die einheimischen Araber dagegen kam der Beschluss einer Demütigung gleich. Hauptsächlich die Anwesenheit der britischen Mandatstruppen verhinderte einen über das ganze Land verbreiteten Ausbruch leidenschaftlicher Empörung. Hinzu kam, dass auch angesehene, besonnene arabische Führer vor unbedachten Aktionen warnten. Zu denen, die solche Appelle an die Vernunft einsichtig befolgten, gehörte auch Hassan Kassems Vater. Manchmal nahm er seinen Sohn mit zum Kaffeehaus, wo es seit Kurzem ein Radio gab. Es wurde vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang umlagert. Übereinstimmend meldeten die Sender aus Damaskus, Beirut, Kairo und Amman, dass die Regierungen aller arabischen Staaten bemüht waren, auf diplomatischem Weg gerechtere Lösungen des Palästina-Problems zu erreichen.
Noch blieb genügend Zeit dafür. Entsprechend dem UNO-Beschluss sollte die Konstituierung des jüdischen und des arabischen Staates sowie der internationalen Enklave Jerusalem erst Anfang August 1948 erfolgen.
Tausend Jahre haben wir unter fremden Obrigkeiten nebeneinander gelebt, die Araber und die Juden, weshalb können wir das nun nicht auch in einem eigenen, gemeinsamen Staat, fragte Kamil Kassem den Imam und den Arzt und einen Besitzer von vierhundert Olivenbäumen, aber keiner der drei gebildeten Männer antwortete ihm. Sie wiegten nachdenklich die Köpfe und schwiegen. Ein Schafhirt, dem er die Schurscheren schliff, lachte ihn aus: Hast du je einen Hund erlebt, der sich, und wäre er zum Platzen satt, mit dem halben Knochen begnügen würde?
Trotz vieler schlimmer Zeichen hofften zahlreiche Bewohner des arabischen Viertels von Mahad, dass Allah am Ende alles doch noch zum besten wenden würde. Auch Kamil Kassem war einer der Zuversichtlichen. Dann änderte die Nacht vom 14. zum 15. Mai 1948 alles. Gleichzeitig mit dem Erlöschen des britischen Mandats für Palästina verbreitete eine jüdische Radiostation die Nachricht von der Ausrufung des unabhängigen jüdischen Staates Israel. Das geschah zweieinhalb Monate vor dem dafür von der UNO festgelegten Termin.
„Wir bestimmen, dass vom Augenblick der Beendigung des Mandats in dieser Nacht vom 15. Mai 1948 an bis zur Errichtung der ordentlichen Staatsbehörden, die auf Grund eines durch die verfassunggebende Versammlung bis spätestens zum 1. Oktober 1948 zu erlassenden Gesetzes gewählt werden sollen, der Volksrat als Provisorischer Staatsrat fungieren und seine Leitung die Provisorische Regierung des jüdischen Staates, dessen Name Israel sein wird, bilden sollen.“ So schallte die Proklamation aus allen Rundfunkgeräten des Landes. Der Text wurde wieder und wieder gesendet. Für die Angehörigen des arabischen Volkes von Palästina klang jeder Satz wie Hohn. „Der Staat Israel wird für die jüdische Einwanderung und die Sammlung der zerstreuten Volksglieder geöffnet sein; er wird für die Entwicklung des Landes zum Wohl aller seiner Bewohner sorgen; er wird auf den Grundlagen der Freiheit, Gleichheit und des Friedens, im Lichte der Weissagungen der Propheten Israels gegründet sein; er wird volle soziale und politische Gleichberechtigung allen Bürgern ohne Unterschied der Religion, der Rasse, des Gewissens, der Sprache, der Erziehung und Kultur garantieren; er wird die Heiligen Stätten aller Religionen sicherstellen und den Grundsätzen der Vereinten Nationen treu sein …“
Der Mechaniker Kamil Kassem hörte aufmerksam zu, und er verlor dabei seine Friedfertigkeit. Jeden Satz, den er vernahm, maß er an dem, was ringsum geschehen war und noch geschah. Das konnte nur Spott sein! War diese soziale und politische Gleichberechtigung tatsächlich so gemeint, dass in diesem neuen Staat Israel ein Araber das Amt eines Polizeichefs, eines Richters, eines Generals oder eines Ministers ausüben durfte und dem „Golden-hands-service“ auferlegt werden würde, auch Araber einzustellen und als Spezialisten auszubilden? Kein Unterschied der Religion, so verkündeten die Proklamatoren und stellten doch in der gleichen Zeile schon das Wort des Propheten Mohammed unter die Weissagungen ihrer eigenen Propheten … Kamil Kassem kam sich vor, als hätte man ihn ins Gesicht gespien.
Knapp eine Stunde nach der ersten Vorlesung der Proklamation im Radio fielen in der Nähe der Synagoge Schüsse. Ob sie von jüdischer oder arabischer Hand abgefeuert wurden, blieb ungeklärt. Die Kassems jedenfalls schnürten eilig zusammen, was sie tragen konnten. Sie waren noch beim Packen, als in ihrer Gasse Handgranaten explodierten. Lehm bröckelte von den Wänden. Sie stürzten aus dem Haus. Draußen trafen sie flüchtende Nachbarn. Sie werden uns alle umbringen, damit sie Platz für ihre Leute haben, schrie eine hysterische alte Frau immer wieder.
Mit schwer beladenen Eseln und zweirädrigen Karren behinderten sich die Menschen gegenseitig in den engen Durchgängen. Unweit einer Höhle, in der angeblich jener Bote begraben lag, der zu biblischer Zeit das blutige Hemd des Joseph zu dessen Vater Jakob brachte, starrte ein erschlagener Greis mit leerem Blick zum Himmel. Die blauen, klaffenden Lippen formte noch der erloschene Schrei.
Damals war Hassan Kassem erst fünf Jahre alt gewesen. Trotzdem brannten das Heulen der Kinder, das Wehklagen der Frauen und das Krachen der Detonationen auch in dieser Stunde in seinem Gedächtnis, als sei das alles erst wenige Tage her.
„Hat dir deine Mutter oft Märchen erzählt?“, fragt er den unbewegt liegenden Beduinen. Er bekommt keine Antwort. „Nicht, als du klein warst? Mir konnte meine Mutter nichts erzählen, weißt du. Sie ist gestorben, bevor ich sechs wurde. Dafür wusste ich in dem Alter schon über die Irgun Zwai Leumi Bescheid. Das waren keine Märchen. Auf dem Schoß meines Vaters hörte ich nichts von Sindbad, dem Seefahrer, sondern wie die Zionisten im April neunzehnhundertachtundvierzig das Dorf Deir Yassin überfallen und mehr als zweihundert von uns umgebracht haben. Männer, Frauen und Kinder. Deshalb sind wir Kassems von Mahad weggegangen. Mein Vater wollte nicht, dass es uns wie den Leuten von Deir Yassin erging … Hörst du mir überhaupt zu?“
Omar al-Khatib bleibt stumm.
Hassan Kassem späht durch das Fernglas. Er zählt. Zwei Gefährte schläft!
„He!“, fährt er ihn leise an. Er stößt mit dem Ellenbogen zu. Omar al-Khatib schreckt sofort hoch, umklammert seine Waffe und starrt zur Straße.
„Es sind zwei!“, sagt er und schiebt den Lauf nach vorn.
Die Information stammte von einem Vertrauensmann der „Qibya“, einem Vulkaniseur in Haifa, der eine Menge Verbindungen besaß. Er hatte in Erfahrung gebracht, dass an diesem Tag noch vor Morgengrauen ein Munitionstransport durchgeführt werden sollte. Sechzehn Tonnen Granaten, Patronen und Sprengmittel für die im Fort Metzudat Koah stationierte Einheit der israelischen Armee. Unter Vermeidung der viel befahrenen Strecke von Akko über Safad wollte man die Route über Nahariya benutzen. Der Vertrauensmann hatte mitgeteilt, dass die Israelis einen überschweren Lastkraftwagen benutzen würden. In seiner verschlüsselten Nachricht war die Rede von einem aus vier Kradfahrern bestehenden Begleitschutz. Ein zweites Transportfahrzeug hatte er nicht erwähnt.
Hassan Kassem späht durch das Fernglas. Er zählt. Zwei Kradfahrer. Ein offensichtlich bis zur Nutzlastgrenze beladener, überschwerer Armee-Lkw amerikanischen Ursprungs. Weitere zwei Kradfahrer. Und tatsächlich ein zweiter, sehr großer Dreiachser. Der Sandhase hat Augen wie ein Jagdfalke, denkt er, doch gleich darauf verfinstert sich seine Miene.
„Das ist kein Armee-Fahrzeug“, stellt er fest. „Ein Omnibus! Das ist ein dreimal verfluchter Omnibus!“
Es ist einer der neuen amerikanischen Großraumbusse. Viel Glas und Chrom. Eine Rundblickkanzel, Sanitär- und Klimaanlage. Im Heck eine kleine Snackbar. Seit einigen Wochen veranstaltet ein findiger Reiseunternehmer mit mehreren dieser Luxusmobile, in denen jeweils achtzig Personen bequem Platz finden, sogenannte Kreuzfahrten durchs Heilige Land. Die meisten Interessenten kommen aus Europa und den USA.
„Dieser Sohn eines Esels!“, flucht Hassan Kassem leise. Er meint den Fahrer des Busses, der nun mit Hupe und Scheinwerfer seine Überholabsicht signalisiert. Und die kleine Militärkolonne verringert wirklich die Geschwindigkeit. Omar al-Khatib kann das Geschehen auch mit bloßem Auge deutlich verfolgen.
„Allah allein hat Macht über alle Wesen“, murmelt er. „Und sie sind allesamt schuldig auf unserer Erde!“
Es überrascht Hassan Kassem, aus dem Mund seines Begleiters zwei zusammenhängende Sätze zu hören. Er wirft ihm einen erstaunten Blick zu, obwohl der geäußerten Meinung keiner aus der „Qibya“ widersprochen hätte. Wer nicht taub und blind war, der musste wissen, dass in diesem Land ein verbissener, heimtückischer und erbarmungsloser Krieg geführt wurde. Ein gnadenloser Kampf mit eigenen, grausamen Gesetzen. Anstelle der dem jüdischen Staat in der UNO-Empfehlung zugestandenen 56 Prozent des palästinensischen Territoriums hielten nun die israelischen Truppen schon seit 1949 fast 80 Prozent besetzt, den Westteil Jerusalems eingerechnet. Nahezu eine Million einheimische Araber hatten der Gewalt weichen müssen und waren über die Grenzen geflohen. Von 475 arabischen Dörfern standen nur noch 90. Die anderen waren niedergebrannt, gesprengt, unter Panzerketten zermahlen, von Planierraupen dem Erdboden gleichgemacht. – Auf der anderen Seite der unsichtbaren Front wurden Kinder jüdischer Siedler auf der Fahrt zur Schule von Minen getötet. Bomben trafen Poststationen, explodierten in Tanzlokalen, zerstörten Bahnlinien und Kibbuzeinrichtungen. Nichts davon blieb geheim. Die Zeitungen schrieben darüber. Alle Fernsehstationen sandten Filmberichte über das Maß der Zerstörungen und die Zahl der Opfer. Wer nach Palästina kam, der musste sich klar darüber sein, dass dieses Land von den Bergen Obergaliläas bis hinunter zur Spitze des Roten Meeres ein Schlachtfeld war.
„Aber Kinder sind unschuldig“, sagt Hassan Kassem. „Es können Kinder in diesem rollenden Touristenhotel sein.“
Er schaut wieder durch das Fernglas, sonst hätte er bemerkt, wie sein Gefährte geringschätzig den Mund verzieht. Gebannt beobachtet er das Überholmanöver. Er fühlt, wie ihm die Brust eng wird. Der Bus gleitet mühelos an dem Militärlastwagen und den Kradfahrern vorbei. Hinter den großflächigen Scheiben sind fast alle Plätze besetzt. Männer mit roten Gesichtern. Mädchen, die unter brusthoch gebundenen Sommerblusen straffe, kleine und reizvoll modellierte Bäuche zur Schau stellen. Drei, vier, fünf ältere Damen und Herren im unverwechselbaren leichtverlottert-trottelhaft wirkenden Air reiselustiger middle-class-pensioners aus Greater London, Cornwall oder Staffordshire.
Durch das Fernglas sichtet Hassan Kassem zwei Personen in der Rundblick-Kanzel. Ein dunkelhaariger Hüne im weißen Leinenanzug erklärt seiner sehr blonden Begleiterin die Landschaft. Einen Augenblick lang sieht es so aus, als ziele seine erhobene Hand direkt auf das Versteck der beiden Araber.
Vorn neben dem Fahrer des Busses stehen zwei Kinder. Sie tragen Golfmützen mit langen Schirmen, eine leuchtend rot, die andere grell gelb. Hassan Kassem vermag nicht auszumachen, ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt. Auf keinen Fall sind die Kleinen älter als zehn Jahre.
Der Bus fährt wesentlich schneller als die Militärkolonne. Der Abstand vergrößert sich mit jeder Sekunde. Die vorderen beiden Kradfahrer drosseln die Geschwindigkeit noch mehr, um aus der dichten hochgewirbelten Staubwolke des Überholers herauszukommen.
Der hervorragend gefederte Luxuskoloss rollt weich und in hohem Tempo auf die Stelle zu, wo die Minen liegen.
Noch dreihundert Meter, schätzt Hassan Kassem. Noch zweihundert, hundertfünfzig … Er weiß plötzlich, dass er die Explosion verhindern würde, wenn das jetzt noch in seiner Macht stünde. Diese Erkenntnis macht ihn wütend gegen sich selbst. Weshalb erinnert er sich in diesen Minuten nicht zuerst an seine Mutter? Kamil Kassems Frau war damals im Mai 1948 auf der Flucht durch die Berge so unglücklich gestürzt, dass einige Rippen brachen. Im Flüchtlingslager war während der ersten Tage kein Arzt aufzutreiben gewesen. Hassan hatte zusehen müssen, wie seine Mutter qualvoll an den inneren Verletzungen starb.
Warum quält ihn das Schicksal, das den beiden Kindern dort unten im Fahrerhaus des Busses droht, mehr als der Gedanke an seine Schwester Latifa? Im Elend des Lagers war das Mädchen knapp zwölf Monate nach der Mutter gestorben. Auch zwei inzwischen tätige Ärzte hatten es nicht verhindern können. Tuberkulose bei körperlicher Unterernährung. Ein entwurzelter, dürrer Kindeskörper, der keinen Widerstand mehr zu leisten imstande war. Mahad ist die Nahrung, ohne die wir nicht leben können. Großvater Kassem hatte ein zweites Mal rechtbehalten.
Hassan Kassem lässt das Fernglas los. Er kann jetzt auch ohne optische Hilfe erkennen, was unten auf der Straße geschieht. Seine Rechte umklammert den glatten Kolbenhals der Maschinenpistole, die andere Hand presst er gegen die Brust. Sein Herz dröhnt.
Hinter zusammengekniffenen Lidern glitzern im Gesicht Omar al-Khatibs schwarze, kalte Kristalle. Schweiß rinnt über seine hohlen Wangen. Er bewegt lautlos und kaum merklich die Lippen.
2. Kapitel
AN HERRN BERTEL BJOERKBORG / KILDEBY / MIKKELSEN-HOF
BESTELLTER PKW MODELL PORSCHE 911 T TERMINGEMAESS ABHOLBEREIT / ERBITTEN IHRE WEITEREN VERFUEGUNGEN / HOCHACHTUNGSVOLL STOETER / AUTOSALON 2000 / HOLSTEBRO
Am Abend hatte Radio Kopenhagen eine Sturmwarnung für die gesamte dänische Westküste ausgestrahlt und Windgeschwindigkeiten bis zu hundertzwanzig Kilometern in der Stunde angekündigt. Diese Voraussage bestätigte sich schnell. Während der ganzen Nacht trieb steifer Nordwest vom Limfjord her kalte Regenwände tief hinein nach Jütland. Auch gegen Morgen gab es noch keinerlei Anzeichen für ein Abflauen des Unwetters. Der April dieses Jahres legte es offenkundig auf einen rauen, nachhaltigen Einstand an.
Der Mann auf der Straße nach Holstebro schiebt sein Fahrrad. Jeder Meter macht ihm Mühe. Bis zur Stadt sind es noch knapp zwanzig Kilometer. Immer wieder treffen ihn Böen wie Knüppelschläge. Sein Gesicht brennt. Er hört im Brausen und Tosen des Wetters das Knirschen der Pappeln, die ihm von einem Hügel herab seltsame Signale zuwinken. Im Windschatten jener flachen Anhöhe wagt er noch einmal einen Versuch. Er steigt auf sein Rad und tritt die Pedale. Der Dynamo schnurrt lauter. Licht flackert über den nassen, spiegelnden Asphalt. Mann und Rad schaukeln im Rhythmus des zähen Wiegetritts. Der Gegenwind ist eine unsichtbare Wand. Ein paarmal scheint es, als balanciere er auf der Stelle. Trotzdem kommt er schneller voran als vorher zu Fuß. Das gilt freilich nur so lange, bis die Straße den Schutz des Hanges verliert. Schon der erste Windstoß wirft ihn dort mitsamt seinem Rad von der Fahrbahn. Hartes Aufschlagen nimmt ihm für Sekunden das Bewusstsein. Das Erste, was er danach spürt, ist frostige Nässe. Seine Füße sind eiskalt. Das im Straßengraben dahinströmende Wasser umspült seine Waden und fließt über die lockeren Schäfte in die Stiefel. Er greift in Gras und schmierige Erde. Seine Glieder gehorchen ihm schmerzlos. Keine Verletzungen. Lästig ist vor allem die bis hoch zu den Hüften an der Haut klebende, vollgesogene Manchesterhose.
Mit einiger Anstrengung zerrt der Mann das Rad aus dem Wasser. Er stellt zufrieden fest, dass alle beweglichen Teile funktionieren. Bis Holstebro hat er immer noch reichlich sechzehn Kilometer zu bewältigen. Für den Weg zurück braucht er dagegen, mit dem Wind im Rücken, sicherlich weit weniger als eine Stunde. Doch Umkehr kommt ihm nicht in den Sinn. Er zählt zu den Leuten, die einen Stein vorm Schleudern sehr lange und bedächtig in den Händen wiegen, dann aber, nach einmal gefasstem Entschluss zum Wurf, von nichts und niemandem wieder davon abzubringen sind. Von einem bestimmten Punkt an bewegte er sich seit eh und je außerhalb aller logischen Aspekte. Wenn die Frauen und Männer in seinem Heimatdorf Kildeby nach dem stursten Kerl zwischen Holstebro und Ringöbing gefragt worden wären, hätten ganz sicher die meisten von ihnen ohne geringstes Zögern seinen Namen genannt.
Bertel Björkborg arbeitete und lebte nahezu das ganze Jahr über draußen bei seiner Schafherde. Den zweiachsigen Wohnkarren, in dem er dort hauste, hatte einst sein Vater gemeinsam mit dem Schmied und dem Stellmacher des Dorfes aus eisernen Streben und Eichenbrettern zusammengebaut. Dieses nun schon fast sechs Jahrzehnte lang von allen Wettern geprüfte Gefährt war freilich inzwischen mehrfach gründlich überholt und mit mancherlei Komfort ausgestattet worden. Sachen, die der alte Schäfer nicht mehr kennengelernt hatte. Vermutlich wäre er auch nicht sehr begeistert davon gewesen. Es gab isolierte Wände, Propangas für Heizung, Beleuchtung und Kochherd, sogar einen batteriebetriebenen Fernsehapparat.
An diesem stürmischen Morgen ist Bertel Björkborg zeitiger als sonst aufgestanden. Er hat seine beiden Hunde Gnista und Läga gefüttert und dann auf den bestellten Aushelfer gewartet, der auch zum verabredeten Zeitpunkt kam und die Arbeit übernahm. Den Rat des Mannes aus dem Dorf, die Fahrt doch besser bis zum Abflauen des Sturmes zu verschieben, überhörte der Bewohner des Schäferkarrens.
„Morgen kommt Silke heim“, sagte er nur. „Wir feiern Geburtstag!“ Sein Helfer unterdrückte die Bemerkung, dass so eine Feier bei allem Verständnis für Vaterliebe kein Grund sein dürfte, das Leben zu riskieren. Er schwieg, weil er Bertel Björkborgs Eigensinn kannte.
Die wenigen Passanten in den Straßen der kleinen Handelsstadt Holstebro am Storafluss hasten gekrümmt unter den Gewölben dunkler oder bunter Regenschirme durch Pfützen und Rinnsale. Keine Zeit für Gespräche. Kein Wetter für freundliche Grüße. Missmutige Mienen auch hinter den Lenkrädern der Autos, die schmutzige Nässeschleier hinter sich herziehen.
Bertel Björkborg fährt dicht an der Bordsteinkante. Vor dem Hotel „Bel Air“, an dem er vorüberkommt, parken wie verloren drei Wagen mit deutschen Kennzeichen. Im Schaufenster eines Restaurants lockt appetitliches Smörrebröd, jene auf dutzenderlei fantasievolle Arten mit Garnelen, Lachs, Schinken, Eiern oder auch geräuchertem Aal belegten Brote, die zur dänischen Mittagsmahlzeit, der Frokost, einladen. Ein grauhaariger Kellner schaut durch die Scheibe, erkennt den Radfahrer und grüßt ihn mit respektvoller Verbeugung, die freilich unbemerkt bleibt.
Bei seinen Bekannten in Holstebro und bei den Leuten in Kildeby hatte schon Bertel Björkborgs Vater als Sonderling gegolten. Viele Jahre hindurch wäre man wohl jede Wette darauf eingegangen, dass der Schäfermeister Carsten Björkborg bis ans Ende seiner Tage ein Junggeselle bleiben würde. Ein freier Mann, enger mit dem Wind als mit den Menschen verbunden. Sommer wie Winter kümmerte er sich fast ausschließlich um die große Herde, zumal die gute Hälfte davon sein Eigentum war. Ins Dorf war Bertel Björkborgs Vater nur selten gekommen. In seinem Schäferkarren hing das Bild von König Christian X. neben dem in Lindenholz geschnittenem Spruch:
ICH GLAUBE AN DICH, MEIN GOTT. AUCH WENN ICH DICH OFT NICHT VERSTEHE. Er war froh darüber gewesen, dass sich das Königreich nicht in den Weltkrieg hatte ziehen lassen, er stimmte für die neue Verfassung und gegen das Frauenwahlrecht, das dann trotzdem eingeführt wurde, er schimpfte über den Verkauf der westindischen Kolonien an Amerika ebenso wie über die Loslösung Islands von der dänischen Krone, und er wäre ganz sicher ein sehr einsamer, verbitterter Mann geworden, wenn er nach einem Erntefest im Herbst 1918 irgendwo auf der Straße zwischen Baekmarksbro und Lemvig nicht das verwilderte Zigeunermädchen Viola getroffen hätte. Ein erbarmungswürdiges Geschöpf, kaum älter als sechzehn, siebzehn Jahre. Dürr wie ein Schilfrohr, braunhäutig und mit schwarzen Augen, in denen Furcht und Verzweiflung flackerten.
Carsten Björkborg nahm sie mit in seinen Karren, brachte ihr den Umgang mit Seife und Waschlappen, mit Kamm und Kleiderbürste bei, fütterte sie heraus und lehrte sie sanft die Einsicht, dass man Brot erst einmal backen muss, bevor man es schneiden kann. Zwei Monate später brauchte er bei den häuslichen Arbeiten nur noch hin und wieder mit Hand anzulegen. Viola besorgte die Einkäufe im Dorf, kochte und wusch. Jede freie Stunde verbrachte sie draußen bei ihm und der Herde. Vor allem den Lämmern galt dann im Frühling ihre besondere Fürsorge. Sie liebte die putzigen Vierbeiner wie eine Mutter ihre Kinder. Als der Ankäufer einige der Jungtiere für den Schlachthof abholte, weinte sie und sprach zwei volle Tage kein einziges Wort mit dem Schäfer.
Anfangs priesen die Dorfbewohner überschwänglich Carsten Björkborgs Barmherzigkeit. Überall war die Rede von dem Findelkind und von seiner Güte. Noch zu Neujahr lobte ihn der Pfarrer von der Kanzel herab als Beispiel christlicher Nächstenliebe. Die Dörflerinnen schnüffelten dabei gerührt in ihre Taschentücher. Doch die Sympathien schmolzen bald. Zu Ostern sah in Kildeby längst keiner mehr in dem Schäfer einen Wohltäter. Vielmehr gab es böse Worte. Erschien Viola im Dorf, steckten die Weiber eilig hinter dem Rücken des Mädchens die Köpfe zusammen, und die Männer zwinkerten einander zweideutig zu. Die junge Zigeunerin war in den Monaten zu einer von der Natur mit allen weiblichen Reizen reichlich beschenkten Jungfrau erblüht. Sie geisterte durch die Träume der Burschen, weckte bei manch einem Mittfünfziger bereits erloschen geglaubte Gelüste und säte Eifersucht unter die Ehefrauen. Warnende Stimmen erreichten den Schäfer. Zuerst lachte er darüber, dann betrachtete er seinen Schützling mit Männeraugen und spürte, dass ihn tatsächlich nicht nur väterliche Gefühle bewegten. So geschah Voraussehbares. Als Viola sich bald darauf schwanger fühlte, ging er mit ihr zum Traualtar, begleitet von missgünstigen Männermienen, vom Kopfschütteln seiner Freunde und vom Getuschel der Frauen des Dorfes.
Kurz vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1919 gebar die junge Frau des Schäfermeisters in dem auf einem Hügel abseits des Dorfes gelegenen und weithin sichtbaren Schafstall einen Sohn.
Die ersten irdischen Geräusche, die den kräftigen Knaben empfingen, waren ein wilder, lang gezogener Schrei seiner Mutter, das heisere Kläffen der aufgeschreckten Hunde und dumpfes Geblök der Herde. Der Vater wusch das Neugeborene und hüllte es in weißen Flanell, umsichtig und liebevoll, wie es keine Hebamme fürsorglicher hätte tun können. Die Wöchnerin erholte sich ungewöhnlich schnell. Sie nährte den Sohn an ihrer Brust über den Winter hinweg; doch als der Kleine im Frühsommer in seinem Gatter neben dem Schäferkarren nach Schmetterlingen zu grapschen begann, war sie nicht mehr da.
Die Skeptiker in Kildeby sollten recht behalten. Ein Stall und ein Schäferkarren in Jütland sind keine Plätze, an denen heißes Blut abkühlt.