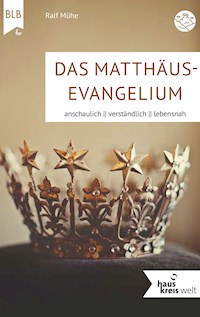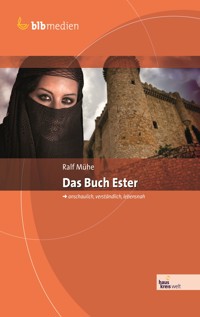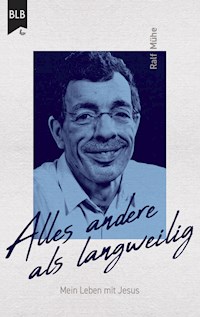
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Können Sie sich vorstellen, dass jemand in einer fremden Stadt ohne technische Hilfsmittel an ein unbekanntes Ziel navigiert wird? Ralf Mühe hat Gottes Führung in dieser Weise erlebt. Auch in anderen heiklen Situationen stand Gott ihm bei: als man ihn mit Waffengewalt erpressen wollte, als er einen flüchtigen Ehemann suchte oder immer, wenn er in der Seelsorge um Antworten rang und mit dämonischen Mächten konfrontiert wurde. Zum Lebensweg des Autors gehören ebenso einschneidende Prüfungen. So verlor er zeitweise Gott aus dem Leben. Er begleitete seine Ehefrau auf ihrer letzten Wegstrecke und sein Ruhestand begann mit einer schweren Erkrankung. Dennoch bleibt er zuversichtlich und verliert nicht den Humor. Darin unterstützt ihn seine neue Liebe, die er nach dem Tod seiner Frau fand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Mühe
Alles andere als langweilig
Mein Leben mit Jesus
www.bibellesebund.net
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 Bibellesebund Verlag, Marienheide
© 2022 der E-Book-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://www.bibellesebund.de/
Autor:Ralf Mühe
Lektorat: Iris Voß
Titelfoto: © Ralf Mühe
Titelgestaltung: Luba Ertel
Fotos Innenteil: © Ralf Mühe
Layout des E-Books: Inge Neuhaus
Bibeltexte:
Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Lutherbibel, revidiert 2017 © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Neue Genfer Übersetzung © 2011 Genfer Bibelgesellschaft, mit freundlicher Genehmigung.
Printausgabe: ISBN 978-3-95568-479-2
E-Book: ISBN 978-3-95568-485-3
Hinweise des Verlags:
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes und der Bilder kommen.
Noch mehr E-Books des Bibellesebundes finden Sie auf
https://ebooks.bibellesebund.de/
Inhalt
Titel
Impressum
Warum mich dieses Buch begeistert
1. Nur ein Unfall auf der Couch?
2. Eine neue Art zu leben
3. Willst du ab jetzt ohne Gott leben?
4. Wasserwerfer und Tränengas
5. Einsatzleitstelle an Jesus Christus
6. Berufung mit Hindernissen
7. Ausbildungszeit in der Schweiz
8. „Ihr Kind wird nie laufen können“
9. „Verflucht sei Jesus, verflucht, verflucht!“
10. Ich werde ihr den Hals umdrehen
11. Amulett und Diebesgut
12. Herausfordernde Fragen des Lebens
13. Absturz vom Balkongeländer
14. Für einen Judas singen wir nicht
15. Vom Himmel her navigiert
16. Skurriles im Dienst
17. Geistliche Krisen
18. Begegnungen mit Muslimen
19. Gottes Sackgassen sind durchlässig
20. Freiheit von okkulten Bindungen
21. Pleiten, Pech und Pannen
22. Veränderungen
23. Ein Jahr des Leidens
24. Auf dem Weg zur Ewigkeit
25. Umbruch und Neuausrichtung
Warum mich dieses Buch begeistert
Als mich Ralf Mühe nach einer Rezension für das vorliegende Buch fragte, musste ich nicht lange überlegen, um zuzustimmen. Wir kennen uns seit Jahren durch gemeinsame Freizeiten und Begegnungen, die zu einer langjährigen Freundschaft führten.
Um es vorweg zu sagen: Das Lesen seines Buches ist „alles andere als langweilig“. Es ist ein typisches Ralf-Produkt: durch und durch ehrlich und authentisch, aber auch geistlich-theologisch tiefgründig und aussagekräftig. Seine Lebenserfahrungen sind fest verankert in der Bibel und machen Mut, das Wort Gottes ernst zu nehmen und immer wieder nach seinem Wahrheitsgehalt zu fragen, um es dann im eigenen Leben anzuwenden. Hier kommt seine Gabe zu lehren zum Vorschein, aber auch sein evangelistisches Herz, das die Begegnung mit Jesus jedem Menschen wünscht. Hin und wieder wehte mir auch der Hauch „urchristlichen Gemeindelebens“ entgegen, wenn Ralf von seinen Kämpfen mit geistlichen Mächten berichtet. Uns beide verbindet darüber hinaus eine große Übereinstimmung in geistlichen Erkenntnissen. Bewegend und „typisch Ralf“ ist seine Offenheit, mit der er seine Unfertigkeit, sein Versagen, seine Fragen und Zweifel zur Sprache bringt. Das macht nicht nur dieses Buch, sondern auch ihn selbst sehr sympathisch. Beim Lesen der letzten Kapitel über die Begleitung seiner sterbenden Frau sind mir mehr als einmal die Augen feucht geworden. Ich vermute, dieses schwere Ereignis wird viele Leser trösten, weil Gott uns Menschen nicht allein lässt, wenn es ans Sterben geht (Psalm 23,4-5).
„Alles andere als langweilig“ beschreibt ein Leben, das Gott für sich beschlagnahmt hat und in dem man deutliche Spuren seines Wirkens und Segens erkennen kann, wie es David in Psalm 23,5-6 ausdrückt. Ich bin sicher, dass viel Segen durch dieses Buch in das Leben von Menschen fließt, und wünsche ihm darum eine weite Verbreitung.
Werner Röhle, Pastor der FeG Neustadt in Holstein
* * * * *
Ralf Mühe beschreibt in seinem Buch geradezu unglaubliche Begebenheiten aus seinem Leben mit Gott. Manche können unwahrscheinlicher nicht sein, und doch sind sie wahr. Schonungslos und detailliert lässt er uns an seinen Erlebnissen teilhaben und in wohlgesetzten Kurzepisoden nimmt er uns mit auf seine spannende Lebensreise.
„Alles andere als langweilig“ ist ein Titel, der zwar gut passt, aber eher untertrieben wirkt. Zwischen okkulten Erfahrungen und dem Glauben an Jesus Christus, zwischen echten Wundern und schierer Verzweiflung, zwischen Alltagsgeschehen und Ausnahmesituationen wechseln seine Lebens- und Familienthemen auf den Seiten dieses Buches. Dabei erspart er dem Leser erschütternde Situationen nicht, sieht sie aber immer in seinem grenzenlosen Vertrauen in Jesus Christus und die Bibel als Gottes Wort.
Ralf Mühe drückt sich als erfahrener Autor und Kolumnist nicht nur exzellent aus, sondern würzt seine Episoden gerne mit dem für ihn eigenen Humor. So ist dieses Buch das, was es auch sein soll: „alles andere als langweilig“, und damit eine echte Empfehlung für jeden Leser!
Sabine Czilwa, Personal Coach und langjährige Freundin der Familie
1. Nur ein Unfall auf der Couch?
Es ist erstaunlich, wie weit Erinnerungen zurückreichen, wenn sie auf eindrücklichen Impulsen basieren. Zu ihnen gehörten die Erzählungen meiner Mutter über ihre Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs. In den ersten zehn Jahren unserer Kindheit schliefen wir zu dritt in einem Zimmer: meine zwei Jahre ältere Schwester, meine Zwillingsschwester und ich. Elf Jahre später kam eine weitere Schwester als Nachzüglerin zur Familie. Zu dieser Zeit waren Fernsehgeräte noch rar. Wir jedenfalls besaßen keines. Aber wir hatten das Privileg einer sehr viel lebensnäheren Alternative. Wenn es ihre Zeit erlaubte, legte sich Mutter zu uns ins Bett. Wir kuschelten uns um sie herum und boten ihr als aufmerksame Zuhörer eine willkommene Bühne für ihre Geschichten.
Wir mochten immer wieder hören, was sie damals bewegt hatte und beim Mitteilen ganz sicher auch verarbeitete. War sie doch auf der Flucht vor einem der zahlreichen Bombenangriffe alliierter Fliegerverbände auf die BASF bei Ludwigshafen in einen Bombentrichter gestürzt. Dabei hatte sie sämtliche Schneidezähne eingebüßt. Unsere kindliche Anteilnahme war ihr gewiss. Der Urgroßvater hingegen blieb bei solchen Gelegenheiten seelenruhig in seiner Wohnung. „Wenn der Herrgott es will, dann bleibe ich am Leben“, argumentierte er schicksalsergeben.
Was wäre aus uns Kindern geworden, wenn Mutter in dieser schlimmen Zeit ums Leben gekommen wäre? Hätten wir zwar den Vater, aber statt ihr eine andere Person als Elternteil? Würden wir überhaupt existieren? Mit Fragen wie diesen quälte ich sie und mich.
In dieser unruhigen Lebensphase des Krieges registrierte Mutter mit hoher Sensibilität die Unruhe beim Stubenvogel oder bei Katzen als Vorwarnung auf nahende Bombengeschwader. Darüber hinaus verfügte sie über hellseherische Fähigkeiten. Sie erkannte hin und wieder bildhaft, welcher Teil der Straße oder des Hauses durch die tödlichen Lasten aus der Luft zerstört werden würde. Dementsprechend änderte sie die Laufrichtung ihrer Flucht. Man bezeichnete sie deshalb halb im Scherz als Prophetin. Über die Quelle dieser Fähigkeit hat sich meines Wissens niemand Gedanken gemacht. Was für Menschen von Nutzen ist, kann doch nicht vom Bösen sein, ist eine durchaus gängige, aber irrige Ansicht.
Es blieb nicht bei diesen übersinnlichen Erfahrungen. Mutter kam in Kontakt mit einer Spiritistin, in deren Augen sie gläsern zu sein schien. Die Fremde war in der Lage, persönliche Lebensdaten und Fakten zu nennen, die Mutter ihr niemals mitgeteilt hatte. Davon neugierig geworden, ließ Mutter sich zu Sitzungen einladen, bei denen Frauen versuchten, durch Geist etwas über den Verbleib des Mannes, Bruders oder Vaters an der Front oder in Gefangenschaft zu erfahren.
Für den Gewinn an Wissen aus solchen okkulten Quellen bezahlen Menschen in der Regel einen hohen Preis. Im Laufe meiner Dienstjahre hatte ich mehrfach Personen in der Seelsorge, die sich auf solche geistlichen Abwege eingelassen hatten. Doch Gott hat zum Schutz seines Volkes solche Abwege ausdrücklich verboten:
Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch geben wird, dann hütet euch, die abscheulichen Bräuche seiner Bewohner zu übernehmen. Keiner von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keine Wahrsager und Wahrsagerinnen unter euch dulden, niemand, der aus irgendwelchen Zeichen oder mit irgendwelchen Praktiken die Zukunft voraussagt, auch niemand, der Zauberformeln benutzt und damit Geister beschwört oder Tote befragt. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Genau wegen dieser Dinge vertreibt der Herr die Bewohner des Landes vor euch. Der Herr ist euer Gott; ihm sollt ihr ganz und ungeteilt gehören.
(5. Mose 18,9-13 GNB)
Häufig zeichnet sich bei den Personen durch Grenzüberschreitungen zur jenseitigen Welt ein destruktiver Lebensverlauf ab. Sie werden von Unruhe, Depressionen und einer gegenüber Gott feindlichen Grundhaltung geplagt, die sie gefangen halten. Es benötigt ein bewusstes Abwenden und Lossagen, um dem Dunkel zu entrinnen. Das habe ich bei Ratsuchenden mehrfach beobachten dürfen. Aber leider nicht bei meiner Mutter. Bei ihr traten diese Folgen mit zunehmendem Alter stärker auf. Meine Kinder kannten ihre Oma nur mit diesem leeren Blick der Teilnahmslosigkeit.
Im Jahr 1954 kannte man noch keine Ultraschallgeräte. Als Zweiter von Zwillingen war ich bei der Hausgeburt für meine Eltern also eine echte Überraschung. Mit mir hatten sie nicht gerechnet. Und ich erfuhr es, wann immer sich durch den Alkohol die Zungen gelöst hatten. Der Satz „Eigentlich haben wir die Nachgeburt erwartet, doch dann kam Ralf“ wurde für die Gäste in unserem Wohnzimmer zum ultimativen Schenkelklopfer. Getoppt wurde er durch die gezielte Indiskretion, dass meine Zwillingsschwester und ich eigentlich nur ein Unfall auf der Couch gewesen seien. Ich hörte es und versteckte mich voller Scham hinter einer Gardine.
Verdankte ich mein Leben tatsächlich nur einer Achtlosigkeit? Der Gedanke, rein zufällig auf dieser Welt zu sein, weckte in mir das Gefühl des Ungeborgenseins und beschäftigte meine Gedanken. Ich hatte Fragen zum Beginn und Ende des Lebens, auch wenn ich sie noch nicht gezielt in Worte fassen konnte. Mir ist noch gut in Erinnerung, wie ich erschrak, als Mutter einmal an unseren Betten „Guten Abend, gut’ Nacht“ von Johannes Brahms sang. Da heißt es im Refrain: „Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.“
„Was ist, wenn Gott nicht will?“ Ich war zutiefst beunruhigt. Gab es eine Instanz über uns, die darüber bestimmte, ob und wie lange wir leben? Meine Mutter reagierte auf meine Frage sichtlich überfordert. „Ach, er wird schon wollen!“, meinte sie schroff. Ich spürte deutlich ihre Verunsicherung. An diesem Abend versuchte ich vergeblich, das Einschlafen zu verhindern, indem ich lange Zeit krampfhaft die Augen offen hielt.
Bei einem Ausflug auf den Bauernhof versuchte ich im Alter von etwa sieben Jahren zu ergründen, wie Tiere mit der Tatsache des Todes umgingen. Da wir in der Familie nie darüber sprachen, beschloss ich, es mit den Kühen im Stall zu tun. Ich vergewisserte mich, dass mir niemand sonst zuhörte, und brüllte ihnen die äußerst beunruhigende Nachricht zu:
„Ihr werdet alle geschlachtet!“
Zu meiner Verblüffung mahlten die Wiederkäuer ihr Futter unberührt zwischen den Zähnen weiter. Mich packte dennoch das schlechte Gewissen, deshalb eilte ich kurze Zeit später erneut in den Stall. Diesmal mit einer Trostbotschaft.
„Ich habe mich erkundigt. Es dauert noch, bis ihr geschlachtet werdet. Gebt erst mal reichlich Milch!“ Erneut bekam ich keinerlei Reaktion. Ich beneidete die Tiere um ihre völlige Gelassenheit.
Die Frage nach Leben und Tod brach im sechzehnten Lebensjahr erneut mit ganzer Kraft auf. Vertreter der Zeugen Jehovas klingelten an der Tür und fragten, worauf ich die Ursprünge dieser Welt zurückführte. Sie erläuterten mit knappen Worten das gedankliche System der Evolution und klärten mich darüber auf, wovon sie aufgrund der Bibel und ihrer Zeitschrift „Der Wachtturm“ überzeugt waren. Ich folgte der Einladung zu den Treffen im Königreichssaal. Bis heute bin ich von deren gästeorientierter Freundlichkeit beeindruckt. In dieser Weise habe ich das bei evangelikalen Gemeinden eher selten erlebt. Bei ihren anschließenden Schulungen beobachtete ich, wie sie gründlich ein gewinnendes Auftreten bei Hausbesuchen in Rollenspielen einübten. Ein innerer Funke flog – Gott sei es gedankt – nicht über.
In der griechischen Sprache des Neuen Testaments gibt es den alles bestimmenden Zeitpunkt in der Vergangenheit, dessen Bedeutung bis in die Gegenwart hineinstrahlt. Es ist der Kairos. Für mich fiel er auf den Herbst 1971. Da traf ich auf dem Gehweg vor der Handelsschule mit Johanna zusammen, die für zweiundvierzig Jahre meine Ehefrau werden sollte. Ich kannte sie nur vom Sehen: eine kleine, quirlige Frau mit gewinnendem Lachen. Ebenso flüchtig waren mir einige andere bekannt, die mit ihr zu einer Veranstaltungsreihe einluden. Ein kurzer Blick auf die Themen des Flyers reichte, um mein Interesse zu wecken. Da wurden Vorträge über Gott und das ewige Leben angekündigt. Ich war davon geradezu elektrisiert. Intuitiv erfasste ich, dass ich etwas in Händen hielt, was mir eine neue Ausrichtung vorgeben würde. Zu Hause saß ich allein am Mittagstisch und studierte das Druckwerk. Unter „Stadtmission“ als Veranstalter konnte ich mir überhaupt nichts vorstellen. In meiner Kernfamilie waren wir katholisch sozialisiert. Alles außerhalb der etablierten Kirchen betrachteten wir als Sekte. Mich focht es aber nicht weiter an.
Die Vortragsreihe eröffnete mir neue Horizonte. Hier sprach man über Gott und den Tod und was ihm folgte. Über all das wurde in der Familie nicht gesprochen. Religiöses Vokabular verwendete man schon gar nicht. Es sei denn im bewussten Tabubruch beim Fluchen, um dem Ärger Luft zu verschaffen.
Ein erster Schritt zum Glauben war die Überzeugung, dass es Gott geben musste. Trotz religiöser Unterweisung war er in meiner Wahrnehmung kaum mehr als ein Wort. Er stand für intensive Langeweile und Zwänge. Dagegen lehnte ich mich auf, zumal meine Eltern den Glauben selbst nicht praktizierten. Sie forderten hingegen von uns die formale Religionsausübung, weil es so üblich war. Im Jahr vor dem Empfang der ersten Kommunion waren wir am Sonntag zum Kirchgang verpflichtet. Ich entschied mich betrügerisch für die Frühmesse. Sie fand zu einer Zeit statt, in der die meisten Menschen noch schliefen. Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Kirche, steckte als Alibi das für den betreffenden Sonntag ausliegende Faltblatt ein und radelte weiter zu den Rheinauen von Frankenthal. Dort beobachtete ich Fasane oder bestaunte die schwer beladenen Frachtschiffe. Wenn meine Schwestern zur besten Zeit des Tages maulend den Besuch der Messe zu umgehen suchten, galt ich ihnen als tugendhaftes Vorbild. Religiöser Druck ist eben dazu geeignet, Scheinheilige hervorzurufen.
Die Vortragsreihe in der Stadtmission hatte ein anderes Format als die ritualisierten Abläufe der heiligen Messen, wie ich sie als Kind empfand. Was an Themen dargeboten wurde, warf Fragen auf, über die es sich nachzudenken lohnte. Nach dem Abschluss jener Woche hielt ich mich zum Jugendkreis der Stadtmission in Frankenthal. Hier erlebte ich ein fröhliches und respektvolles Miteinander. Wohltuend spürte ich die andere Qualität in der Ausrichtung der Aktivitäten. Im Rückblick empfinde ich diese Jahre als einen zwar nicht unbeschwerten, aber doch glücklichen Ausklang meiner Jugendzeit.
Wenige Wochen nach diesem Event lud Johanna mich zu einer Jugendkonferenz der Bibelschule Seeheim ein. Das im Odenwald gelegene ehemalige Schlösschen bot für dieses Wochenende ein einzigartiges Ambiente. Ich erinnere mich an kaum mehr als an die simultan übersetzte Predigt eines amerikanischen Verkündigers von „Greater Europe Mission“. Er vermittelte nicht nur biblische Wahrheiten, sondern veranschaulichte Gottes Realität an praktischen Erfahrungen seines Alltags. Damit gewann er meine ganze Aufmerksamkeit. Jesus im täglichen Leben? Nie zuvor war mir Derartiges zu Ohren gekommen. Beten um einen Parkplatz im Großraum Paris? So praktisch konnte Glaube gelebt werden! Der Prediger forderte dazu auf, Jesus als Herrn anzunehmen. Wer bereit war, sollte das mit einem Handzeichen anzeigen. Ich zögerte, weil ich annahm, mich auf diese Weise auffällig zu verhalten. Auf keinen Fall wollte ich Johanna in Verlegenheit bringen. Ich konnte ja dankbar sein, dass sie mich zu diesem Treffen mitgenommen hatte. Schließlich war das Verlangen, Gott kennenzulernen, doch größer. Ich nahm mir vor, Johanna später um Verzeihung zu bitten, und reckte den Arm. Mit anderen, die wie ich Gott kennenlernen wollten, gab es ein Gespräch. Vieles wurde erklärt, was ich nicht annähernd verstand. Sündenerkenntnis hatte ich jedenfalls keine. Als man mich aufforderte, Jesus im Gebet zu sagen, dass ich mit ihm leben wolle, hatte ich keine Ahnung, wie das gehen sollte. Frei zu beten war mir unbekannt. Der Schweiß lief aus allen Poren, als ich es irgendwie doch schaffte. Ich bin ziemlich sicher, dass sowohl die Formulierung als auch die Grammatik das Unterirdischste gewesen sein muss, was je an Gottes Ohr gedrungen ist. Aber es kam aus dem tiefsten Verlangen. Das zählte. Und es genügte, um Christ zu werden. Meine ersten geistlichen Schritte begleitete Werner Meier, der mir bei der Entscheidung zum Glauben zur Seite gestellt wurde. Ein wunderbarer Mensch, der mich aushielt, denn er hatte die Geduld eines Westfalen, die mit seelsorgerlichem Gespür gepaart war.
Die Freunde aus dem Jugendkreis überhäuften mich aufgrund der Entscheidung mit Glückwünschen. Als hätte ich Geburtstag, wurde ich sogar mit Büchern beschenkt. Über ihre Freigebigkeit konnte ich nur staunen. Als ich am Abend dieses Tages im Bett lag, empfand ich einen Frieden, wie ich ihn nie zuvor erlebt hatte. Neues hatte begonnen. Im Rückblick empfinde ich, dass damit meine erste Lebensphase, und zwar jene ohne Gottesbezug, zu Ende gegangen war.
Vom Tag meiner Jesus-Nachfolge an besaß ich eine Bibel. Sie hatte ich mir mehrere Wochen zuvor gekauft, um beim Propheten Hesekiel in Kapitel 1 die angebliche Landung Außerirdischer auf der Erde nachzulesen. Mit dieser steilen Behauptung hatte der Autor Erich von Däniken von sich reden gemacht. Seine Bücher gab ich einige Zeit später zum Altpapier, ohne diesen Schritt je bereut zu haben. Doch die Bibel blieb. Sie hatte ich bis dahin mehrfach vergeblich versucht, mit Gewinn zu lesen. Ein Telefonbuch wäre sicher kaum weniger spannend gewesen. Enttäuscht verstaute ich sie außer Sichtweite zwischen Kleidungsstücken im Schrank. Immerhin glaubte ich nach dem Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses zu wissen, dass Jesus mit Nachnamen „Sirach“ geheißen hat, denn in der katholischen Bibel gibt es das Buch „Jesus Sirach“.
Mit der Hinwendung zu Gott öffnete sich mir der Inhalt der Bibel derart überwältigend, dass ich sie öfter nicht zu Hause, sondern in der freien Natur las. Dort konnte ich das Gelesene laut noch einmal lesen oder innerlich berührt in Jubel ausbrechen.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.
(Johannes 11,25-26 LUT)
Diese Sätze trafen auf die offenen Fragen meiner Kindheit. In einem anderen Kernsatz fand ich treffend die aktuelle Befindlichkeit beschrieben:
So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind.
(Hebräer 2,15 GNB)
Kernsätze wie diese ließ ich meine jüngste Schwester auswendig lernen. Sie war damals gerade mal 7 Jahre alt. Als mein Vater bemerkte, dass ich sie im Glauben unterwies, verbot er es. Dennoch: Der gute Same war gesät. Einige Jahre später traf sie kurz nach ihrer Krebs-Diagnose die Entscheidung, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Ein zweisitziger Smart der Organisation Pro Christ stand als „Kleinste Kirche der Welt“ am Bahnhof von Neustadt an der Weinstraße. Dort bat meine Schwester um Gebet und erhielt Hoffnung für ihre schwierige Situation. Als sie 2016 mit einundfünfzig Jahren allzu früh starb, wusste sie sich in Gottes Hand geborgen.
Ankunft im Doppelpack:Ralf (links) als Überraschung mit seiner Zwillingsschwester im Alter von 6 Monaten
Als Hahn im Korb im Alter von 4 Jahren
1959
1959
Im Kindergarten mit der Zwillingsschwester
Mit dem Kaspertheater entfaltete sich die Leidenschaft des Erzählens.
Im ersten Schuljahr, 3. Reihe von vorne, 2. Kind von rechts
Die Zeit des Tricksens und Betrügens
Mit auf dem Foto die 11 Jahre jüngere Schwester.Ihr brachte Ralf Kernverse der Bibel durch Auswendiglernen bei.
2. Eine neue Art zu leben
Ich begann, an Sonntagen den Gottesdienst der evangelischen Kirche zu besuchen. Es gab dort einen älteren Mann, mit dem ich meinen frischen Glauben teilen konnte. Er beeindruckte mich mit seiner ungekünstelten Glaubenszuversicht.
„Wenn du einmal hörst, dass ich gestorben bin“, sagte er einmal, „dann sei nicht traurig. Ich werde am Ziel sein. Und es wird mir besser gehen als je zuvor.“ Das waren Worte, die ankamen.
Wenige Monate, nachdem ich zum Glauben an Jesus gefunden hatte, traf ich die Verlobte meines westfälischen Mentors. Sie registrierte erfreut die sichtbare äußerliche Veränderung. Statt mit langen Haaren und Stirnband trat ich ihr mit einem sogenannten ordentlichen Haarschnitt entgegen. Sie versuchte, ihre Beobachtung durch ein Bibelzitat zu kommentieren, konnte aber die Textstelle nicht finden. Doch dazu später mehr. Das Leben mit Jesus hatte nun für mich Priorität, offensichtliche Eitelkeiten verloren an Bedeutung. Auch gefährliches Imponiergehabe war Schnee von gestern. Ich verkaufte das Motorrad, durch das ich mit waghalsiger Fahrweise aufzufallen hoffte, und fuhr fortan mit einem Klapprad.
Der Wandel zur neuen Lebensweise kam von innen, und zwar ohne moralische Imperative. Bis dahin waren mir bei dem Versuch, meinen Platz in dieser Welt zu finden, von klein auf alle Mittel recht. Es war mir geschenkt, mir das Lesen, Rechnen und Schreiben selbst beibringen zu können. Dadurch versäumte ich allerdings die Methode des schulischen Lernens. Dieses Defizit behielt ich bis ins Erwachsenenalter. Die Folgen mangelnder Leistungen zeichneten sich bereits ab der vierten Klasse ab und verstärkten sich auf dem Gymnasium. Ich versuchte, sie durch Betrügereien zu verdecken. Von den guten Benotungen der ersten Jahre verwöhnt, wollte ich die Realität einfach nicht akzeptieren. Schließlich war sogar die Versetzung gefährdet. Sie wurde durch den gefürchteten „blauen Brief“ des Klassenlehrers den Eltern mitgeteilt. Ich hatte jedoch die Post abgefangen, ehe sie meine Eltern erreichte. In langen Nachtstunden trainierte ich das Fälschen von Unterschriften. Mit meinen zweifelhaften Fertigkeiten führte ich Eltern und Lehrer hinters Licht. Den väterlichen Schriftzug kopierte ich zu Beginn mit Kohlepapier, das ich für meine Zwecke Lottoscheinen entnommen hatte. Oder ich ahmte die Signaturen so oft nach, bis ich sie perfekt beherrschte und Mitteilungen selbst unterschrieb. Niemand bemerkte etwas. Ähnlich verfuhr ich bei Klassenarbeiten. Ich erstellte sie komplett neu, versah sie mit Bemerkungen, als seien sie vom jeweiligen Fachlehrer, und ahmte auch dessen Schrift nach. Die Machwerke mit den scheinbar guten Zensuren präsentierte ich den Eltern. Das geschah stets mit der inneren Anspannung, entdeckt zu werden. Das böse Ende musste für sie deshalb völlig überraschend kommen. Wieso wurde ich trotz der angeblich guten Zensuren nicht versetzt? Weder die Lehrer noch die Eltern gingen der Sache auf den Grund. Ich führte die Erwachsenen zwar erfolgreich hinters Licht, aber die Konsequenzen musste ich dennoch tragen. Ich wurde zweimal nicht in die nächste Klasse versetzt.
Es gab ein Fach, bei dem ich stets hervorragend abschnitt. Beim Deutschunterricht behauptete ich mich in allen Schulformen mit Aufsätzen an der Spitze. Ich investierte in diese Stärke. Tat sie doch meinem angegriffenen Selbstwertgefühl gut. Während der gymnasialen Zeit durfte ich jeweils am Samstag vorlesen, was ich geschrieben hatte. Das Lachen der Mitschüler, das Lob der Lehrerin, aber mehr noch der Selbstanspruch motivierten da ungemein. Wieder einmal wurde ich zum Vorlesen aufgefordert. Da mein Ego nach Bestätigung lechzte, begann ich, die verfasste Geschichte durch eine sehr viel bessere aus dem Stehgreif zu ersetzen. Ich fabulierte, wie Piraten ein Passagierschiff überfielen. Aus Mangel an Kugeln steckten sie ihre eigenen Leute ins Kanonenrohr und schossen sie in die Kajüte ahnungsloser Schläfer, auf den Tisch der Bordküche, gegen die Beine des Kapitäns … Die Variationen an Komik entflossen mühelos meiner blühenden Fantasie. Das vergnügliche Gewieher der Klasse brachte mich „beim Vorlesen“ in Fahrt. Dann aber verhaspelte ich mich.
„Wiederhole doch bitte noch einmal den letzten Satz!“, forderte die Lehrerin auf. Dazu war ich natürlich nicht exakt in der Lage. Sie nahm das Heft aus meiner Hand und suchte eine gefühlte Ewigkeit lang jenen Text, den es gar nicht gab. Ihre Reaktion war bemerkenswert. Sie richtete einige Bemerkungen an die Klasse, dann wandte sie sich mir zu:
„Eigentlich müsste ich dich jetzt bestrafen“, sagte sie. „Aber ich kann dich verstehen – das Gleiche habe ich auch mal gemacht.“ Entlarvt und tief beschämt kehrte ich wieder an den Sitzplatz zurück.
Als Teenager hatte ich einen Freund, Jürgen, der politisch sehr interessiert war und sozialistisches Gedankengut vertrat. Gemeinsam besuchten wir etliche Wahlkampfveranstaltungen. Bei einer Gelegenheit kamen wir bis auf wenige Meter in die Nähe von Willy Brandt. Der Politiker scherzte, dass Gott die SPD wählen würde, denn schließlich hätte er auch das menschliche Herz etwas links von der Mitte platziert. Mich faszinierten Jürgens Sprachgewandtheit und seine Bereitschaft, für sein vorlautes Mundwerk Prügel einzustecken. Ich sah es als meine Pflicht an, ihm beizustehen, und zwar mit den Fäusten. Wenn ich zuschlug, dann überraschend und heftig, um nach Möglichkeit jegliche Gegenwehr im Keim zu ersticken. Bei den Türken hatte ich schlechte Karten. Sie bildeten eine Solidargemeinschaft, gegen die ich nicht ankam. Also rüstete ich auf und trug eine kurze Zeitspanne lang illegale Waffen bei mir. Es handelte sich um einen Schlagring und eine durchbohrte Gaspistole. In den Taschen meiner Lederjacke gab es dennoch Platz für ein kleines Neues Testament mit Psalmen. Darin las ich, sooft es mir möglich war. Letztlich entpuppte sich das Druckwerk im blauen Schutzumschlag aus Plastik als starke Kraft. Durch seinen Einfluss entschied ich mich dazu, Gott „im Angesicht meiner Feinde“ den Schutz zu überlassen (Psalm 23,5). Ich entsorgte den Schlagring und die Pistole. Ebenso trennte ich mich von Jürgen, dessen Spott über meine Frömmigkeit unerträglich wurde. Der Wandel meines Lebens hatte eine erstaunliche Dynamik. Nichts geschah auf menschlichen Druck hin, sondern in Übereinstimmung mit meinem Willen. Der Apostel Paulus beschreibt das Phänomen so:
Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon „neue Schöpfung“. Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen.
(2. Korinther 5,17 GNB)
Nach dieser Aussage hatte übrigens die Verlobte meines Mentors vergeblich in der Bibel gesucht. Die Verbindung zu Gott ließ mich ihn als Realität erkennen und als Herrn über mein Leben anerkennen. Sie veränderte auch Lebenshaltungen. Die entsorgten Waffen sind Belege, die mich mit Stolz auf die Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Ihre Wirkung kam als Prozess von innen heraus im Gleichklang mit meiner Persönlichkeit. Da war eben nicht der moralische Druck, der von außen durch Menschen an mich herangetragen worden wäre, wie ich ihn bei der kirchlichen Sozialisierung erlebt hatte.
Es dauerte nicht lange, da entdeckte ich einen weiteren Mehrwert des christlichen Glaubens. Ich fand ihn im Johannesevangelium, wo es heißt:
Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. – Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt.
(Johannes 1,12-13 GNB)
Und damit begann ich das Lesen der Bibel.
Wenn es zutrifft, dass die Existenz meiner Zwillingsschwester und mir auf menschlicher Unachtsamkeit beruht, so steht eines doch fest: Bei Gott sind wir gewollt! Durch das „Ja“ des Glaubens gehöre ich nun zu Gottes Familie. Auch meine kindliche Sorge, was aus uns Kindern geworden wäre, wenn Mutter im Krieg das Leben verloren hätte, fand eine Antwort. Ich gebe zu, sie ist nicht von der Art, die wir mit dem Verstand begreifen können. Die Beziehung zu Jesus eröffnet eine andere Ebene des Erkennens. Sie lässt sich mit Mitteln der Logik nicht beweisen, aber als unumstößliche Gewissheit bezeugen.
Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören; in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen.
(Epheser 1,4 GNB)
Die Fragen nach Herkunft und Zukunft gehören zu den Grundpfeilern menschlicher Existenz. Wer Gott als persönliche Autorität über sich weiß, findet leichter zu einer Lebensweise der Geborgenheit. Mir erlaubte sie, das blinde Schicksal oder den bloßen Zufall als bedrohende Unbekannte auszuschließen.
3. Willst du ab jetzt ohne Gott leben?
Die Bibel war neu im Bücherregal und führte zu Konflikten. Meine Eltern gingen davon aus, dass ich in die Fänge einer Sekte geraten war. Tatsächlich sympathisierte ich ja eine Zeit lang mit den Zeugen Jehovas, ehe ich mich von den Christen der Stadtmission einladen ließ. Ich selbst gebrauchte für die Landeskirchliche Gemeinschaft den Begriff Sekte im Sinne von „nicht katholisch“. In meiner Kernfamilie kam durch die Übernahme volkskirchlicher Traditionen der Bibel jedenfalls keine Bedeutung zu. Die gut sichtbare Position auf dem Bord musste deshalb provozierend wirken. Mein Vater riss das Buch aus dem Regal. Sein Argument fiel entsprechend bizarr aus. Benutzte er doch ein religiöses Argument, um die Heilige Schrift abzuwehren:
„Wir brauchen keine Bibel, wir sind schon katholisch!“
Fortan bekam die Bibel einen weniger exponierten Platz. Doch der Frieden währte nicht lange. Ich gewöhnte mir an, vor dem Frühstück Gottes Wort zu lesen und zu beten. Dabei versuchte ich, unauffällig zu bleiben, wurde aber dennoch missbilligend wahrgenommen. Mutter versuchte zu vermitteln und redete mir zu, weniger „bigott“ zu leben. Ihr Verständnis in Bezug auf den Glauben beschränkte sich auf eine innere Überzeugung, über die man jedoch nicht redet. Ich legte ihr dar, dass ich vor kurzem Christ geworden sei. Das brachte sie noch mehr gegen mich auf.
„Wie kannst du so etwas sagen, wir sind doch alle Christen!“ Sie reagierte sichtlich gekränkt. Damals fehlte mir die passende Sprachfähigkeit. Ich konnte ihr nur unzulänglich darlegen, worin sich lebendiger Glaube von einem kulturell geprägten Christentum unterscheidet.
Die innere Kluft, die in der Beziehung zu den Eltern entstand, schmerzte auf beiden Seiten. Bis dahin hatten meine Mutter und ich eine enge seelische Bindung. Wir waren gleichermaßen sensibel und liebten den mit Sarkasmus gewürzten Humor. Trotz unseres Bemühens, das ursprüngliche Verhältnis wiederherzustellen, entfremdeten wir uns zunehmend.
Vater reagierte meist in aggressiver Weise auf meinen Glauben. „Du kritisierst uns ja mit der Art, wie du lebst“, warf er mir einmal vor und rechtfertigte sich. Schließlich habe er doch niemanden umgebracht und würde nicht stehlen. Mein stilles Gebet beim Essen stellte stets ein Konfliktrisiko dar. Er hatte es mir verboten und versuchte, das mit Druck durchzusetzen. Oft betete ich deshalb mit Angst. Mittwochs ging ich am Abend zur Bibelstunde. Ich begann zu verstehen, was Jesus meinte, als er sagte:
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören.
(Matthäus 10,37 GNB)
Der innere Verlust der Eltern war der Preis, den ich auf dem Weg der Nachfolge bezahlen musste. Als ich wieder einmal die Wohnung verließ, hörte ich, wie mein Vater bewusst laut zur Nachbarin bemerkte: „Ich wollte, Ralf wäre Zuhälter geworden, statt dass er ständig zur Bibelstunde rennt.“
Wenige Wochen nach dem Schritt zum Glauben traf ich auf den Kaplan, der meine Zwillingsschwester und mich zur Kommunion geführt hatte. Das Verhältnis zueinander gestaltete sich eher distanziert, seit ich während des Religionsunterrichts die falsche Frage gestellt hatte: Mich interessierte mit kindlicher Naivität, welcher Konfession der Papst zugehöre, ob er denn nun katholisch oder evangelisch sei. Er hätte darauf mit Humor reagieren können. Hat er aber nicht. Diese Begegnung bot nun die Chance, die Beziehung zu verbessern. Freudig erzählte ich ihm, wie ich zum Glauben gefunden hatte und dass ich Christ geworden sei. Er war befremdet und wies darauf hin, dass das ja bereits bei der Taufe stattgefunden habe. Ein Wort ergab das andere. Die Begegnung gestaltete sich als ein eklatanter Fehlschlag.
Der Schritt zum Glauben eröffnete mir die Lebensperspektive überhaupt! Ich konnte darüber nicht schweigen. Jesus sagt:
Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.
(Matthäus 12,34 GNB)
Ob mein Reden immer in angemessener Weise geschah, stelle ich aus heutiger Sicht infrage. Damals gab es für mich nur Schwarz oder Weiß, Wahrheit oder Lüge, Sekt oder Selters. Dieses starre Denk- und Argumentationsmuster verlieh mir bei den ersten Schritten die nötige Sicherheit, gehörte aber insgesamt in die Kategorie der geistlichen Unreife. Ich setzte mich mit menschlichen Mitteln für die göttliche Wahrheit ein. Damit wurden das Familiengefüge und die sozialen Beziehungen unnötig belastet. Eine Diskussion mit meinem Patenonkel ist mir lebhaft im Gedächtnis. Er schien den Geist des Eiferers bei mir registriert zu haben, das ließ ihn wohl gereizt reagieren. Als ich vom Glauben zu reden begann, kanzelte er mich ab:
„Wenn ich etwas verabscheue, dann ist es missionarisches Geschwätz.“ Ich erinnerte ihn an sein Versprechen als Taufpate und fragte, was es ihm bedeute.
„Nichts!“
Die Antwort war ebenso kurz wie unmissverständlich. Dann bemüßigte er sich allerdings doch zu einer Erklärung.
„Das macht man halt so. Aber die Taufe hat nichts zu bedeuten. Verstehst du? Nichts!“ Deutlicher musste er kaum werden.
Diese Haltung entspricht der Auffassung vieler Kulturchristen. So jedenfalls beschreibt es der katholische Priester Thomas Frings in seinem Buch „Aus, Amen, Ende?“ (Herder, 2017):
„Trotz des Versprechens der Eltern hinsichtlich der Erziehung im Glauben können die meisten Kinder bei der Kommunionsvorbereitung weder Kreuzzeichen noch Vaterunser. Doch alle gehen jahrgangsweise zur Kommunion, mit der die meisten Familien weder vorher noch nachher etwas anfangen.“
Um es ganz offen zu sagen: Bei Mitgliedern der evangelischen Kirchen, aber auch in den Reihen der Freikirchen gibt es vergleichbare Tendenzen. Die Gefahr eines religiösen Formalismus hat weniger mit der Konfession zu tun als mit der Tatsache menschlicher Unzulänglichkeiten.
Schon bald strebte ich den Austritt aus der katholischen Kirche an. Die an den Tag gelegte Eile war Ausdruck der gleichen Unduldsamkeit, wie ich sie bei meinem Vater beobachtete. Mit diesem Schritt wollte ich mich gegenüber denen absetzen, die „nicht richtig“ glaubten. Zugleich richtete er sich gegen meinen Vater. Der meinte, noch immer in religiösen Fragen über mich bestimmen zu können.
„Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bleibst du katholisch!“ Seine Worte gingen an der von mir geschaffenen Realität vorbei. Ich war religionsmündig und hatte meine Entscheidung getroffen. In der reiferen Phase meines Lebens ermutigte ich Ratsuchende, einen solchen Schritt abzuwägen. Kirchen und freikirchliche Gemeinden bleiben stets Gebilde mit problematischen Anteilen. Es wird Gründe geben, wo mit einer Abwanderung notwendige Zeichen gesetzt werden müssen. Aber ebenso kann es angebracht sein zu bleiben. Hier sollte der Einzelne von Gott die notwendige Weisheit erbitten und auch die Meinung von Mitchristen zumindest anhören.
Die formale Seite des Kirchenaustritts gestaltete sich als nüchterner Verwaltungsakt. Als mir die Frau das entsprechende Dokument aushändigte, konnte sie sich eine Bemerkung nicht verkneifen.
„Willst du ab jetzt ohne Gott leben?“
Amüsiert erwiderte ich: „Nein, im Gegenteil …“ Ich erläuterte ihr die Gründe und hatte das Empfinden, dass sie aufmerksam zuhörte.
Die Unstimmigkeiten zu Hause hielten an. Der Abschluss der Schulzeit lag vor mir. Es war an der Zeit, nach dem passenden Beruf Ausschau zu halten. Am liebsten hätte ich sofort einen geistlichen Dienst ausgeübt. Doch angeforderte Unterlagen von entsprechenden Ausbildungsstätten wirkten auf Vater wie Feuer an einer Lunte. Ich war bereit, ihm die Stirn zu bieten. Doch mein Mentor Werner pfiff mich liebevoll, aber entschieden zurück. In einem Brief legte er mir dar, dass ich nach biblischer Weisung den Eltern zu gehorchen hätte. Den Einwand, sie würden dem Glauben feindselig gegenüberstehen, ließ er nicht gelten. Seine klaren Worte waren mir eine Leitlinie, obwohl sie meinen Plänen zuwiderliefen.
In Worms gab es eine christliche Buchhandlung. Ich fasste den Plan, mich dort um eine Ausbildung zu bewerben. Es kam gar nicht dazu, denn mein Vater intervenierte. Ihn störte die Ausrichtung. Ich kam zu der Überzeugung, dass ich das Elternhaus verlassen sollte. Die Möglichkeit dazu bot sich, wenn es mir gelang, beim Bundesgrenzschutz, bei der Bundeswehr oder Polizei unterzukommen. Die Chancen standen dafür gut, denn es wurde Nachwuchs gesucht. In Mainz siebte man die Bewerber für den Polizeidienst durch Prüfungen ihrer kognitiven und körperlichen Fähigkeiten aus. Um für die sportlichen Ansprüche gerüstet zu sein, hatte ich gründlich trainiert. Der Erfolg belohnte diese Anstrengungen. Ich wurde angenommen.
Der nahende Beginn in einem Beruf, der auch die Zustimmung der Eltern fand, befriedete das Zuhause. Mich beflügelte der Gedanke, dadurch dem heimischen Druck zu entkommen. Allerdings war ich mir unsicher, was mich erwarten würde. Eine Polizeikaserne ist kein Mutterhaus. Und selbst dort kann das Leben herausfordernd sein. Wieder war es mein Mentor Werner, der mich ermutigte, auf die Gegenwart von Jesus zu bauen. Der Tag des Berufsbeginns war auch mit Wehmut verbunden. Ich verließ das Elternhaus, das bis dahin mein vertrautes Umfeld darstellte. Die Trennung von meiner Mutter tat weh. Dies umso mehr als ich sah, wie sehr sie litt. Ein Lebensabschnitt war unweigerlich zu Ende.
Die äußere Loslösung von den Eltern überschnitt sich mit dem näheren Kennenlernen von Johanna. Sie war für mich eine Leiterin im Glauben geworden. Ihre unkomplizierte Natürlichkeit verband sich mit einem tiefen Vertrauen zu Gott. Außerdem hatte sie einen ausgeprägten Sinn für das Praktische. Christsein war für sie kein Hobby, sondern ein Auftrag, dem sie alles andere unterordnete. Es war deshalb nicht erstaunlich, dass sie bereits mit vierzehn Jahren eine Mädchenjungschar leitete. Diese Tätigkeit offenbarte ihre Liebe zu Kindern. Nach ihrer Zeit als Bäckereiverkäuferin holte sie deshalb schulische Qualifikationen nach, um sich dann zur Erzieherin ausbilden zu lassen. Bei ihrem Engagement für die Jungschar und den Kindergottesdienst bezog sie mich mit ein. Dabei lernte ich mich neu kennen. Welche Hemmungen hatte ich doch, selbst wenn ich vor einer Gruppe von Kindern sprechen sollte. Ebenso tat ich mich schwer, Aussagen des Glaubens auf die Zielgruppe herunterzubrechen. In all diesen Bereichen war Johanna mir weit voraus.
Das Haus meiner zukünftigen Schwiegermutter befand sich in der Nähe von Frankenthal. Sie führte ein Lebensmittelgeschäft, in dem sie für etliche Kunden zur Lebensberaterin, Seelsorgerin und Wohltäterin wurde. Den Vater von Johanna habe ich nie kennengelernt. Er war vor nicht allzu langer Zeit an einem Herzinfarkt gestorben. In diesem Haus lebten Johannas Großvater mütterlicherseits und die Großmutter von väterlicher Seite, eine verheiratete Schwester mit Ehemann und Kind sowie eine jüngere Schwester. An Betriebsamkeit mangelte es nie. Aber ebenso wenig an einer warmherzigen Gastfreundschaft. In dieser freigiebigen Weise hatte ich sie bis dahin nicht annähernd erlebt.
Freunde und Verwandte glaubten, schon lange vor uns erkannt zu haben, dass es zwischen Johanna und mir gefunkt habe. Wir jedenfalls stellten das aufrichtig in Abrede. Im Rückblick halte ich diese Zeitspanne der Freundschaft für besonders wertvoll. Denn nichts lenkte uns ab. Der Zeitpunkt und Ort, an dem ich Johanna dann doch meine Liebe eingestand, hätten skurriler kaum sein können. Wie so oft hatten wir uns auf eine Sitzbank auf dem Friedhof zurückgezogen, um den Anforderungen des Geschäftshauses zu entkommen. Dort lasen wir gemeinsam die Bibel und beteten. Dann geschah es eben doch. Ich gestand Johanna meine Zuneigung und sie erwiderte diese. Es waren Momente, die man gern für die Ewigkeit festhalten würde. Wir hatten Schmetterlinge im Bauch und konnten das unfassbare Glück der Liebe kaum fassen. Wie auf Wolken schwebten wir geradezu nach Hause. Erstmals Hand in Hand. Doch in Sichtweite des heimischen Anwesens trennten wir uns scheu voneinander. Die ersten zarten Gefühle füreinander sollten zunächst unser Geheimnis bleiben.
Die Romanze des Kennenlernens wurde 1999 von unseren Kindern zur Feier der Silberhochzeit fotografisch nachgestellt. Unsere älteste Tochter Damaris organisierte eine Foto-Session. Désirée schlüpfte in die Rolle ihrer Mutter, da sie auch von der körperlichen Statur ihr am ähnlichsten ist. Bei Sohn René ist die Ähnlichkeit zu mir unübersehbar, wofür ich ihn scherzhaft immer wieder gebührend bedauere. Um die Fakten möglichst zu treffen, interessierten sich die Kinder bei den Vorbereitungen auffallend für persönliche Details. Berührt von so viel Aufmerksamkeit schwadronierten Johanna und ich ahnungslos über den gemeinsamen Beginn unseres Lebensweges. Irgendwann piepte jedoch das versteckte Aufnahmegerät unter der Kleidung der Akteure. Nun rochen auch wir den Braten.
Zurück zu den zarten Anfängen unserer Beziehung. Bereits nach drei Tagen fragte ich Johanna, ob sie sich vorstellen könne, meine Ehefrau zu werden. Die Ungeduld ließ erneut grüßen! Ein weiterer Grund war jedoch, dass unsere Beziehung über zwei Jahre größtenteils über die Ferne gestaltet werden musste. Bis zum Einrücken in die Polizeikaserne blieben noch wenige Wochen Zeit. In diese Phase der Veränderungen fiel in Frankenthal das ungeplante Zusammentreffen mit dem katholischen Religionslehrer meiner Schule.
„Ralf, ich weiß nicht, ob wir uns noch einmal sehen werden“, sprach er mich an, „deshalb möchte ich dir noch etwas auf deinen Lebensweg mitgeben. Weißt du, was Demut ist?“
Er konstruierte das Wort „Dienemut“ und erläuterte, dass Jesus sich nicht zu schade war, den Jüngern die Füße zu waschen. Er fügte hinzu:
„Alle Welt strebt danach zu herrschen. Folge du aber dem Herrn, Ralf, und habe den Mut, wie er zu dienen!“ Wir zogen uns in eine ruhige Seitenstraße zurück, wo wir miteinander beteten.
4. Wasserwerfer und Tränengas
Das erste Jahr der Ausbildung verbrachte ich in dem Zwanzigtausend-Seelen-Ort Schifferstadt. Die Stadt muss man nicht kennen. Wir waren jeweils zu viert in einem Zimmer untergebracht. Es hatte weniger Quadratmeter an Bewegungsfreiheit, als sie für Strafgefangene im Gefängnis vorgeschrieben sind. Hier die Bibel zu lesen und zu beten war alles andere als einfach. Oft zog ich mich dafür in einen stillen Winkel des Geländes zurück. Zur Not schloss ich mich in einer der Toiletten ein. Bei Tisch zu beten, löste in der Mensa nicht mehr wie zu Hause irgendwelche Zornesausbrüche aus. Aber dafür fehlte gelegentlich nach dem Amen das Fleisch auf dem Teller. Kollegen hatten sich einen Scherz erlaubt und es weggenommen. Mitunter betete ich deshalb mit offenen Augen.