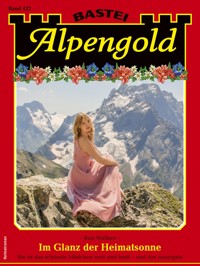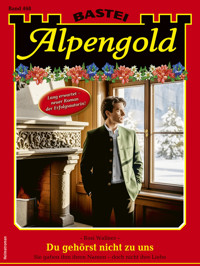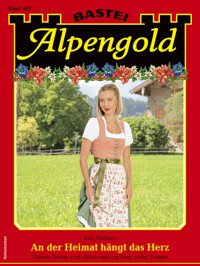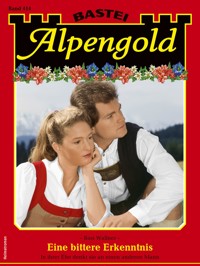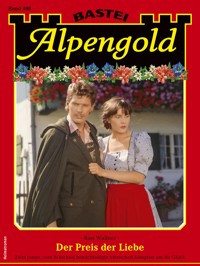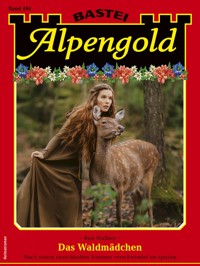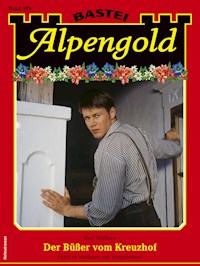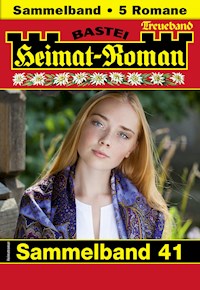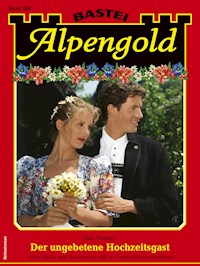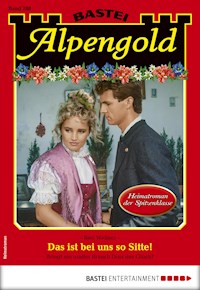
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alpengold
- Sprache: Deutsch
Das ist bei uns so Sitte!
Bringt ein uralter Brauch Dina das Glück?
Nach dem Tod ihrer Eltern zieht Dina Sander aus Hamburg zu ihren Verwandten in die bayerischen Berge. Sie lebt sich schnell auf dem Rainthalerhof ein, obwohl viele Dinge hier für sie fremd sind. Auch vom Klausentreiben, einem uralten Brauch, bei dem die Dämonen des Winters vertrieben werden, hat das Madl aus dem Norden noch nie etwas gehört. Junge Burschen mit furchterregenden Masken, aus denen gewaltige Hörner in die Höhe ragen, laufen an diesem Tag laut brüllend durch das Dorf, klirren mit Ketten und schlagen mit ihren Peitschen um sich.
"Das wird eine Mordsgaudi", verspricht Felizitas ihrer Cousine Dina, als die beiden sich in das Getümmel werfen. Doch diese Vorhersage erfüllt sich nicht. Für Dina wird das Klausentreiben zu einem Albtraum, denn eine dieser gruseligen maskierten Gestalten lehrt sie das Fürchten ...
Der Klausen mit der bedrohlichen Maske heftet sich an Dinas Fersen und treibt sie immer tiefer in die engen Gassen hinein. Für das Madl gibt es kein Entrinnen ...
Liebe Leserinnen und Leser, Sie sollten diesen packenden Heimatroman aus der Feder von Rosi Wallner auf keinen Fall versäumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das ist bei uns so Sitte!
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Bastei Verlag / Michael Wolf
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-7578-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das ist bei uns so Sitte!
Bringt ein uralter Brauch Dina das Glück?
Von Rosi Wallner
Nach dem Tod ihrer Eltern zieht Dina Sander aus Hamburg zu ihren Verwandten in die bayerischen Berge. Sie lebt sich schnell auf dem Rainthalerhof ein, obwohl viele Dinge hier für sie fremd sind. Auch vom Klausentreiben, einem uralten Brauch, bei dem die Dämonen des Winters vertrieben werden, hat das Madl aus dem Norden noch nie etwas gehört. Junge Burschen mit furchterregenden Masken, aus denen gewaltige Hörner in die Höhe ragen, laufen an diesem Tag laut brüllend durch das Dorf, klirren mit Ketten und schlagen mit ihren Peitschen um sich.
»Das wird eine Mordsgaudi«, verspricht Felizitas ihrer Cousine Dina, als die beiden sich in das Getümmel stürzen. Doch diese Vorhersage erfüllt sich nicht. Für Dina wird das Klausentreiben zu einem Albtraum, denn eine dieser gruseligen maskierten Gestalten lehrt sie das Fürchten …
»So, da wären wir.« Felizitas Rainthaler, genannt Feli, brachte den Geländewagen auf dem Hofplatz neben einer gewaltigen Scheune zum Stehen und wandte sich ihrer Cousine Dina zu, die fast während der ganzen Fahrt schweigend auf dem Beifahrersitz ausgeharrt hatte. »Erkennst du es wieder?«
Dina Sander murmelte etwas Unverständliches.
»An deinen letzten Besuch kann ich mich sogar noch erinnern. Ich bin ja älter als du«, sagte Feli.
»Ich war damals noch zu klein, um eine genaue Erinnerung daran zu haben. Aber Mutterl hat mir oft vom Rainthalerhof erzählt«, setzte Dina hinzu.
»Ja, sie hat immer Heimweh in die Berge gehabt, das weiß ich.«
Darauf gab Dina keine Antwort. Sie stieg aus dem Wagen und betrachtete ihre Umgebung, als könne sie auf diese Weise die verlorene Erinnerung heraufbeschwören.
Es war ihr, als wäre sie in einer völlig anderen Welt angelangt. Sie war im Norden aufgewachsen, mitten in Hamburg, wo immer die Hektik und Umtriebigkeit der Großstadt herrschten. Selbst nachts war der Verkehrslärm nicht zum Erliegen gekommen, und das Haus, in dem die Familie gewohnt hatte, hatte manchmal geradezu gebebt, wenn ein Lastwagen durch die belebte Straße gefahren war.
Hier aber herrschte Stille. Die tiefe Stille, wie sie es nur auf dem Land gab und die in manchen Städtern sogar Unbehagen auslöste.
Der Rainthalerhof war von üppigem Gebüsch umschlossen, das keinen Einblick gewährte und wie ein Schutzwall wirkte. Hinter dem stattlichen Wohnhaus wuchs ein gewaltiger Hausbaum empor, ein Bergahorn, der in feurigem Herbstrot erglühte.
Ja, davon hatte die Mutter auch immer berichtet. Wie ein Wächter sei er gewesen, dieser mächtige Baum und jedem Unwetter habe er standgehalten.
Von den Geranien, die der Schilderung ihrer Mutter nach immer auf Fenstersimsen und der Balustrade herabwallten, war nichts mehr zu sehen, schließlich war es schon Herbst. Die Blumenkästen waren stattdessen mit Schneeheide und kleinen Buchskugeln bepflanzt, und an der Haustür hing ein gewaltiger winterlicher Kranz aus Reisig, Eibisch und rot glänzenden Hagebutten.
Rechts und links des Wohnhauses befanden sich außer der Scheune, die etwas zurückgesetzt war, Stallungen und Wirtschaftsgebäude. Alles in bestem Zustand, man sah, dass die Familie sich um den Erhalt des Anwesens kümmerte. An einem der niedrigen Gebäude hing ein Schild mit der Aufschrift »Hofladen«, davor war ein langer Tisch aufgestellt.
»Das ist mein kleines Reich«, erklärte Feli mit unverkennbarem Stolz in der Stimme. »Manchmal hilft mir auch die Mutter, wenn Hochbetrieb ist oder wenn ich etwas ausfahren muss. Wir haben Kunden bis weit ins Land.«
»Dann bist du ja eine richtige Geschäftsfrau«, meinte Dina beeindruckt.
Feli lachte, aber es war herauszuhören, dass sie sich doch geschmeichelt fühlte.
»So, jetzt gehen wir aber ins Haus. Gegen Abend wird es schon ziemlich kalt. Ja, die beste Zeit ist wohl schon vorbei«, sagte sie dann bedauernd und öffnete die Heckklappe, um Dinas Gepäck herauszuholen.
Sie setzte zwei Koffer ab, einen großen, unförmigen Reisekoffer, dessen Ecken abgestoßen waren, und einen kleineren, der einst ihrer Mutter gehört hatte. Darin und in einer großen Umhängetasche befanden sich ihre gesamten Habseligkeiten, sie hatte nichts zurückgelassen.
Eine Urnenstele war alles, was noch an ihre Familie erinnerte.
Feli hinderte ihre Cousine energisch daran, den großen Koffer zu tragen. Ohne Mühe hob sie ihn hoch, sie war kraftvoller, als es ihre schlanke, geschmeidige Gestalt vermuten ließ. Die zierliche Dina dagegen hatte schon Mühe, den kleinen Koffer zu lüpfen.
Doch dann öffnete sich die Tür, und eine wuchtige Männergestalt trat ins Freie, ihr Onkel Albin Rainthaler, der Bruder ihrer Mutter. Er hatte markante Züge, die von hellblauen Augen beherrscht waren, deren Blick durchdringend, aber nicht unfreundlich wirkte. Üppiges schwarzbraunes Haar, von einigen grauen Strähnen durchzogen, und ein Kinnbart rundeten das Bild ab. Er trug ländliche Tracht, enge, wadenlange Hirschlederne und einen Janker, dazu Haferlschuhe.
Ein richtiger Urbayer, das war ihr Onkel, selbstbewusst und manchmal auch ein wenig grantelnd, wenn ihm etwas gegen den Strich ging.
»Gebt schon her, das ist nichts für euch Madln«, rief er aus und entriss seiner Tochter sofort den schweren Koffer.
Dann setzte er ihn wieder ab und zog seine Nichte in seine Arme. Es war eine allumfassende Umarmung, wie Dina sie noch nie kennengelernt hatte, denn ihr Vater war immer sparsam mit seiner Aufmerksamkeit ihr gegenüber gewesen. Zwar glaubte sie fast zu ersticken, doch gleichzeitig fühlte sie sich auch wunderbar geborgen.
Endlich gab er sie frei und hielt sie von sich.
»Jesses, Madl, dich müssen wir ja richtig auffüttern«, meinte er dann und schüttelte mitleidig den Kopf.
In den letzten Wochen hatte Dina, die an sich schon immer sehr schlank gewesen war, noch mehr an Gewicht verloren, zu viel hatte sie ertragen müssen. Die Pflege ihres Vaters war über ihre Kräfte gegangen, und nach seinem Tod hatte sie einen Zusammenbruch erlitten, von dem sie sich immer noch nicht erholt hatte.
»Da ist sie ja hier an der richtigen Stelle. Mutterl wird nicht von Dina ablassen, bis ihr die Kleider eine Nummer zu klein sind«, sagte Feli lachend.
***
Bald schienen alle die herbstliche Kälte zu spüren und beeilten sich, ins Haus zu kommen. Wohltuende Wärme schlug ihnen entgegen, dazu der angenehme Duft nach frisch gekochtem Essen. Dinas Gepäck wurde im Flur abgestellt, wo derbes Schuhwerk lagerte und Lodenmäntel und Janker an Haken hingen.
Manch einer hätte das als unordentlich empfunden, ihr Vater ganz gewiss, doch Dina verspürte ein heimeliges Gefühl. Sie zog ihren leichten Mantel aus, darunter trug sie enge Hosen und einen losen Pullover, der sie noch magerer erscheinen ließ.
Nun kam Tante Burgl mit hochroten Wangen aus der Küche geeilt. Eigentlich hieß sie Walburga, doch keiner nannte sie so, denn Burgl passte viel besser zu ihr. Sie hatte ein hübsches, rundliches Gesicht und eine füllige Figur, die in dem hochgeschlossenen Winterdirndl gut zur Geltung kam. Was jeden für sie einnahm, war ihr strahlendes Lächeln, das ihr Gesicht auf wunderbare Weise zum Leuchten brachte.
»Dina, Madl! Dass ich dich endlich wieder in den Armen halten darf«, brachte sie hervor, und auch sie umarmte das Mädchen liebevoll.
Burgl und Lydia, Dinas Mutter, waren beste Freundinnen gewesen, bevor Burgl ihre Schwägerin geworden war. Und auch als Lydia in den kühlen Norden gezogen war, war ihre Verbindung nicht abgerissen. In den ersten Jahren ihrer Ehe war Lydia regelmäßig in ihrem Elternhaus zu Besuch gewesen, und als sie Mutter geworden war, hatte sie auch die kleine Dina dorthin mitgenommen.
Anschließend musterte Burgl das junge Mädchen eingehend.
»Bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten«, sagte sie.
»Das sagen alle«, erwiderte Dina leise.
»Komm, ich zeig dir etwas.«
Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es in die gemütliche Stube, wo eine Seite durch eine Kredenz mit reicher Schnitzerei eingenommen wurde. Auf dem Vorsprung standen zahlreiche Familienbilder, liebevoll gesammelt und aufgereiht, die Aufschluss über die Geschichte der Rainthalers gaben.
Eine der Fotografien stand etwas abseits, daneben befand sich eine halb niedergebrannte Kerze. Die Aufnahme zeigte einen stattlichen jungen Mann in Uniform, Albins Onkel, der im Krieg gefallen war, und dessen Verlust immer noch beklagt wurde.
»Das ist deine Mutter in jungen Jahren, und daneben steh ich«, erklärte Burgl lächelnd und nahm ein Bild in die Hand. »Wie schön und glücklich sie darauf ausschaut! So, als könnt ihr im Leben nie etwas widerfahren. Dabei hat sie so jung von uns gehen müssen …«
Albin strich ihr tröstend über die Schultern.
»Ja, es kommt uns immer noch hart an. Eine bessere Schwester hätt ich mir net vorstellen können, obwohl wir so verschieden waren. Schon rein äußerlich …«
Damit hatte Albin allerdings recht. Lydia war eine schmale, zierliche Frau von außergewöhnlicher Schönheit gewesen. Üppige dunkle Locken umrahmten ein fein geschnittenes Gesicht mit grünen Augen und einem vollen, reizend geschwungenen Mund. Kaum vorstellbar, dass sie die Schwester des kraftstrotzenden Albin Rainthalers gewesen war.
Dina glich ihr wirklich sehr, auch sie hatte das üppige dunkle Haar und die grünen Augen. Aber ihr Gesicht zeigte einen anderen Ausdruck, was vermutlich auf ihre bessere Ausbildung und auf ein anderes Umfeld zurückzuführen war. Und ihre Mutter war in den letzten Jahren immer schwermütiger geworden.
»Da ist sie wohl so alt gewesen, wie ich jetzt bin«, meinte Dina. »Aber du schaust auch reizend aus, Tante Burgl, kein Wunder, dass Onkel Albin sein Herz an dich verloren hat.«
Burgl errötete.
»Wir waren sehr gegensätzlich. Ich war ein rechtes Lachkattl, die Lydia war aber immer sehr ernst und still. Den Burschen haben wir natürlich gefallen, sie so dunkel und schlank und ich mit meinen blonden Haaren und recht üppig.«
Albin knurrte.
»Hörst du? Er ist immer noch eifersüchtig, mein Mandl, man sollt es net glauben. Schließlich sind wir gesetzte Leut.«
»Gesetzte Leut?«, wiederholte Albin. »Ich weiß doch genau, dass du es gernhast, wenn ich eifersüchtig bin.«
Burgl kicherte wie ein junges Mädchen und entschwand dann in die Küche, weil von dort ein mahnendes Klingeln erscholl. Dina hielt immer noch das Bild in der Hand, und auch Feli stand nun neben ihr und betrachtete es.
»Wenn man euch so beinand sieht, könnt man glauben, die Vergangenheit wär wiederauferstanden«, sagte Albin und räusperte sich.
Und das war nicht abwegig. Auch die hübsche blonde Feli sah ihrer Mutter sehr ähnlich. Allerdings war sie wesentlich schlanker, denn heutzutage achteten die jungen Frauen wesentlich mehr auf ihre Figur.
»Jetzt kehren wir aber wieder in die Gegenwart zurück«, sagte Feli, und Dina stellte das Bild zurück auf seinen Platz.
Nun hatte sie Gelegenheit, die Räumlichkeit genauer in Augenschein zu nehmen. Zwar war die Decke mit den dunklen Balken ziemlich niedrig, aber die Stube bot genug Raum für einen großen, runden Esstisch und ein kleines Sofa am Fenster.
Ein kunstvoll bemalter grüner Kachelofen samt einer Rundbank, auf der Kissen lagen, war ein besonderer Blickfang. Er strömte angenehme Wärme aus, und in einer Öffnung schmorten Bratäpfel vor sich hin, die einen würzigen Duft verbreiteten.
***
Der Tisch war festlich gedeckt. Auf weißem Leinen stand rustikales Geschirr, in der Mitte ein Krug mit herbstlichen Zweigen. Es rührte Dina an, dass ihre Verwandten sich so viel Mühe gegeben hatten, um sie gebührend zu empfangen.
»Hier kann man sich richtig zu Hause fühlen«, sagte Dina leise, und das meinte sie auch aufrichtig.
Burgl, die mit einer großen Platte hereinkam, hatte ihre Worte gehört, und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Du sollst dich auch hier zu Hause fühlen, Dina, denn wir sind deine Familie«, sagte sie mit liebevollem Nachdruck.
Zum ersten Mal, seitdem ihre ganze Welt in Trümmer gefallen war, verspürte Dina so etwas wie Zuversicht. Sie war nicht mehr allein, die Familie ihrer Mutter hatte sie wie ein Familienmitglied freudig aufgenommen, und sie fühlte sich nicht wie ein unwillkommener Gast. Vielleicht würde sie auch irgendwann wieder die Freude am Leben zurückgewinnen und sogar Pläne für die Zukunft schmieden.
Es wurde reich aufgetischt, im Gegensatz zu ihrem Elternhaus, wo abends gewöhnlich nur ein paar Brotscheiben oder die Reste eines Mittagessens genügen mussten. Hier dagegen gab es angebratene Knödelscheiben, Kraut und verschiedene Würstl, außerdem krosses, offensichtlich selbst gebackenes Brot, das wunderbar duftete. Die Rainthalers tranken dazu Weißes, für Dina war das jedoch ungewohnt, daher wurde ihr Quellwasser angeboten.
Und während man mit gutem Appetit aß, unterhielt man sich gleichzeitig – über die grimmige Pfarrhaushälterin, wer neu verbandelt war, wo es Nachbarschaftsstreitigkeiten und Wirtshausschlägereien gegeben hatte.
»Da hörst du gleich den ganzen Klatsch und Tratsch, Dina«, wandte sich Rainthaler seiner Nichte zu. »Und du bekommst auch gleich einen Eindruck, wie es bei uns zugeht. Sicher ganz anders als bei euch im Norden.«
»Ach, das ist auch nicht viel besser, man redet nur nicht drüber. Aber irgendwann kommt doch alles heraus«, meinte Dina unbeeindruckt.
»Ach so? Dann ist es ja gut«, meinte Albin und nahm noch eine Weißwurst in Angriff, zu der er sich reichlich besonders scharfen Senf gönnte.
Dina hatte von den Knödelscheiben und dem Kraut gegessen, dazu ein wenig Brot. Sie mochte fettes Essen nicht und war bereits jetzt satt. Auch Feli hatte ihren Teller schon zurückgeschoben, vermutlich ihrer Figur zuliebe.
»Ihr habt ja kaum etwas gegessen«, klagte Burgl, die sich zum zweiten Mal Kraut und Würstl auf den Teller gehäuft hatte.
»Ach, lass doch, Burgl. Die jungen Weiberleut laufen doch heutzutage alle halb verhungert herum«, warf Albin ein.
»Vielleicht liegt es auch daran, dass die Mannsleut das heutzutage mögen«, erwiderte Feli etwas spitz.
»Ja, es gibt halt auch keine richtigen Männer mehr«, befand ihr Vater.
»Lass das nur net den Sylvester hören«, sagte Feli.
Albin Rainthaler lachte auf.
»Der Sylvester ist fei net so, der kommt ganz nach mir. Der wird auch amal ein richtiges Urgestein.«
Nun wandte sich das Gespräch ganz Sylvester Rainthaler zu, dem älteren Bruder von Felizitas. Zu seinem Namen war er gekommen, weil er in der Silvesternacht geboren worden war, unter offensichtlich sehr widrigen Umständen, die man Dina ausführlich schilderte.
»Die Nacht werde ich nie vergessen. Erst hat es den ganzen Tag geschneit, und in der Nacht ist es eiskalt geworden. Da war kein Durchkommen mehr. Und ausgerechnet dann haben bei der Burgl die Wehen angefangen. Nur die alte Wehmutter aus dem Dorf hat sich durchgekämpft, und sie hat der Burgl beigestanden. Noch nie in meinem ganzen Leben hab ich solche Angst gehabt. Denn ohne sie …«
Albin konnte nicht weitersprechen, und es dauerte eine Weile, bis er sich wieder gefasst hatte.
»Doch dann ist der Sylvester heil auf die Welt gekommen, und die Glocken haben geläutet, und das ganze Tal war hell erleuchtet vom Feuerwerk. Doch bei der ganzen Aufregung hat die Hebamme vergessen, genau auf die Uhr zu schauen. Und so wissen wir bis heut noch net, ob der Sylvester im alten oder im neuen Jahr geboren ist. Aber am wichtigsten war, dass er ein gesundes Buberl war und sich seine Mutter schnell wieder erholt hat«, schloss Albin.
»Der Sylvester macht sich heut noch lustig darüber, also hat er keinen Schaden an seiner Seele genommen«, spöttelte Feli.
Dina erfuhr außerdem, dass Sylvester in München im zweiten Semester Agrarbiologie studierte, was sie beeindruckte.
»Will er den Hof auf biologischen Anbau umstellen?«, wollte sie wissen.
Albin winkte ab.
»Ja, natürlich, die jungen Leut wissen doch alles immer besser, auch wenn sich der traditionelle Anbau hier bewährt hat. Aber bis er amal den Hof übernimmt, ist ja noch lang hin, net wahr, Burgl?«
Seine Frau nickte, wirkte aber nicht sehr überzeugt.
»Und du, Dina, was hast du beruflich vor?«, fragte er unvermittelt seine Nichte, die zusammenzuckte.
»Ich hab ziemlich den Anschluss verloren, weil ich so lange bei dem Vater …«
»Plag doch das Madl net, Albin! Sie muss hier erst amal zur Ruhe kommen, dann wird sie weitersehen«, fiel Burgl ihrem Mann schnell ins Wort. Ihr war nicht entgangen, dass diese Frage Dina offensichtlich in Bedrängnis gestürzt hatte.
»Hier kann man gar nichts anderes, als sich erholen, Dina. Hier auf dem Hof ist es immer ruhig, und es ereignet sich einfach nichts. Keine Aufregungen, keine Abwechslung und keine neuen Bekanntschaften. Dafür gutes Essen und viel frische Luft, manchmal riecht es höchstens ein bisserl streng«, spottete Feli.