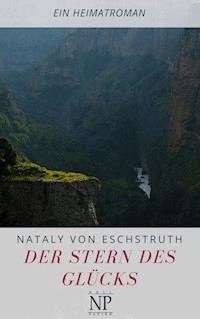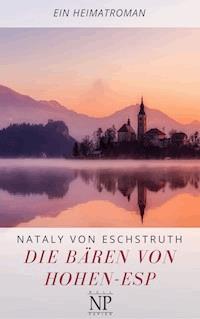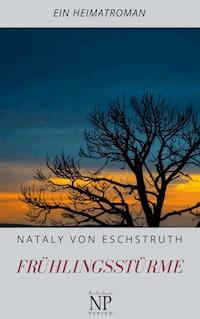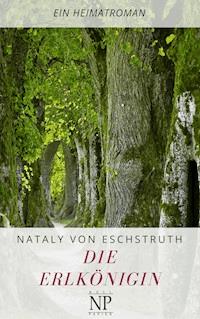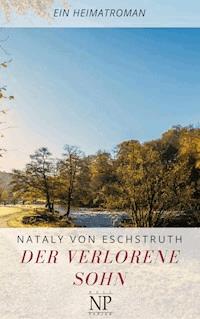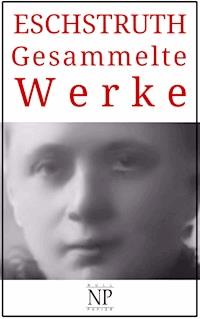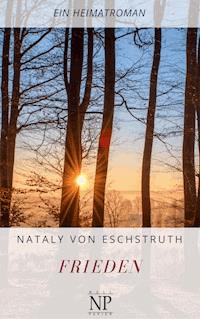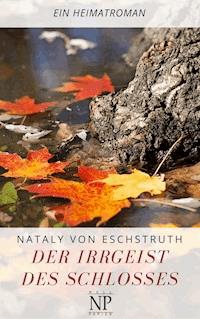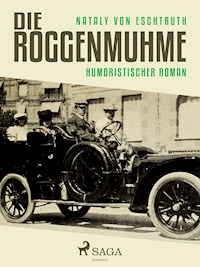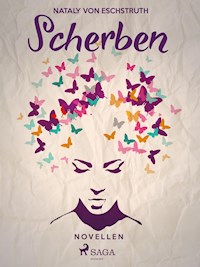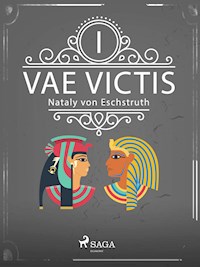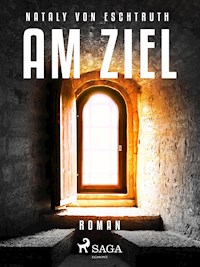
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf Schloss Kochenhall lebt Gräfin Theodora mit ihrem Gatten, dem Grafen Alexis von Thum. Ihren gemeinsamen Sohn will sie ganz nach ihren Vorstellungen erziehen, denn ihr Gatte ist gänzlich unambitioniert, während die Gräfin ehrgeizige Pläne verfolgt. Eckbrecht von Thum wächst in enger Nachbarschaft mit dem Nachbarbuben, Friedel Seehofer, dem Sohn des Försters auf. Die beiden werden enge Freunde. Aber ihre Lebenswege verlaufen gänzlich anders. Während sich der ernste Eckbrecht fleißig den Studien hingibt und seine schwache Gesundheit untergräbt, zieht Friedel in den Russisch-Türkischen Krieg, in dem er hohe Auszeichnungen erringt und sogar den Adelsbrief erhält, und während Eckbrecht auf die ersehnte Braut verzichten muss, kann der geadelte Friedel um Brunhilde, Eckbrechts schöne Schwester freien.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Am Ziel
Roman
Saga
Am Ziel
© 1901 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711472835
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel
Es brängen und jagen die Menschen so viel —
Nach einem entfernten, verschleierten Ziel,
Ob sie’s erreichen? —
A. Müller.
Eine stille, klare Winternacht. Der Vollmond schwebt am wolkenlosen Himmel, die Sterne funkeln und blitzen, wie ein schimmerndes Märchengebild liegt der bereifte Wald.
Die Berge ragen an drei Seiten hoch und schroff empor und treten nur nach Süden hin breiter auseinander, um einem langgestreckten, lieblichen Tal Platz zu schaffen, einer herrlichen, fruchtbaren und meilenweiten Talebene, die wie ein kleines Paradies inmitten des Hochgebirges hingestreckt liegt.
Mächtige Waldungen ziehen sich an den Berghängen empor und dehnen sich noch meilenweit im Tale hin, durchschnitten von dem krausen Silberband eines Flüsschens, das hell und wild von den Felsen herabschäumt und geschwätzig in die fremde Welt hineinsprudelt. Selbst jetzt hat der Frost vergeblich die glitzernden Arme nach ihm ausgestreckt.
In gemächlicher Höhe über dem Tale hebt ein trutziger Herrensitz seinen Wartturm aus den Eichwipfeln.
Im Winter hatte Schloss Kochenhall stets einsam und verlassen in tiefem Schlaf gelegen; selten, dass Burgwart, Jäger und Verwalter mit ihren Familien aus dem Schlosshof und ihrem stillen, weltentrückten Heim herauskamen; die Wege waren verschneit, das nächste Dorf lag immerhin weit ab, und wer da zu Fuss gehen musste, der tat es nur in schlimmster Not.
In diesem Jahre aber blitzten die Fensteraugen von Kochenhall Abend für Abend zu dem stillen Tal hernieder, gleichviel, ob der Herbst ins Land zog, ob der November schon ganz plötzlich einen grimmen Frost und Schneefall mit sich brachte.
Der junge Graf Thum, der mit seiner Gemahlin zu Anfang September in Kochenhall eingetroffen war, um mit vieler Dienerschaft, Wagen und Pferden und etlichen Gästen die Herbstjagden abzuhalten, schien die Abreise in diesem Jahre total vergessen zu haben.
Und das hatte seinen guten Grund.
In der Residenz, die das gräfliche Paar bewohnte, war, wie leider schon so oft, eine heftige Typhusepidemie ausgebrochen, die die Rückkehr nach M. vorläufig unmöglich machte.
Da die Gräfin sich leidend fühlte und die Anstrengungen einer erneuten Badereise oder eines Aufenthalts in dem Süden scheute, zog sie es vor, in Kochenhall zu verbleiben, bis die Gefahr einer Ansteckung in M. vorüber sei. In wenig Wochen pflegte man gewöhnlich der unheimlichen Seuche Herr zu werden, das wusste Graf Thum, und war darum um so betroffener, als Woche um Woche verstrich, ohne günstigere Nachrichten aus M. zu bringen. Je längere Zeit aber verging, um so unmöglicher war es für die Gräfin, zu reisen, und als man sich eines Morgens in dem stillen hochgelegenen Schloss „eingeschneit“ fand, beschloss das gräfliche Paar, nun wohl oder übel den Aufenthalt in Kochenhall über den ganzen Winter auszudehnen, und traf dementsprechend alle so wichtigen und eiligen Vorbereitungen.
Dem Reichtum ist nichts unmöglich, auch nicht, auf einsamem Bergschloss eine Haushaltung unter erschwerenden Umständen zur Winterzeit einzurichten.
Die Equipage mit dem eleganten Viererzug fand auch über verschneite Pfade ihren Weg, und sie brachte alle jene Personen, die auf Kochenhall nötig wurden, herzu, — den Arzt, die Wärterinnen und die Amme, — und über die altertümliche Zugbrücke rollten die Gepäckwagen, die Vorräte in das Schloss schafften, als sollte dieses einer jahrelangen Belagerung standhalten!
Und nun war es eine stille, klare Winternacht, und in Kochenhall leuchtete Licht aus allen Fenstern, bis weit in das schlummernde, schneeweisse Tal hinab, so dass die schlanken Rehe staunend im Park standen, den fremden Glanz anzustarren.
Gräfin Theodora aber lag in den spitzenbesetzten Kissen des seidenen Himmelbettes, mit geschlossenen Augen und einem feinen, scharfen Schmerzenszug um die blassen Lippen, still und regungslos, — „heldenhaft mutig!“ wie der Arzt im Nebenzimmer dem Grafen zuflüsterte, als dieser seine unruhige Promenade über den dicken Smyrnateppich einen Augenblick unterbrach, um die feuchtperlende Stirn mit dem breitkantigen Sporttaschentuch zu trocknen.
Die Gräfin schlief nicht. Ihre Gedanken waren lebendiger und erregter als je.
Sie dachte zurück.
Vor vier Jahren war es gewesen, als sie, die vielgefeierte, bildschöne Tochter des Generals von Teutin, ihre Hand dem Grafen Alexis von Thum gereicht hatte.
Sie war stolz und glücklich, hochbefriedigt gewesen, denn ihr Gatte bot alles, was eines Weibes Herz begehren kann, stattliche Jugend, ritterlichen Edelsinn, ein frisches, liebenswürdiges Wesen, das sein männlich hübsches, offnes Gesicht charakterisierte, und last not least einen uralten Grafentitel, ein enormes Vermögen, das diesem Titel auch die nötigen Mittel garantierte.
Ja, Graf Alexis war wohl die beste Partie des ganzen Landes, — und hätte wohl jedes Weib vollkommen glücklich und zufrieden gemacht, nur nicht eine Theodora Teutin.
Nicht dass ihre Ehe eine unglückliche gewesen! Die Gräfin liebte ihren Gemahl und erkannte all seine Vorzüge in rückhaltloser Weise an, ja, sie hätte wohl nichts zu tadeln und nichts mehr zu wünschen gehabt, wenn ... ja, wenn dieses „wenn“ nicht gewesen wäre! Theodora von Teutin war kein Durchschnittscharakter, sie war ein eigenartiges Wesen, das nicht den Pfad all der harmlosen, lebensfrohen, toleranten Mitschwestern ging. Ein Erbteil ihres Vaters war ihr in die Wiege gelegt und begleitete sie wie ein grauer Schatten auf ihrem sonnigen Lebensweg: der Ehrgeiz, wie er wohl die Brust strebender Männer durchflammt, selten aber Frauenherzen höher schlagen lässt.
Und was den Ehrgeiz jedweder andern Dame voll befriedigt hätte: die reiche Gräfin von Thum zu sein, — das deuchte ihr im Gegenteil nur die goldene Schale, auf der Besseres serviert werden musste: Macht, Stellung, Einfluss!
Just diese aber besass Graf Alexis nicht. Er war ein reicher Mann, — mehr aber nicht. Von nachsichtigen Eltern erzogen, hatte er nur das Notwendigste gelernt, was zur Bildung eines vornehmen Menschen nötig ist, der Sport überwog die Kenntnisse, und die heitere Lebensfreudigkeit den Ernst, der studiert, strebt, ringt und sich ein hohes Ziel setzt. Der einzige Beruf, dem Graf Alexis sich gewidmet hätte, wäre derjenige des Offiziers gewesen.
Er hatte auch bereits sein Fähnrichexamen gemacht, als eine sehr heftig auftretende Blinddarmentzündung ihm das Reiten auf Jahre hinaus unmöglich machte, und da der anstrengende Dienst in einem Gardegrenadierregiment erst recht Schwierigkeiten bereitete, so sah der junge Graf mit einem heiteren Lächeln und ohne die geringsten Seelenkämpfe von einem Eintritt in die Armee ab und lebte fröhlich und guter Dinge als freier Mann von seinen Renten.
Und das war der Gifttropfen, der in den Freudenbecher der Gräfin fiel.
Die Tatenlosigkeit ihres Mannes deuchte ihr geradezu unbegreiflich.
Wie war es möglich, dass ein begabter Mensch müssig durch das Leben bummelte, ohne den brennenden Wunsch zu hegen, auf der Leiter des Ruhms emporzusteigen, hoch — immer höher bis zu einem schwindelnden Ziel, von dem man auf seine Mitmenschen herabblickt wie der Adler auf das Gewürm, das ohnmächtig am Boden kriecht!
Gräfin Theodora empfand es als unerträgliche Qual, ja geradezu als Schmach, dass sie bei allen Festen, wo die Form und Etikette waltete, hinter den meisten Frauen zurückstand, deren Gatten eine Stellung in der Welt einnahmen. Ihre Titel und Mittel sprachen in diesem Falle so gar nicht mit, und alle Exzellenzen, Generalinnen bis zur Majorin herab hatten den Vortritt vor Gräfin Thum, die nicht einmal bei Hofe die Vorrechte der Landstandsdamen genoss, da die Thumschen Besitzungen in Österreich und der Schweiz lagen, der Graf aber eine Vorliebe für die Residenz M. besass und infolgedessen seinen dauernden Wohnsitz dort genommen hatte.
Anfänglich hatte Gräfin Theodora sich diese „Schattenexistenz“ nicht so schlimm gedacht. Ihr reiches, gastfreies Haus vereinigte die erste und vornehmste Gesellschaft, man rechnet es sich zur Ehre an, in den Thumschen Salons zu Hause zu sein, denn das gräfliche Paar war ungemein beliebt und fraglos der Mittelpunkt der Gesellschaft.
Bei Hofe so wohl gelitten, dass die hohen Herrschaften es nicht verschmähten, zu den glänzenden Festen im Hause des Grafen zu erscheinen, von den Künstlern wegen ihrer imposanten Schönheit geradezu gefeiert und umworben, blieb dennoch im Herzen der Gräfin ein feiner Stachel zurück. Sie war unbefriedigt, sie entbehrte just das, was sie am leidenschaftlichsten ersehnte.
Mit der ärmsten Exzellenz hätte sie getauscht, hätte all ihre Reichtümer freudig dahingegeben für das eine, stolze Bewusstsein, einen Mann zu besitzen, der eine hervorragende Stellung einnimmt, eine Frau zu sein, die erhobenen Hauptes voranschreitet, während die andern sein demütig folgen.
Der Graf ahnte nicht, wie bitter ernst es seiner jungen Frau mit dem Strebertum war. Er hielt ihren Ehrgeiz für eine fixe Idee, eine jener pikanten kleinen Schrullen, mit denen sich schöne Frauen gern interessant machen. Er lachte sie aus, wenn er sie in ihrem Boudoir antraf, russische oder italienische Vokabeln lernend, Kunstgeschichte treibend oder gar über einer Generalstabsarbeit grübelnd, die ein guter Freund „mit den himbeerfarbenen Streifen“ ihr voll freudigen Entzückens aufgezeichnet hatte.
„Ich glaube wahrhaftig, Frauchen, du willst noch General oder Professor werden!“ scherzte er, sich behaglich in einen Sessel werfend, das Bein überschlagend, dass der elegante seidene Strumpf über dem Lackschuh sichtbar ward, und die Zigarette mit weisser, ringgeschmückter Hand zu Munde führend; „o ja, ich glaube, du würdest famos mit einer Division oder gar einem Armeekorps fertig! Das Schicksal hat einen groben Schnitzer begangen, dich als Weiblein in die Wiege zu legen, wenngleich ich persönlich ihm von ganzem Herzen dankbar dafür bin!“
Und der Sprecher zog die schöne, energische Hand seiner Frau galant an die Lippen und blickte sie aus seinen blauen Augen so fröhlich an, wie ein Kind, das mit sich und der ganzen Welt zufrieden ist.
Die Gräfin schlang in aufwallender Empfindung die Arme um ihn.
„Alexis! Du hältst mich für eine hohe Stellung geboren, — hast du denn gar nicht den Trieb und Wunsch, mich einmal zur Exzellenz zu machen?“
Er lachte schallend auf. „Nein, Schatz! Etwas so Vergebliches, was wir beide kaum noch erleben würden, wünsche ich mir nicht!“
„Nicht mehr erleben?“
„Nun — wenn ich jetzt noch als Leutnant oder Studiosus anfangen wollte — was meinst du wohl, wie lange ich klettern müsste, bis ich die Exzellenz erreicht hätte?“
Sie seufzte tief auf und presste momentan die Lippen herb und schmerzlich zusammen. Dann nickte sie mit starrem Blick vor sich hin und strich mit der kühlen, schlanken Hand leicht über sein elegant gescheiteltes Haar.
„Ja, ja, ich sehe es ein, — es ist zu spät. Du kannst das Versäumte nicht mehr nachholen. Aber Alexis“ — sie richtete sich empor, ihr Auge blitzte auf, und ihre Brust hob sich unter tiefem Atemzug: „Wenn ich einmal einen Sohn haben werde — der soll alles erreichen, was mein glühendes Sehnen umsonst erstrebt!“
„Hoffen wir es, liebes Herz!“
„Er soll lernen — lernen — lernen!“ Wie ein Aufschrei klang’s von ihren Lippen, mit dem das harmlose Lächeln des Grafen seltsam kontrastierte.
„Armer Junge,“ scherzte er, „welch ein Glück für ihn, wenn er als Mädchen zur Welt käme!“
„Glück? Das nennst du Glück?“ rief sie erregt. „Fühlst du dich etwa glücklich ohne Stellung und Beruf?“
Er dehnte behaglich die Arme; das silberne Armband mit dem Georgsdukaten blitzte an seinem Handgelenk. „Unendlich glücklich!“ versicherte er, und seine weissen, gesunden Zähne blinkten durch den blonden Schnurrbart, und seine Augen strahlten wie wolkenloser Sommerhimmel. — „Ich sage dir, Theo — unsagbar glücklich! Ohne Ärger, ohne Sorgen, ohne Schinderei und Abhetzerei — ach, es ist schön, wenn man sein eigener Herr ist! Langweilen tue ich mich nicht, ich arbeite an unsrer Familiengeschichte, ich interessiere mich für die Neubauten auf den Gütern, ich wirke in allen möglichen Vereinen ... Ja, potz Wetter! Da fällt mir ja mein Kriegerverein ein! Wollen eine hübsche patriotische Feier haben, die Veteranen sollen noch einmal Lorbeeren für anno 13 pflücken! Gut, dass ich daran denke, will gleich mal zum Tivoli hinausfahren.“
Der Sprecher küsste das schöne, stolze, steinerne Gesicht seiner Gemahlin und schritt pfeifend aus der Tür, — die Gräfin aber stützte mit finsterm Blick das Haupt in die Hand.
Ja, es war zu spät! Für den Vater zu spät — für den Sohn nicht!
Ach, dass sie die Mutter eines Sohnes würde! Wie wollte sie Funken des Ehrgeizes in sein junges Herz streuen, wie wollte sie nur noch nach dem einen Ziele leben — durch den Sohn zu erreichen, was ihr durch den Gatten versagt blieb! — Macht! Stellung! Ehre! Einfluss! Dem Sohn soll es einst werden, und seiner Mutter soll er es verdanken!
Wie ein Schrei der Sehnsucht ging es durch das stolze, ehrgeizige Frauenherz, und doch vergingen noch drei Jahre, ehe sie voll jauchzenden Triumphs die Wiege für den Heissersehnten bereiten konnte.
Vier Jahre waren sie vermählt, alles, was sie für ihren Gatten in dieser Zeit erreicht hatte, war der Titel eines Kammerherrn, das war ein bescheidenes Ziel, — dem Sohn soll es weiter gesteckt werden, — hoch und weit! Oh, ihr schwindelt es selbst, wenn sie im Geist die Höhe sieht, auf der ihr Fleisch und Blut doch noch mal triumphieren soll.
Exzellenz auf jeden Fall! Als Minister — als Feldmarschall — als Kanzler — gleichviel! Nur Exzellenz! Sie ist verliebt in diesen Titel, sie erblickt in ihm das Ziel aller Wünsche. — Ein Sohn!
Herr des Himmels — und wenn es eine Tochter würde?
Die Gräfin fröstelt und beisst die Zähne noch fester zusammen.
Ihre Seufzer zittern durch das stille, nächtliche Gemach, und die alte Frau am Fussende des Himmelbettes erhebt sich leise und blickt prüfend in das schöne, bleiche Antlitz der jungen Frau.
Nur noch eine kurze Spanne Zeit — nur noch der letzte Sturm nach der Ruhe — dann weiss sie es, ob ein Sohn das Ziel erreichen wird!
Ein Sohn! — ach, nur ein Sohn!
„Ihre Frau Gemahlin hat sich absolut einen Stammhalter bestellt, Herr Graf!“ flüstert der Arzt lächelnd im Nebenzimmer. „Teilen Sie diesen Wunsch, oder darf ich auch eine kleine Komtesse bringen?“
Alexis strahlt über das ganze Gesicht. „Bringen Sie es nur! Was es ist — das ist mir ganz egal! Ja, ich glaub beinahe, ein Mädel würde mir noch mehr Spass machen! Ich gehöre nicht zu den ungalanten Männern, die nur in Söhnen ihren Stolz erblicken! Eine Tochter würde ich noch zärtlicher, noch inniger lieben, als meinesgleichen! Schon als Ebenbild der Mutter würde sie mir willkommener sein als ein Junge, der als höflicher junger Mann stets den Damen den Vortritt lassen muss. Erst ein Mädel! Was später kommt, können meinetwegen sechs Jungens sein!“
Die Herren nicken sich zu und lächeln, die Uhr verkündet die zweite Stunde — und der Graf füllt eigenhändig die Tasse des Arztes mit dem starken Kaffee, den er vorläufig dem Sekt vorzieht.
Draussen glitzern die Sterne, und der Mond wirft spiegelnde Bilder über die schneeige Pracht des Gebirges, und die Rehe im Park schrecken plötzlich zusammen und fliehen in schützendes Tannengebüsch — —
Ein Böllerschuss kracht von dem Schloss — noch einer — und abermals einer —
Und wie ein Jauchzen und Jubeln geht es durch das Schloss: Ein Sohn! Ein Sohn! — Es rollt in den Bergen und weckt das schlaftrunkene Echo — ein Schuss — noch ein Schuss — und die Leute im Dorfe drunten, die zuerst erschreckt aus den Kissen gefahren, lächeln und drehen sich behaglich auf die andre Seite.
„Auf Kochenhall ist ein Sohn geboren! Du liebe Zeit, wie wird sich die Gräfin freuen!“
Behagliches Dämmerlicht herrscht in dem eleganten Salon der Gräfin Theodora.
Kochenhall ist ein uralter Bau und kennt nicht die zierlichen Boudoirs moderner Villen und Paläste, in seinen Mauern dehnen sich grosse, weite, viereckige Gemächer, mit getäfelten Decken, die meist so niedrig sind, dass man Mühe hatte, die Kronleuchter aufzuhängen. Nur im Waffensaal, der Ahnengalerie und dem grossen, neu ausgebauten Speisesaal hat man die Decken um eine ganze Etage emporgerückt, und die kleinen, gewölbten Fenster mit den zwölffach geteilten und in Blei gefassten Scheiben zu hohen, hellen, kirchenartigen Bogen erweitert.
Die altertümlichen Gemächer hat man jedoch in ihrem charakteristischen Burgstil belassen, und Gräfin Theodora hat sich ein grosses Eckzimmer zu ihrem Salon gewählt, das durch einen achteckigen Giebelausbau, der gleich einem Schwalbennest an den Mauern über der steil niederfallenden Felswand schwebt, etwas ganz besonders Behagliches und Trauliches bekommt.
Giebel und Erkerchen, Türmchen mit trutzigen Zinnen sind überall an dem winkligen Gemäuer angeklext und gewähren zumeist die herrlichste Rundsicht über das Tal und das Hochgebirge, das seine imposanten Schneehäupter hoch in die Wolken hebt.
In dem offenen, altmodisch überdachten Kamin flammt ein gewaltiges Holzfeuer, dieweil der unentbehrliche „Amerikaner“, hinter hohem Eisengitter versteckt, dieses „Dekorationsfeuer“ durch wohltuende Wärme nachdrücklich unterstützt.
Wohl prangen an den Wänden alte Gobelins und geschnitzte Wappentafeln, schmiedeeiserne Leuchter und dunkelgebräunte Paneele, — auch mächtige Sitztruhen, uralte Sessel und Schränke füllen die Ecken, aber dazwischen hat man dennoch bequeme und moderne Möbel geschoben, ohne die eine verwöhnte Dame kein wahres Behagen finden kann.
Der vortreffliche Geschmack der Gräfin hat allerdings diese neumodischen Eindringlinge möglichst in den Rahmen der alten Bergfeste hineingepasst, hat die Bezüge der einzelnen Polsterstücke in denkbar ältesten Brokatmustern und -farben herstellen lassen, und es ist ihr gelungen, trotz der Verschiedenartigkeit eine entzückende Harmonie zu schaffen, die den Zauber des alten Burgzimmers in nichts zerstört und dennoch den Ansprüchen der Gegenwart Rechnung trägt.
Gräfin Theodora war stets eine auffallend schöne Frau gewesen, für manchen Geschmack freilich etwas zu marmorkühl und regelmässig, wie eine klassische Statue, die von ihrem Sockel herabgestiegen, zwischen Menschen zu wandeln, — jetzt aber, als ihr der heissersehnte Sohn im Arme lag und sie wieder und wieder mit langem, forschendem, beinahe prüfendem Blick sein kleines Gesicht umfasste, jetzt erst schien wahres Leben in ihren Adern zu pulsieren und ihre Schönheit voll erblüht zu sein.
Ein ganz neuer Ausdruck triumphierenden Stolzes lag auf dem ehedem so kühlen und gleichgültigen Gesicht, eine jauchzende Genugtuung, ein brennendes Interesse, das warmen Purpur in ihre Wangen trieb.
Die dunklen Augen leuchteten seelenvoller, befriedigter als zuvor, und um die Lippen spielte ein Lächeln sieghafter Freude, wie bei einem Menschen, der nach langem, ungeduldigem Harren endlich die Kampfbahn betreten kann, an deren Ende das heissersehnte Ziel winkt. Die junge Mutter lag bequem auf einem Diwan gebettet, in per eleganten, von Spitzen und Bändern umwogten Matinee schier königlich anzuschauen, und sie reichte der harrenden Kinderfrau mit strahlendem Blick ihren Sohn zurück, noch einen langen, beinahe weihevollen Kuss auf die kleine Stirn drückend.
Und dann, als man den Kleinen zum Schlaf hinaustrug, lehnte sie wie in träumerischem Sinnen das Haupt zurück, und ihr Blick flog hinüber zu der schlanken, vornehmen Gestalt ihres Mannes, der vor wenig Augenblicken den Platz an ihrer Seite verlassen, um in den kleinen Erker zu treten.
Die Hände lässig in die Taschen seiner Joppe versteckt, ganz leise eine heitere Melodie durch die Zähne pfeifend, stand Graf Alexis und blickte voll innigen Behagens in die herrliche, weissverschneite Landschaft hinaus.
Der Sturm pfiff und schrillte um die Mauern und Söller, Schneeflocken wirbelten in tollem Tanz durch die Luft, und drunten im Dorf blitzten die ersten Lichter auf, hier und da tönte ein schwacher Klang der Betglocke vom Schlossturm, und vom Wald herauf rauschten die Wipfel wie ferne Meeresbrandung.
„Weisst du, Liebling, dass ich Kochenhall im Winter schön finde, schöner beinahe als im Sommer?“ sagte er plötzlich und trat wieder neben den Diwan der Gräfin zurück. „Etwas so Urgemütliches wie solch ein ‚Verschneitsein‘ gibt es kaum wieder! Es ist einmal etwas andres, so ganz andres um diese Stille und Einsamkeit, als wie in der Residenz daheim! Theater und Konzerte gibt’s freilich nicht — und doch ist solch ein Winterbild im Hochgebirge auch ein Schauspiel, wie es majestätischer kaum zu finden ist, und der Schneesturm ist ein Konzert, das kein Kapellmeister in gleicher Grossartigkeit zustande bringt. — Solch ein Winteridyll auf Kochenhall ist wundervoll! Wirkt wie Karmelitergeist, der den Magen stärkt und Hunger macht! Was meinst du, Theo, wie das Leben nachher in M. schmecken wird? Herrlich! Man hat an allem, was einem mit der Zeit langweilig geworden, wieder neue und doppelte Freude! Und darum will ich dir einen Vorschlag machen: wir wollen jedes Jahr bis nach Weihnachten hierbleiben! Als Medizin und Lebenselixier! Und last not least als ein Wintermärchen, das wir als verzauberte Königskinder träumen! In M. muss ich dich mit einer endlosen Schar von Verehrern teilen, hier aber gehörst du mir allein, Theodora, und darum liebe ich Kochenhall als Schutzwarte meines Glücks.“
Der Sprecher küsste voll zärtlicher Galanterie die weisse, brillantenblitzende Hand, die in der seinen lag, und die Gräfin neigte das Haupt lächelnd gegen seine Schulter.
„Gut, Alexis, dein Wunsch soll mir Befehl sein, ich will dir jedes Jahr in Kochenhall neue Rosen der Liebe und des Glücks aus Schnee und Eis erblühen lassen, ich will gern bis nach Weihnachten hierbleiben und dir jedwedes Opfer bringen, das die Einsamkeit von mir verlangt — aber, ich verlange dafür eine Gegenleistung, die du, lieber Schwärmer, mir hoffentlich nicht versagst ...?“
Der Graf blickte lebhaft auf, sein Auge leuchtete, beinahe ungestüm drückte er die Lippen auf ihr Antlitz.
„Endlich, endlich einmal ein Wunsch!“ lachte er. „Gott sei Dank, Theodora, dass du mir auch einmal Gelegenheit gibst, Wachs in deinen Händen zu sein!“
„Wenn man alles hat, bleibt kein Wunsch mehr!“ scherzte sie. „Du hast mich mit allem, was das Herz begehrt, derart überschüttet, dass ich bisher nur deiner Generosität wehren musste!“
„Nun, und jetzt?“
„Jetzt möchte ich nur deiner Güte zuvorkommen und bitten, ehe du gewährst!“
„Alles, Herzliebste, alles!“
Sie sah plötzlich ernst zu ihm auf und drückte seine Hand fester. „Es ist ein seltsamer, ja ich möchte wohl sagen, ein ungebührlicher Wunsch, den ich äussern möchte,“ sagte sie leise, „denn ich weiss, dass ich mit ihm in deine Rechte eingreife! Dennoch versuche ich es und hoffe auf deine Zustimmung.“ — Sie zögerte momentan und blickte forschend in seine etwas erstaunt schauenden Augen. „Es betrifft unsern Sohn. Du weisst, wie unaussprechlich ich mir den Knaben wünschte, wie meine ganze Seele an dem Verlangen, einen Stammhalter zu besitzen, krankte. Nun ist mein Sehnen gestillt, er ist mein geworden! Mein und dein! — Man hat mir stets gesagt, dass ich viel Talent zum ‚Regieren‘ besitze —“
Er unterbrach sie lächelnd: „Das unterschreibe ich! Wessen Herz beherrschest du nicht? — Das Schicksal tat einen argen Missgriff, dass es dich nicht in eine Fürstenwiege legte, denn deine kluge, energische kleine Hand ist dazu geschaffen, die Zügel der Regierung zu führen, und doch bin ich ihm für diesen Missgriff so dankbar, denn er sicherte mir deinen Besitz!“
„Schmeichler! Ich werde dich beim Wort nehmen Gut; ich glaube selber, dass mir hervorragende pädagogische und beherrschende Talente gegeben sind. Ich bin überzeugt, dass ich die nötige Energie habe, einen Sohn zu einem hervorragenden Mann zu erziehen, und darum bitte ich dich mit aller Dringlichkeit, Alexis, vertraue mir unsern Sohn an, lass mich seine Erziehung leiten, über sein Tun und Lassen bestimmen, ihm ein Ziel setzen, was er mit Gottes und meiner Hilfe auch wahrlich erreichen soll!“
Die Sprecherin sah ernst, beinahe feierlich, mit wundersam blitzenden Augen zu ihm empor, Graf Thum aber lachte sorglos und sichtlich amüsiert auf und schlug in ihre dargebotene Hand ein.
„Aha! Minister oder Feldmarschall! Exzellenz auf alle Fälle! Topp, es soll gelten! Ich glaube selber, dass du es viel besser verstehen wirst wie ich, aus dem Schlingel etwas zu machen! — Gott sei Lob und Dank, dass ich nicht in seiner Haut stecke! Was wird der arme Kerl ochsen müssen!“
Theodora überhörte die letzten Worte. „Gut, ich habe dein Versprechen!“ sagte sie feierlich, „und ‚ein Mann — ein Wort‘. — Nun wird es meine erste Pflicht sein, schon jetzt den Lebensweg meines Sohnes nach Kräften zu ebnen und vorzubereiten, denn meine Ansicht ist es: die Schicksale eines Menschen können und müssen beeinflusst werden, soll er das Ziel erreichen, das man ihm steckt und als sein Glück erachtet!“
„Aber weisst du denn. Liebste, ob Rang, Stellung, Macht und Ehre auch wirklich das Glück des Kindes sein werden?“ warf Graf Alexis mit jäh aufkeimender Besorgnis ein. „Wir Menschen sind so individuell veranlagt, und was der eine Glück nennt — deucht dem andern eine Strafe!“
Die Gräfin richtete sich stolz empor. „Es müsste nicht mein Fleisch und Blut sein, wenn er so völlig den Sinn seiner Mutter verleugnen wollte! Ausserdem kann man durch eine richtige Erziehung und Anleitung schon frühzeitig Interessen in Kindern wecken, die ihnen sonst fernbleiben würden. Ein Bäumlein wächst, je nachdem es der Gärtner pflanzt, zustutzt und ihm fruchtbringende Zweige okuliert. Sei unbesorgt, Alexis; wenn du unsern Sohn meiner Leitung anvertraust, und nicht mit entgegengesetzten Plänen und Ansichten die Erziehung beeinflussest, wird er alle Hoffnungen dereinst erfüllen, die ich seit der ersten Stunde seiner Geburt in ihn setzte!“
„Gebe Gott, dass du das Rechte willst und erreichst, Theodora. Ich habe absolut keinen Sinn und kein Verständnis für Kindererziehung, und es ist mir tausendmal lieber, unsern Jungen unter deinen Händen, als unter denen eines fremden Erziehers zu wissen!“
„Ich danke dir, Alexis!“ Die Gräfin drückte ihm mit aufleuchtendem Blick die Hand und fuhr dann lebhaft fort: „Vor allen Dingen wollen wir schon jetzt an des Knaben Zukunft denken und für hohe und einflussreiche Paten sorgen — —“
„Ach, hältst du das bei einem Grafen Thum für notwendig?“
„Fraglos. Es gibt Situationen im Leben eines Mannes, wo weder Namen noch Geld allein etwas helfen, sondern lediglich Verbindungen von Nutzen sein können. Je einflussreichere Hände die Leiter halten, desto schneller und höher steigen diejenigen, die Karriere machen wollen!“
Der Graf lächelte abermals. „Aha! Das zielt wieder auf die Exzellenz! Gut, Frauchen, diese Vorlage wird ebenfalls ohne Debatte angenommen. Und wen gedenkst du zu Gevatter zu bitten?“
Theodora legte ihr schönes Haupt zurück und schloss momentan die unruhig flackernden Augen.
„Vor allen Dingen den Kronprinz Eckbrecht!“ sagte sie schnell und sicher. „Er wird nach menschlicher Berechnung die Regierung übernommen haben, wenn unser Sohn erwachsen ist und seiner Protektion bedarf!“
„Vortrefflich! Ich bin auch überzeugt, dass der hohe Herr, der dich stets durch besondere Gunst und mich durch sein nachsichtiges Wohlwollen auszeichnete, die Patenstelle annehmen wird. Der Junge muss dann selbstverständlich auch Eckbrecht getauft werden?“
„Ohne Frage. Der Namen muss stets an die angenehme Tatsache erinnern!“
„Und ferner? Wen willst du noch?“
„Die Verwandten zähle ich nicht besonders auf, ich nenne nur noch Major von Golfers ...“
„Golsers? — Wie kommst du auf diesen unliebenswürdigsten aller Grobiane?“
Die Gräfin lächelte.
„Man nennt ihn den zukünftigen Kriegsminister; er ist einer unsrer hervorragendsten Generalstäbler und wird gerade im Zenit seiner Macht und Karriere stehen, wenn unser Sohn seiner bedarf!“
„Hut ab, du Diplomatin! Ich sehe ein, du mischst dem Jungen die Karten schon jetzt mit einer Virtuosität, dass er fraglos das Spiel dereinst gewinnen muss! — Was ist los, Johann?“
Der Sprecher wandte sich nach der Tür, zwischen deren Portierenschals ein alter, weisshaariger Diener erschien und respektvoll stramm stehen blieb.
„Befehl, Herr Graf. Der Oberförster Schill hat soeben einen Boten geschickt mit der Meldung, dass im Tal, am Kochlerkessel, ein Rudel Schwarzwild eingespurt ist. Er lässt gehorsamst anfragen, ob der Herr Graf an einem Treiben teilnehmen wollten, und ob es passte, wenn gleich morgen losgegangen würde?“
Der Schlossherr von Kochenhall war lebhaft aufgesprungen: „Famos! Ausgezeichnet! Die Kochler Tannen sind königliches Gebiet?“
„Befehl, Herr Graf. Der Herr Oberförster hält die Jagd selber ab!“
„Wen hat er geschickt?“
„Den Steigertoni, Euer Gnaden!“
„Auf dem Korridor draussen?“
„In der Gesindeküche, Herr Graf; er war durchfroren und wärmt sich am Herd!“
„Gut, gut, — sorgen Sie nachher für ihn, dass er beköstigt wird. Ich komme mit Ihnen, um den Burschen selber zu sprechen.“
Graf Thum küsste hastig die Hand seiner jungen Gemahlin. „Entschuldige mich für ein paar Minuten, Angebetete — ich stehe sofort wieder zu deiner Verfügung!“
Er verliess hastig das Zimmer; Theodora lehnte das Haupt in die seidenen Kissen zurück und schloss die Augen.
Ein Lächeln hoher Zufriedenheit spielte um die stolz geschweiften Lippen. Ihr Wunsch war erfüllt. Sie hielt das Lebensbuch ihres Sohnes in der Hand und schrieb mit energischen Lettern sein Schicksal hinein, — soweit es in eines Menschen Hand gegeben. Und ihres Sohnes Glanz und Ehre, Macht und Stellung sollten sie dereinst entschädigen für das inhaltlose Leben, zu dem sie selber verurteilt war. Nun wurzelt all ihr Interesse, all ihr Hoffen und Streben in der Zukunft des Sohnes, und sie wird ihn gängeln und leiten, heben und stützen, ihn treiben und fördern bis hoch empor zum Ziel!
Zweites Kapitel
Ei, was für ’nen prächtigen Bub’ hab’ ich!
Die Händlein so drall
Und die Lenden so prall
Und das Näschen so fein
Und das Mündchen so klein
Rudolf Löwenstein.
Nahe am Dorf drunten, im Laubwald, der seitlich den Kochenhaller Schlossberg säumt, liegt die königliche Oberförsterei.
Still und einsam ist es in dem geräumigen Haus geworden, seit Susanne Schill, die blühendfrische Tochter des Oberförsters, den Vater verlassen hat, um ihrem schmucken Herzliebsten, dem königlichen Feldjägerleutnant Seehofer, als glückstrahlendes Weib in die neue Heimat zu folgen.
Da war das Lachen und Singen im Forsthaus verklungen.
Der alte Herr ging nachdenklich und mit ernst gefurchter Stirn umher, hatte sich noch den Phylax und die Waldine zur Gesellschaft in seine Stube geholt, obwohl der Feldmann und die Juno bereits die Ofenecke zu Erb und Lehn erhalten hatten, hing noch ein paar Käfige mit Dompfaff und Zeisigen mehr am Fenster auf, und doch wollte das frohe, lustige Leben nicht wieder Einkehr halten.
Frau Zirblerin, die rüstige alte Wirtschafterin, ging auch umher, als sei ihr die Butter vom Brot genommen, seit die Susanne aus dem Hause war, — sie schalt nicht mehr über die Hunde und Jägerburschen, sie grollte nicht mehr, wenn der alte Herr den Pfeifenkopf auf die frischgescheuerten Dielen ausklopfte, sie verlangte nicht mehr voll würdiger Energie „alleweil ein Rehblatterl zum liebsten“, — sie schlich wehmütig treppauf, treppab, lüftete dem Susei das Zimmerchen alle Tag, als ob’s jeden Augenblick wiederkommen müsst’, das liebe Dirnei, und hatte verweinte Augen, wenn die alte Stine, die von der Post Wegen die Briefe austrug, an der Oberförsterei vorbeikraxelte, ohne mit einem Schreiben von Susei einzusprechen.
Zuerst hatte auch das dralle, blauäugige Roseli, die als Magd im Forsthaus diente, gezwitschert und jubiliert wie ein Finkenweibchen, als aber im Herbst ihr Wastl1) sich hatte stellen und als Rekrut fort müssen, da war es auch mit des Roselis Freud’ zu Ende! Wenn es daran dachte, wie der Wastl ihm zum letztenmal das Gesicht abbusselt und gesprochen hatte: „Ich muss jetzt fort; sei zufrieden, Roseli, und bleib’ in Frieden zurück“, ach, dann gingen ihm sofort wieder die Augen über, und wann die Zirblerin es anliess: „Was flennst, du Dalk mit deinem alten Weibergetrenz?“ — dann schlug es nur in grossem Jammer die Hände zusammen und rief: „Kreuzunglücklich bin ich! Und kreuzunglücklich sind wir alle miteinander!“
Da hatte die Zirblerin auch schweigend nach dem Schürzenzipfel gegriffen: „Das schon!“ Und hatte mit viel Lärm und Geräusch in der Küche herumhantiert.
Sollte sie’s auch nicht? — Sie hatte die Susei von ihrem ersten Lebenstage an auf den Armen gewiegt und die Kleine liebgehabt wie ein eignes, und als die Oberförsterin vor Jahr und Tag an dem bösen Sturz aus dem Schlitten heraus gestorben war, da hatte sie Mutterstelle bei dem armen, verwaisten Dirnei vertreten und mit der Zeit gar geglaubt, sie habe die Kleine fein selber geboren und sei ihm mit Leib und Seel’ eine Mutter geworden.
Nun war der Herbst vorüber, das bunte Laub bedeckte fusshoch den Waldboden, und die Berge droben hatten weisse Mäntel umgehängt; da zogen die Sennen mit dem schmuckbekränzten Vieh zu Tal und machten sich’s bequem zur langen Winterrast.
Den Pfad empor aber war die alte Stine gekeucht, sie trug in einem Sacktuch all die geschnitzten Löffel und Quirle, die ihr Grosssohn, der Gaisbub, auf der Alm droben während der Sommerzeit geschnitzt hatte. Die Alte lachte über das ganze sonnegebräunte, wetterharte Gesicht und reichte schon von weitem der Zirblerin ein Schreiben entgegen.
„Endlich kommt’s, das Brieferl,“ rief sie, „das g’freut mich damisch.“
Die Wirtschafterin ward dunkelrot vor Entzücken, als sie Suseis Handschrift erblickte. Sie fasste das Briefchen sorgsam mit dem Schürzenzipfel und murmelte mit feuchtem Blick, wie sie es früher so oft getan, wenn ihr schmuckes Pflegekind durch irgendeine Liebestat ihr das Herz im Leibe lachen liess: „O du mein lieb’s Dirnei!“ Und dann winkte sie wohlbehäbig der Stine und schob sie mit der linken Hand über die Schwelle: „Verschnauf’ ein bisserl! Ich hab’ einen Guglhopf ’backen, dass’s eine Freud’ ist! Ich geb’ dir gleich ein grossmächtig’s Stück davon, wo die mehrsten Weinbeerln einbacken sind, und auch Kaffee dazu! Geh eini!“
Das liess sich das alte Botenweiblein nicht zweimal sagen, sondern stampfte mit ihren Nägelschuhen eilig in die Küche, der verheissenen Herrlichkeiten froh zu werden; die Zirblerin aber trat mit glänzenden Augen über die Schwelle, in des Oberförsters Amtszimmer und bot den Brief dar, mit einer Miene, als habe sie ein Königreich zu geben.
Was der Brief an Nachricht brachte, war in des alten Herrn und der Zirblerin Augen vielleicht noch mehr wert als solch ein Stück Land und Leute, das nicht jederzeit ein Freudenquell für seinen Herrscher bildet; der Susei Zeilen jedoch glichen einem wahren Wirbelsturm der Wonne, der urplötzlich unter das Dach fegt und das unterste im Haus zu oberst kehrt!
Du lieber Gott! War das eine Überraschung, war das eine Herzensfreude!
Selbst dem alten, wetterfesten Oberförster wurden die Augen feucht vor Glückseligkeit, und die Zirblerin hielt sich zwischen Lachen und Weinen den Kopf und rief nur ein um das andre Mal: „O du mein! O du mein! Das Susei kommt heim und bringt uns noch was mit!“
Und das war wirklich und wahrlich so.
Die junge Frau Feldjägerleutnant schrieb einen langen Brief und teilte dem Vater mit, dass ihr Mann ganz urplötzlich mit wichtigen Briefen als Kurier nach Petersburg geschickt sei. „Was die Reise im Grunde noch bezwecke, wisse sie selber nicht, das sei Dienstgeheimnis, aber ihr Oswald bleibe diesmal viel länger fort, ja, es könne vielleicht ein Vierteljahr ins Land gehen, ehe er wieder dauernd daheim bleiben könne. Da sei es ihr bang, so allein in der fremden, grossen Stadt, wo sie so gar keine treue Seele wisse. Auch Oswald sorge sich, sie ohne Schutz und Schirm zurückzulassen, um so mehr, als gerade ihr schweres Stündlein in diese Zeit der Trennung falle.
Nun sei sie zu dem Entschluss gekommen, für die lange Zeit heimzureisen, dem frohen Ereignis im Forsthaus, unter der Zirblerin treuer Pflege, entgegenzusehen.
Der Vater möge ihr doch bis R. entgegenkommen und sie dort an der Bahn in Empfang nehmen, und die liebe, gute Zirblerin möge ihr die Wochenstube fein behaglich herrichten und die alte Holzwiege vom Boden holen und blankputzen lassen! ...“
Ach, war es denn nur möglich, nur zu glauben?
Sollte es wahrlich noch mal in dem stillen, öden Forsthaus lebendig werden?
Ja, nun klang es wieder hell und lustig durch die verlassenen Räume!
Nun begann wieder ein rühriges Leben und Treiben in dem alten Forsthaus, ein Scheuern und Putzen, Fegen und Lüften, ein geheimnisvolles Hin und Her in dem ehemaligen Jungfernstübchen der Frau Leutnant!
Vom Boden herab schleppten die Zirblerin und Roseli die mächtige Wiege auf den breitgeschnitzten Kufen, bürsteten, wuschen und polierten das gedunkelte Holz, bis es glänzte wie nagelneu; das rote Herz in dem gemalten Blumenkranz war recht abgeblichen, darum kam der alte Hiesel2), der Waldläufer, der bei einer Bärenhatz vor Jahren zu Schaden gekommen war und nun mit seinem Stelzbein als wohlbrauchbarer, stets hilfsbereiter Einleger im Forsthaus herumhumpelte, mit einem roten Farbentöpfchen und pinselte das verblasste Herz neu über, dass es feuerrot brannte, so recht in „Wonnen flammte“, weil es nun wieder zu Ehren kommen und der Susei ihr Kindli schaukeln sollte.
Endlich war’s so weit.
Das ganze Haus roch nach Kuchen und Schmalz, die Diele war so blitzblank gescheuert und mit grünen Tannenzweiglein bestreut, dass man glauben konnte, auch im Hause drinnen sei frischer Schnee gefallen.
Die mächtigen Kachelöfen waren noch einmal so vollgestopft als sonst, dass die Bratäpfel in der Röhre krieschten und dampften und sicher verbrannt wären, wenn der Hiesel im letzten Moment nicht noch nach dem Rechten geschaut hätte!
Endlich klingelte es den verschneiten Weg empor. Die beiden Forstgehilfen standen an den Tannen droben und schwenkten mit frischem Juhschrei die grünen Hüte, und die alte Stine, die just des Wegs kam, stand still und fuchtelte in ihres Herzens Freude mit den Armen durch die Luft.
„Grüss dich Gott, Susei!“ — schrie sie, so laut sie es konnte, und der Oberförster nickte ihr mit strahlenden Augen zu, und die junge Frau beugte sich vor und winkte fröhlich mit der Hand.
Ja, nun kam sie! Und die Zirblerin klopfte die Schürze ab und schritt gravitätisch herzu, hob die Frau Leutnant selber aus dem Schlitten, behutsam und vorsichtig, als fasse sie ein rohes Ei, und sagte dann barsch: „Trampelt’s mir nit das Schneewasser auf den Fussboden!“ — denn sie hielt es nicht für schicklich, weich zu sein und zu flennen, sondern wollte dem jungen Weiblein zeigen, dass sie voll reputierlicher Würde nach wie vor dem Hause vorstand.
Frau Seehofer umarmte und herzte aber die Alte, als ob sie ihr das zärtlichste Willkommen gesagt hätte, und da hielt das „barsche Getu“ nimmer stand, — die Zirblerin hing am Hals ihres Lieblings und weinte lachend ihre dicksten Freudentränen. Wie schmuck und schön sah die junge Frau aus, so recht wie eine Rose, die sich eben frisch erschliesst, und ganz so fröhlich und guter Dinge wie ehemals, als sie noch die langen, flachsblonden Zöpfe keck im Nacken schwang. Jetzt waren sie sittsam hochgenestelt, und die Kleidung war städtisch und elegant, wie es einer Frau Leutnant zukommt. — Frau Susanne aber trat alsbald vor das hohe Kleiderspind in ihrer Mädchenstube, schloss es auf und blickte mit leuchtenden Augen auf die feschen kurzen Röcklein, das Miederleibchen und Fürtuch, das noch darin hing.
„Über ein paar Wochen zieh’ ich’s wieder an, Zirblerin,“ sagte sie, „es gehört nun mal zu den Bergen, und man schreitet ganz anders aus und hantiert viel flinker in diesem lieben Zeug!“
Ja, in ein paar Wochen!
Wär’s nur erst so weit!
Aber die Zeit flog plötzlich dahin, als das fröhliche Lachen der Susei wieder durchs Haus klang, und dann kamen ein paar Tage, wo die junge Frau still und ernsthaft sinnig in ihrem Stüblein stand, die Arme in heisser Sehnsucht am Fensterlein ausbreitete und mit dem Blick weit hinaus, bis zum fernen Russland schaute.
„Ach, dass du hier wärest, du herzlieber Mann!“ flüsterte sie, und an ihren langen Wimpern zitterte es feucht.
Die Nacht kam herauf, die kalte, sternklare Winternacht, und als vom Schloss Kochenhall die Böllerschüsse krachten, da stand auch der Oberförster Schill und dankte dem Himmel mit gefalteten Händen für den Enkelsohn, den er ihm geschenkt.
Die Roseli aber stürmte in stolzem Übermut vor das Forsthaus und schwenkte die Arme gegen das Schloss.
„Spreizt’s euch nit gar so arg“, schrie sie durch den Schneesturm. „Wir haben auch ein Bübli, und was für eins!“
Und sie lachte und flog dem alten Hiesel an den Hals, im Triumphe wiederholend:
„Ein Bub ist’s, ein Mordsbub! Und uns g’hört er, gelt?“
„Selb ist wahr!“ nickte der Hiesel und schluchzte und schluckte die Rührung tapfer hinab: „Und zu Maria Lichtmess schenk’ ich dem Bübli mein’ Stutzen — schau, Röseli ich selber kann ihn fein doch nimmermehr auf die Alm ’nauftrag’n.“
Es war Abend geworden; der Seehofer und sein junges Weib sassen Arm in Arm auf dem breiten, bequemen Ledersofa unter den mächtigen Hirschgeweihen und waren so ganz und gar in ihr Glück und die Freude des Wiedersehens versunken, dass sie gar nicht merkten, wie der Mond über die Schneekuppen der Alp stieg und seine ersten matten Silberstreifen über die weissgescheuerten Dielen malte. Der Oberförster sass am Fenster und rauchte gemütlich seine Pfeife, Waldmannerl und Phylax lagen zu seinen Füssen und schnarchten vernehmbar in schönstem Traum, die Uhr tickte, und die Vögel im Käfig rückten noch enger zusammen und steckten die Köpfchen unter die Flügel.
Welch ein weltferner Frieden, welch ein seliges Behagen in dem kleinen Stübchen des Forsthauses!
Der Oberförster blickte schmunzelnd auf das überglückliche junge Paar, und dann flogen seine Gedanken zurück zu einer Zeit, wo auch er in jenem Sofaeckchen sass, sein blühendes, junges Weib im Arm, das Herz so übervoll von Hoffen und Wähnen, so weit und warm, so himmelaufjauchzend in wolkenlosem Glück!
Seine Friederike! Sein liebes, liebes Weib! — Schon lange ist sie von ihm gegangen, und die Einsamkeit und stille Trauer haben sein Haar vor der Zeit gebleicht, darum nennt man ihn auch allgemein den „alten“ Herrn, und doch steht er noch in rüstiger Vollkraft des Mannes.
Voll Wehmut sinkt sein Haupt tiefer, er blickt hinaus in die Dämmerung und faltet die Hände.
„Ja, Herr, es will Abend werden! — Und doch lässest du es nicht dunkel um mich sein. Wie der milde Mondesglanz leuchtet meiner Kinder Glück in mein Alter, und über mir wacht als heller, winkender Stern das treue Auge meines Weibes — Herrgott, ich danke dir.“
Neben ihm am Sofa flüstert’s:
„Wie wir ihn nennen wollen, Herzensschatz?“ sagt die junge Frau und drückt das Köpfchen fester an die Brust ihres Gatten: „Darf ich den Namen wählen? Ja? Oh, dann lass es doch ‚Friedrich‘ sein! Zum frommen Gedenken an mein lieb’s tot’s Mutterl, das all die Freude nicht mehr erleben sollte, und das doch gewiss als lieber, lichter Engel neben uns steht, wenn wir unser Kind zum Altar des Herrn bringen! Bist du es zufrieden, du lieber, bester Mann?“
Er küsste ihre Lippen: „So sollen es unser beider Mutter Namen sein, die er trägt, damit keine vergessen sei!“
„Die deine hiess Franziska?“
Er nickte.
„So lautet es: ‚Friedrich Franz‘! O wie schön und fesch das klingt!“ jubelte sie auf, „und Friedel oder Frieder wird er gerufen, gelt?“
„Wenn er brav ist!“
„Und solang er klein ist!“
„Ist’s erst ein Schulbub, lautet es schon ernsthafter Friedrich-Franz!“
„So soll er Friedrich gerufen werden? Franzel klingt auch gar herzig!“
„Ja, für eins müssten wir uns entscheiden, denn zwei Namen sind zum Rufen zu lang!“
„Und das klingt auch so gar vornehm, wie ein regierender Herr!“
Der Leutnant lachte: „Und das soll dein Bub nicht werden, Weibchen?“
Sie schlug ganz erschreckt die Hände zusammen. „Um alles! Davor behüte ihn Gott!“
„Ei warum? Denk’, wenn der Bub einmal in einem solchen Schloss wohnte wie der Graf droben!“
„Wer weiss, ob er dann glücklich wär’!“
„Das freilich. Das Glück wohnt nicht auf der Höhe, sondern zumeist im Tal!“
„Wenn er nur gesund ist!“
„Und ein braver, tüchtiger Mann wird!“
„Der das seine schafft!“
„Ein fescher, froher Jägerbursch!“
„Mit dem Herz auf dem rechten Fleck!“
„Und so viel gutem Mutterwitz, dass er glatt durch die Welt kommt!“
„Sein Brot wird er schon finden, darum bangt mir nicht, nur seine heile Haut und gerade Glieder möge ihm der liebe Herrgott erhalten!“
„Und sein Leben geniessen soll er! Seine Freude an der schönen Gotteswelt haben, lieben, freien und ein Büblein auf den Knien wiegen und just so glücklich sein wie wir!“
„Das soll er! Gott helf’!“
Die Zirblerin war just eingetreten, die Lampe auf den Tisch zu setzen.
Sie hörte das Gespräch mit an und mumpfelte ein paarmal mit dem Mund, als wolle sie gern auch ihre Ansicht äussern.
Das junge Elternpaar war so sehr in seine Pläne und Hoffnungen vertieft, dass es ihm nicht in den Sinn kam, die treue alte Seele dazu aufzufordern.
Da hielt sie es nicht länger aus.
Sie strich gravitätisch mit den Händen über die buntblumige Schürze und blieb neben dem Tisch stehen.
„Mit Vergunst,“ sagte sie, „ist’s wahr, dass dem Bübli seine Tauf’ am Heiligendreikönigstag sein soll? Selb ist eine gute Wahl, und ich mein’, das weissaget ihm viel Ehr’ und ein fürnehmes Geschick.“
„Da drum geschieht’s nicht, Zirblerin!“ lächelte Seehofer. „Unser Sinn steht nicht so hoch, und wir wählen den Tag nur, weil er noch in meinem Urlaub liegt und die Susei ihn immer gut leiden mochte!“
„Nit so hoch hinaus soll der Kleine?“ wiederholte die Alte und zog die dichten Brauen zusammen. „Und warum denn nit? Wenn eines zu seiner sauren Suppen noch ein Knödel oder gar ein Lämmernes haben kann und etwan noch ein’ Wein, ich denk’, da greift man halt zu.“
„Ei gewiss! — Was der Friedel sich mal verdient, das hat er und das geniesst er!“
„Verdient? Na ja, das kommt auch. Ich mein’ aber: Es gibt Lumpen auf der Welt und Glückskinder. Was dem ein’ niemals zusteht, das fallt dem andern von selber in den Schoss.“
„Wie meinst du das, Zirblerin?“
„Ich hab’ so denkt, eine Schand’ wär’s grad nit fürs Hascherl, wenn der Graf oder die Gräfin droben seine Taufpaten werden möchten. So ein Herr sorget schon für den Buben und tät’ ihm aushelfen, wann er einmal eine Hilf’ brauchet.“
Die Susei lachte hell auf, und der Feldjägerleutnant stimmte fröhlich ein.
„Gott bewahre, Zirblerin! Sie hat ja plötzlich den Hochmut g’kriegt! — Der Graf der Pate zum Friedel? Wozu das? Wäre mir leid um den Buben, wenn er so ein Lapperl würde, dass er Hilfe brauchte, um es in diesem Leben zu was zu bringen. Selber ist der Mann! Almosen taugen nie etwas, aber die Taler, die man mit seiner Hände Arbeit, aus eigner Kraft, erwirbt, die klingen! Schaut, Zirblerin, ich denke, unser Junge braucht kein Gängelband, der läuft allein seinen Weg!“
„Das schon; aber ob der Weg zum Glück oder ins Elend führt, das ist die Frag’.“
„Ein jeder ist seines eignen Glückes Schmied, Zirblerin, und kein Mensch kann zuvor wissen, wo des andern wahres Glück blüht, — drunten oder droben. Behagt’s dem Friedel mal, emporzukommen, ei, so mag er kraxeln und sich selber sein Ziel stecken, — erreicht er’s, nun so hat er es selber gewollt, und des Menschen Wille ist sein Himmelreich, während das Schönste und Beste, wenn es aufgezwungen ist, den querköpfigen Menschenkindern selten nach Geschmack ist! — Wenn der Friedel ein Flank wird, nutzten ihm zehn Grafenpaten nichts, wenn er aber ein fescher Kerl ist, der sich selber sein Ziel setzt — dann braucht er keine Hilfe, dann erreicht er’s doch!“
„So lassen wir’s dabei, in Gottes Namen,“ seufzte die Zirblerin, „möglich, dass er so auch zurechtkommt!“
Der Seehofer und die Susei drückten sich die Hände und sahen sich fest in die strahlenden Augen, nickten einander voll heiterer Zuversicht zu und küssten sich.
„In Gottes Namen!“ wiederholte die junge Frau leise.
Drittes Kapitel
„Abschied nehmen — sagt er,
Ist nit fein — sagt er,
Und es muss halt — sagt er,
Dennoch sein! — sagt er,
Wisch’ die Äugerln — sagt er,
Sachte aus — sagt er,
Fallt ein Tränerl — sagt er,
Still heraus!
Österreichisch.
Es schien beinahe, als ob die gräflichen Herrschaften der Zirblerin Ansinnen erraten hätten und es dem jungen Paar im Forsthaus recht nahelegen wollten, des kleinen Friedels Taufpate aus dem Schloss zu holen.
Die Gräfin hatte schon wiederholt in das Forsthaus herabgeschickt, Körbe voll Wein, Süssigkeiten und seltener Früchte, und dabei nach dem Befinden der Frau Seehofer und ihres Erstgeborenen fragen lassen, und sie hatte so viel wissen wollen, wie schwer das Büblein gewogen habe und wie es ausschaue, und ob es viel schreie oder zur Nachtzeit gut schlafe, und ob es die junge Mutter selber nähre, oder ob es eine Amme habe, und was dergleichen mehr war.
Die Zirblerin tat sich auf all diese Freundlichkeit viel zugute und gab prompten Bescheid: „Wägen oder messen täte sie das Hascherl nit, denn das bringe Unheil und tauge nichts, aber das Bübli sei gar ein strammes und habe wohl gleich mehr gewogen als ein halbwüchsiges Rehkitz oder ein feister Novemberhas. Und die Susei wär’ ein kerng’sundes Leut und gäb’ dem Söhnli selber die Brust, und schreien tät der kleine Flank gar wohl, zuerst auch nächtens, aber nun gewöhn’ er sich an die Weltordnung und gäb’ einen Fried! — Und wenn’s vergunnt wär’, dann wollte sie, die Ambrosia Zirblerin, selber mal zum Schloss hinaufsteigen und der Gnaden Frau Gräfin Bescheid und schön’ Dank bringen, denn vorerst könne die Susei noch nicht in den Schnee hinaus.“
Der Feldjägerleutnant, der auf einer Jagd mit dem Grafen zusammengetroffen und nebst dem Oberförster aufs Schloss geladen ward, machte zuvor seinen Besuch bei der Gräfin und hatte auch den kleinen Eckbrecht zu sehen bekommen.
„Zart ist das Kind, so recht ein Prinzlein aus blaustem Blut,“ sagte er, „aber gesund ist er, und wenn sie ihn recht frank und frei aufwachsen lassen, kann er sich mit unserm derben Schlingel schon getrost mal raufen!“
Und dann kam die Zeit, wo auch die Susei in der kleinen Halbchaise des Vaters zum Schloss fahren konnte. Ihre frische, blühende Schönheit, ihr herziges, kindlich treues Wesen, das bei aller Harmlosigkeit doch nicht der städtischen Formen und des feinsten Taktes entbehrte, entzückte die Gräfin ungemein. Die beiden Büblein bildeten das Band, das die jungen Mütter unwiderstehlich zueinander zog, und es war bald eine gewohnte Sache, dass die gräfliche Equipage vor der Obersörsterei hielt, um Theodora als herzlichst begrüssten Kasseegast zu bringen.
Da wiegte sie auch den kleinen Friedel auf den Armen, ganz entzückt von dem rosigen, lachenden Schelm mit den blanken, rehbraunen Augen und dem blonden Krakeelstrupp über der Stirn, der dem Kleinen ein gar lustiges, fideles Ansehen gab.
Sie Zirblerin leistete wahre Wunderdinge der Backkunst, und wenn die grosse, braune Kaffeekanne auf dem blendend weissen Tischtuch stand und die Alte die buntgeränderten Schüsseln voll Spritzkuchen, Kräpfli, Nestli und Rahmkuchen auftrug, dann konnte sie nichts stolzer machen und mehr beglücken als der entzückte Ausspruch der Gräfin: „Mir deucht, Frau Zirblerin, so gut wie hier hat mir der Kaffee und Kuchen noch nie geschmeckt!“
„Gott geseg’ns der Frau Gräfin!“ — knickste die Alte und hatte die grösste, allergrösste Tasse für den hohen Besuch herzugerückt, denn so Not leiden, wie im Schloss, wo die Schälchen knapp so gross waren wie ein Fingerhut, — nein, das sollte kein Gast in des Oberförsters Hause!
Die Zeit verging, die Schneewolken verzogen, und die weissen Alphäupter hoben sich glänzend gegen den blauen Himmel.
Lawinen stürzten fernab zu Tal, und die Gebirgsbäche und das Flüsschen schäumten hoch über und verwandelten die Talwiesen in einen weiten, glänzenden See.
Der Föhn sauste feuchtwarm durch die Schluchten, und die zarte Fussspur des Lenzes ward sichtbar in tausend jungen Grashalmen, tausend frischen Moosspitzen und schwellenden Knospen. Wundervoller frischherber Duft würzte die Luft, über Nacht rieselte der Regen und trommelte an die Fensterscheiben, und das Stinli konnte sich kaum noch bergan schleppen, so klebte das Erdreich an seinen Nagelschuhen.
Die gräfliche Familie war nach der Residenz abgereist und beabsichtigte erst im Spätsommer wieder nach Kochenhall zurückzukehren, und auch das Susei ging mit glänzenden Augen umher und rüstete sich zum Abschied. Der lag schon jetzt wieder wie eine unheilschwangere Wolke über dem Forsthaus; all die frohen Gesichter hatten sich in trübselige Mienen verwandelt, und die Seufzer waren zahlreicher als das Lachen und Singen, und der Zirblerin und des Roselis Augen sahen oft so rot aus, dass der Schürzenzipfel nimmer davonkam. Selbst der Hiesel, der wohl hier und da eine gotteslästerliche Red’ vollführt hatte, sonst aber ein frommes Mannsbild war, liess gar nicht mehr ab von grausigen Schwüren und Flüchen, aber er wischte sich auch die Augen dazu, und selbst ein Geselchtes und die Mass Bier schmeckten ihm nicht mehr.
„Was hast nur, Hiesel, bist krank?“ fragte die Susei herzlich und legte ihm die Hand auf die Schulter. Da wandte er sich zur Seite.
„Ich kann nit schlafen!“ brummte er. „Und das kommt bei mir vom Herzen, sagt der alte Hüter im Selchtal. Ich kann mir nit genug schnaufen, und ich därf aufpassen, dass sich nix anders noch dazu schlagt.“
„Was du nit sagst, Hiesel, das wär’ nit gut.“
„So eine Herzkrankheit kann ein’m über Nacht den Rest geben, mein’ ich“, seufzte der Alte.
„Red’ nit so dumme Sachen! Dir fehlt’s nirgends nit. Nur verdriesslich bist, weil das Bübli fort kommt! Sei kein Narr, Hiesel! Um Mariä Himmelfahrt herum sind wir ja sicher wieder da.“
„Selb ist eine lange Zeit, Frau, aber wann du mir den Handschlag gibst, dass du Wort halt’st —“
„Da, hier hast ihn! — Und nun bist wieder fidel und machst keine Faxen mehr mit einer Krankheit! Da schau! Jetzt lachst wieder! Wenn du nix anders zu tun hast, dann trag’ den Friedel ein bisserl vor die Tür.“
Da lachte der Hiesel wirklich über das ganze Gesicht und stelzte davon, so schnell es nur ging, und rief nur: