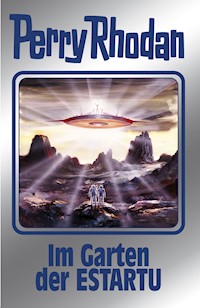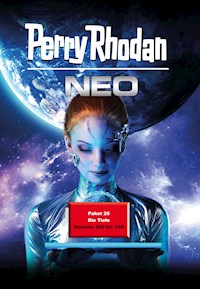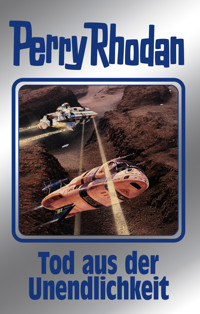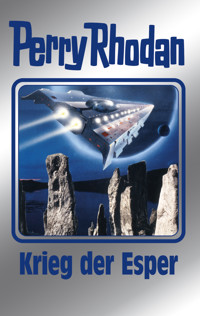Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: PERRY RHODAN-Androiden
- Sprache: Deutsch
Mehr als 3000 Jahre in der Zukunft: Die Menschen haben viele Welten in der Milchstraße besiedelt. Sie leben und arbeiten friedlich mit den Angehörigen anderer Sternenvölker zusammen. Doch dann greifen unbekannte Roboter eine Welt an – es ist der Anfang ihres brutalen Feldzugs. Woher kommen diese Droiden, und warum sind sie so aggressiv? Die Roboter folgen einem uralten, unheilvollen Programm, das Tod und Vernichtung bringt. Sie behaupten, zum Wohl der Menschheit zu handeln. Um die Bedrohung auszuschalten, muss Perry Rhodan gegen alte und neue Feinde kämpfen – und er muss Rätsel aus tiefer Vergangenheit lösen … Zwölf spannende Science-Fiction-Romane, verfasst von einem Team deutschsprachiger Autorinnen und Autoren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1736
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Vorwort
Nr. 1 – Totenozean
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
Prolog: Perry Rhodan und Gucky
1. Drei Wochen zuvor auf Chentap
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Epilog: Perry Rhodan und Gucky
Nr. 2 – Der falsche Feind
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
Prolog
1. Junia
2. Zwei Wochen zuvor
3. Junia
4. Aurelia Bina
5. Junia
6. Aurelia Bina
7. Junia
8. Aurelia Bina
9. Junia
10. Aurelia Bina
11. Junia
12. Aurelia Bina
13. Junia
14. Gucky
Nr. 3 – Der Jahrtausendirrtum
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Die erste Schlacht
2. Ein besonderer Morgen
3. Nach der Entführung
4. Humanitäre Katastrophe
5. Wer ist der Feind?
6. Testszenarien
7. Alleingang
8. Glückssträhne
9. Gefahr aus der Vergangenheit
10. Probieren geht über Studieren
11. Solang noch Hoffnung ist
12. Wie in alten Zeiten
Nr. 4 – Willkommen in Menschenstadt
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Ungelöste Fälle
2. Auf der langen Reise
3. Ein bunter Strauß an Verschwörungen
4. Willkommen in Menschenstadt
5. Der Fremde in der Klinik
6. Die verbotene Zone
7. Auf Stradams Spur
8. Philips sieht
9. Treibjagd
10. Gastfreunde
11. Der Schleier
12. Der Preis der Freiheit
Nr. 5 – Nekropole der Chenno
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
Prolog – Maurixe: Blutmarmor
1. Aurelia Bina: Das Beste, was wir haben
2. Johann Aspra: Logenplatz
3. Aurelia Bina: Der Teufel steckt im Detail
4. Johann Aspra: Wo bin ich?
5. Aurelia Bina: Geheimes Treiben auf Chentap
6. Johann Aspra: Traumatherapie
7. Johann Aspra: Nekrolog
8. Aurelia Bina: Wiedersehen macht Freude
9. Johann Aspra: Gewissensentscheidung
10. Aurelia Bina: Hilfe aus dem Jenseits
11. Johann Aspra: Die Enthüllung
Nr. 6 – Adams Ruf
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Marlynn Kane
2. Perry Rhodan
3. Kor Chappal
4. Marlynn Kane
5. Kor Chappal
6. Marlynn Kane
7. Perry Rhodan
8. Kor Chappal
9. Marlynn Kane
10. Kor Chappal
11. Marlynn Kane
Nr. 7 – Der menschliche Faktor
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Johann Aspra
2. Aurelia Bina
3. Johann Aspra
4. Marlynn Kane
5. Johann Aspra
6. Marlynn Kane
7. Aurelia Bina
8. Aurelia Bina
9. Johann Aspra
10. Perry Rhodan
11. Johann Aspra
12. Perry Rhodan
Nr. 8 – Falle für die Posmi
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
Prolog
1. Gefangen
2. Die Fliege
3. Eine Chance
4. Undercover
5. Trauerweide
6. Recherche
7. Erwacht
8. Misstrauen
9. Nachtschwärmer
10. Angriff auf Symphosis
11. Aufbruch
12. Weizen
13. Talsenken
14. Kunstpause
15. Die Anschuldigung
16. Kōshinsō
17. VINGUARD
18. Ein Nichts
Nr. 9 – Der Wert eines Lebens
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Ist der Ruf erst ...
2. Es wird dunkel
3. Frieden?
4. Auf Torpedos hämmern
5. Verhandlungen mit Salum-III
6. Kaimaers Retter
7. Unehrliche Verhandlungen
8. Am Boden zerstört
9. Nicht ohne meinen Sohn
10. Es war einmal
11. Aus Sicht eines Liebenden
12. Kein herzliches Willkommen
13. Frankensteins Braut
14. Alle bis auf einen
15. Das Ende des Happy Ends
Nr. 10 – Ein Mond wird gestohlen
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Aurelia Bina
2. Perry Rhodan
3. Aurelia Bina
4. Perry Rhodan
5. Aurelia Bina
6. Perry Rhodan
7. Aurelia Bina
8. Aurelia Bina
9. Perry Rhodan
10. Aurelia Bina
11. Perry Rhodan
12. Kor Chappal
Nr. 11 – Die Krone des Seins
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Perry Rhodan
2. Marlynn Kane
3. Totenstrand
4. Onkel Nagmum
5. Perry Rhodan
6. Junia Ryksdottir
7. Perry Rhodan
8. Marlynn Kane
9. Perry Rhodan
10. Marlynn Kane
11. Perry Rhodan
12. Junia Ryksdottir
13. Perry Rhodan
14. Marlynn Kane
Nr. 12 – Die Ehre der Kanes
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1.
2. Sechs Stunden zuvor
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 11. September 2084 NGZ
Impressum
PERRY RHODAN – die Serie
Vorwort
Mehr als 3000 Jahre in der Zukunft: Die Menschen haben viele Welten in der Milchstraße besiedelt. Sie leben und arbeiten friedlich mit den Angehörigen anderer Sternenvölker zusammen. Doch dann greifen unbekannte Roboter eine Welt an – es ist der Anfang ihres brutalen Feldzugs.
Woher kommen diese Droiden, und warum sind sie so aggressiv? Die Roboter folgen einem uralten, unheilvollen Programm, das Tod und Vernichtung bringt. Sie behaupten, zum Wohl der Menschheit zu handeln.
Um die Bedrohung auszuschalten, muss Perry Rhodan gegen alte und neue Feinde kämpfen – und er muss Rätsel aus tiefer Vergangenheit lösen ...
Nr. 1
Totenozean
Am Rand der Liga Freier Galaktiker – Roboter attackieren eine friedliche Welt
Kai Hirdt
Wir schreiben das Jahr 2083 der Neuen Galaktischen Zeitrechnung, mehr als dreitausendsechshundert Jahre in der Zukunft. Seit elf Jahren leben die Bewohner der Milchstraße in einer Phase relativer Ruhe. Zwischen den Sternenreichen herrscht Frieden – doch unter der Oberfläche brodeln die Konflikte weiter ...
Das zeigt sich, als die Föderation Normon zu zerbrechen droht. Der demokratische Planetenbund, der vor Jahrtausenden von Menschen begründet worden ist, scheint ins Chaos abzurutschen. Perry Rhodan und der Mausbiber Gucky brechen auf, um zwischen den verfeindeten Teilen der Republik zu vermitteln.
Sie wollen die Gegner wieder an den Tisch bringen. Es ist eine heikle Mission, gut 15.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Mitten in ihren diplomatischen Bemühungen erreicht sie ein Notruf. Dieser führt sie zum Planeten Chentap – und tief hinein in den TOTENOZEAN ...
Die Hauptpersonen des Romans
Perry Rhodan – Der Terraner empfängt einen Notruf, den es offiziell nicht gibt.
Gucky – Der Mausbiber erfährt von Geschehnissen, die es offiziell nicht gab.
Marlynn Kane – Die Biologin ist auf einer Expedition, die offiziell so nie stattgefunden hat.
Kor Chappal
Prolog
Perry Rhodan und Gucky
Perry Rhodan ächzte.
»Du klingst wie ein alter Mann«, feixte Gucky. Der gut einen Meter große Außerirdische aus dem Volk der Ilts ließ seinen beeindruckenden Nagezahn aufblitzen.
»Ich bin ein alter Mann«, erwiderte Rhodan. Gut 3700 Erdjahre waren seit seiner Geburt vergangen. Das eine oder andere Jahrhundert dabei hatte er durch Zeitreisen, Stasisaufenthalte und derlei mehr gewonnen oder verloren, sodass er selbst nicht mehr sagen konnte, wie alt genau er eigentlich war.
Nach den ersten ein-, zweitausend Jahren war das sowieso nicht mehr so wichtig.
Es war außerdem weniger der Lauf der Zeit, der auf ihm lastete. Er war immer noch so fit wie mit 39, als er unsterblich geworden war. Es waren die diplomatischen Gespräche, die er auf dieser Reise in die Föderation Normon zu führen hatte. Die Föderation hatte sich nach mehr als 700 Jahren Ruhe ziemlich aus heiterem Himmel aufgespalten, und beide Teile beanspruchten als vermeintliche Rechtsnachfolger den Platz in der Liga Freier Galaktiker.
Rhodan bereiste das Gebiet, um die Anführer beider Seiten daran zu erinnern, dass Menschen durch Verständnis und Kooperation gewannen, nicht durch betonköpfiges Beharren auf Maximalforderungen. Bislang allerdings ohne Erfolg.
»Hier ist was, um dich abzulenken«, sagte Gucky. »Hast du die Nachricht gesehen?«
»Welche Nachricht?« Rhodan tippte auf die Arbeitsstation und rief die vier Dutzend Hochprioritätsanfragen auf, die während der letzten zweieinhalb Stunden bei ihm eingegangen waren. Die Künstliche Intelligenz hatte sie thematisch vorsortiert.
Eine stach heraus: ein Hilferuf. »Was zum ...«
Es war keine Holo- oder Audioaufzeichnung, sondern nur eine kurze Textzeile: Chentap. Lebensgefahr. Sie greifen an! Absender war laut der automatischen Kennung eine gewisse Lilja Ryksdottir.
»Sagt dir der Name was?«, fragte Rhodan.
»Nicht das Geringste«, antwortete Gucky. »Wer oder was ist Chentap?«
»Keinen Schimmer.«
Rhodan ließ die Nachricht genauer analysieren. Es war eine Hyperfunkbotschaft, die von außerhalb des Systems gesendet worden war, und nicht spezifisch an ihn und Gucky gerichtet, sondern an jeden Empfänger in Reichweite. Allerdings war sie – anders als bei Notrufen üblich – codiert, sodass außerhalb der terranischen Flotte oder des diplomatischen Dienstes niemand etwas damit anfangen konnte.
Rhodan und Gucky wechselten Blicke. »Dann mal los!«, sagte der Ilt.
Rhodan hielt sich nicht mit komplizierten Recherchen auf, sondern kontaktierte direkt den Terranischen Liga-Dienst. Es gab nicht viel, was der Geheimdienst der Liga Freier Galaktiker nicht wusste. Zwei Namen und ein Codierungsverfahren waren für die Agenten mehr als genug, um eine Untersuchung zu beginnen.
Im Holo erschien Aurelia Binas bevorzugtes Aussehen. Die Stellvertretende Direktorin des TLD präsentierte ein schmales, hübsches Gesicht, ernst, mit dunklen Augen und umrahmt von goldblondem Haar. »Perry«, sagte die positronisch-semitronische Entität. »Ich dachte, du steckst in Verhandlungen.«
»Es läuft schleppend«, sagte Rhodan. »Beide Seiten wollen alles haben und nichts geben, und sie tun sich schwer damit, zu verstehen, dass das wenig zielführend ist. Aber deswegen melde ich mich nicht.«
»Sondern?« Bina zeigte eine so natürlich wirkende interessierte Miene, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, dass sie eine hoch entwickelte Maschine war und kein Mensch; ein Roboter, der seine biologischen Hüllen wechseln konnte wie Rhodan seine Kleidung.
»Ein Notruf. Ich leite ihn weiter.« Rhodan nahm die entsprechende Schaltung vor, und in der Dauer eines Wimpernschlags überwand die Nachricht über mehrere Hyperfunkrelais die knapp 15.000 Lichtjahre zur Erde.
»Im Wesentlichen: Flottencode, zwei Namen: Lilja Ryksdottir und Chentap. Habt ihr etwas dazu?«
»Moment, ich schaue nach.« Irritierenderweise bewegte Bina sich dabei nicht, sondern starrte lediglich für einen Sekundenbruchteil ins Leere. In dieser Zeit, wusste Rhodan, hatte sie sich drahtlos mit sämtlichen relevanten Datenbanken des TLD verbunden und Abermilliarden von Datensätzen gefiltert.
»Der Code ist der Explorerflotte zugeordnet«, berichtete sie. »Sonst nichts Ungewöhnliches daran, keine Kennung, die auf ein bestimmtes Schiff verweist. Zum Wort Chentap habe ich nichts. Lilja Ryksdottirs habe ich zwei. Eine lag viele Jahre in einem terranischen Krankenhaus. Sie wurde bei einem Unfall schwer verletzt und ist seitdem körperlich versehrt und komatös. Sie wurde verlegt, ohne je das Bewusstsein wiederzuerlangen, aber ich weiß nicht, wohin. Die andere ist Xenologin auf dem Explorerschiff MUNGO PARK.«
Gucky grinste. »Ich wage zu tippen, welche von den beiden unsere ist.«
»Ich auch«, sagte Rhodan. Er erinnerte sich an den Tag, als er die Explorerflotte ins Leben gerufen hatte. Etwas mehr als dreieinhalbtausend Jahre war das her. In ihren Glanztagen waren mehr als 10.000 Schiffe rund um die Uhr damit beschäftigt gewesen, unbekannte Regionen der Milchstraße zu erforschen. Unzählige Wunder des Kosmos hatten die Einheiten ans Licht gebracht.
Inzwischen war die Flotte zwar kleiner, aber ihre Aufgabe blieb dieselbe. »Wo ist die MUNGO PARK unterwegs?«
»Nicht weit von euch«, antwortete Bina. »Sie untersucht ein System knapp außerhalb der Föderation Normon, etwa vierhundert Lichtjahre von euch entfernt.«
»Routineexpedition oder aus konkretem Anlass?«
Wieder starrte Bina kurz ins Leere. Der Moment war so schnell vorbei, dass die meisten Beobachter es nicht einmal bemerkt hätten. »Aus dieser Raumregion wurde ein sechsdimensionaler Impuls unbekannter Quelle angemessen. Die MUNGO PARK sucht nach dem Ausgangspunkt.«
»Wir kontaktieren das Schiff. Danke!«
»Ich schicke euch die Informationen zum Kommandanten. Viel Erfolg!«
Der Datensatz kam an, und die Verbindung endete.
Rhodan sah Gucky an und hob eine Augenbraue. »Warum, alter Freund, grinst du so hämisch?«
Der Ilt bemühte sich erfolglos um eine Unschuldsmiene. »Tue ich nicht. Natürlich ist ein Notruf, vielleicht eine Leben-und-Tod-Frage, erheblich wichtiger als die Vermittlung zwischen zwei bockigen Geschwisterkindern.«
»Das will ich wohl meinen.«
»Und wenn ich telepathisch eine gewisse Erleichterung verspüre, dass dir eine weitere Runde erst mal erspart bleibt, ist das sicher nur Einbildung.«
»Genau das.« Rhodan aktivierte eine Verbindung zur EX-3776, Eigenname MUNGO PARK.
Das Signal ging mit seiner individuellen Kennung hinaus. Entsprechend nahm der Kommandant des Schiffs, ein Epsaler namens Alpu Zeniq, es ohne Umschweife persönlich entgegen. »Perry Rhodan!« Epsaler hatten normalerweise eine phänomenale Reaktionsgeschwindigkeit. Dieser nicht. Weit aufgerissene Augen verrieten die Verblüffung des Mannes. »Welche Überraschung!«
Wie die meisten Bewohner der terranischen Kolonie Epsal war er aus Rhodans Sicht nur brustgroß, dafür genauso breit gebaut und unfassbar muskulös. Sein eingeschüchterter Blick wollte nicht recht zur Anmutung eines Kraftpakets passen.
Rhodan prüfte, welche Bordzeit wohl gerade auf der PARK herrschte, und wünschte einen Guten Morgen.
»Was verschafft mir die unerwartete Ehre?«, fragte Zeniq.
»Wir haben einen etwas kryptischen Notruf von einem Explorerschiff erhalten, von einer Lilja Ryksdottir. Ich glaube, das ist eines deiner Besatzungsmitglieder?«
»Lilja?« Wenn überhaupt möglich, weiteten sich die Augen des Captains noch. »Wieso ... Was steht denn in der Nachricht?«
»Du weißt nichts davon?«
»Nein.«
»Nur Chentap. Lebensgefahr. Sie greifen an! Sagt dir das etwas?«
Zeniq dachte nach. »Ihr könnt damit nichts anfangen?«
»Uh-oh«, sagte Gucky leise außerhalb von Rhodans Gesichtsfeld. Uh-oh, stimmte Rhodan in Gedanken zu. Die seltsame Rückfrage verhieß nichts Gutes.
»Nein«, sagte Rhodan, »deshalb frage ich.«
»Chentap ist der Eigenname einer Welt, die wir vor Kurzem besucht haben«, erklärte der Captain. »Völlig uninteressant, deshalb wurde der Ergebnisbericht noch nicht an die Flotte übermittelt. Das dort eingesetzte Xenologenteam ist seit Tagen wohlbehalten zurück an Bord. Und ja: Auch Lilja Ryksdottir ist bei mir an Bord. Aber sie ist kein Besatzungsmitglied im eigentlichen Sinne.«
»Was soll das heißen?«
»Ryksdottir ist pflegebedürftig, genauer gesagt: komatös. Ihre einzige lebende Verwandte ist Teil meiner Mannschaft. Deshalb liegt Lilja bei uns auf der Medostation statt in einem planetaren Krankenhaus. Sie hat euch mit Sicherheit keine Nachricht geschickt.«
Damit war zumindest das Rätsel der aus Terrania verschwundenen Patientin geklärt – Binas zwei Fundstellen bezogen sich auf ein und dieselbe Person. Der Notruf aber blieb so rätselhaft wie zu Beginn.
Glaubst du ihm?, hatte Gucky auf eine Folie gekritzelt, die er nun außerhalb des Erfassungsbereichs der Holooptik hochhielt.
Rhodan öffnete seinen Gedankenblock, sodass der Ilt seine Antwort telepathisch erfassen konnte: Nicht ein Wort.
1.
Drei Wochen zuvor auf Chentap
Bericht Marlynn Kane
»Wie weit seid ihr mit dem Packen?«, fragt Lilja über Funk.
»Nur noch die Sensorenphalanx vom Höhleneingang«, gebe ich fröhlich zurück. Natürlich ist der Rest schon fertig verstaut. Bereits seit zwei Tagen, weil ich es nicht erwarten kann, dieses Drecksloch von einem Planeten zu verlassen. Ich freue mich auf mein Quartier in der MUNGO PARK. Ich freue mich auf Privatsphäre.
Ich freue mich, wieder Marlynn Kane sein zu können, Exobiologin, die aufgrund der Familientradition bei der Explorerflotte gelandet ist. Und nicht Marlynn Kane, Räumerin von Sensorphalangen. Das stand nicht in meiner Jobbeschreibung! Vor diesem Einsatz habe ich mir nie klargemacht, was es bedeutet, Teil eines Feldforschungsteams zu sein: einen ganzen Monat wohnen in einem nur vier mal zehn Meter großen Shift. Sich diesen Platz mit drei Kollegen teilen müssen. Und es ist ja nicht so, als hätte jeder ein Viertel des Raums für sich. Der Großteil geht eh drauf für die Steuerzentrale dieses Flugpanzers und das Wissenschaftsmodul.
»Wir warten nur auf dich, Chefin!«, schiebe ich noch hinterher.
Johann Aspra schüttelt den Kopf. »Und der große Preis für Ehrlichkeit und Authentizität bei diesem Einsatz geht an Marlynn Kane«, spottet er. »Kein Satz, der nicht auf die Beurteilung am Ende des Einsatzes schielen würde.«
»Du hast natürlich recht«, gebe ich zurück. »Es wäre viel besser, wenn ich fortwährend Gift spritze und die Stimmung vermiese.«
Das Problem ist: Aspra hat ein Stück weit recht. Große Forschungsleistungen habe ich während dieser Tour nicht vollbracht. Ist auch schwierig, wenn man als Exobiologin seine Forschungsgegenstände nur aus der Ferne betrachten darf. Wenn ich noch einmal eingesetzt werden will, bin ich also tatsächlich von einer guten Bewertung der Expeditionsleiterin abhängig.
Ich betrachte das komplexe und exzellent getarnte Konstrukt, das unser Versteck vor unbemerkter Annäherung schützt. Es wird eine Weile dauern, es zu demontieren, selbst mit Kors Hilfe. Dass Aspra etwas Sinnvolles dazu beiträgt, bilde ich mir gar nicht erst ein. Der Siganese ist gerade so groß, wie meine Hand lang ist. Also nicht gerade eine Bank, wenn viel Ausrüstung transportiert werden muss.
Beim Demontieren der Sensoren könnte er sich aber nützlich machen. Dumm nur: Lilja hat keinen expliziten Befehl dafür erteilt. Ich bin Aspra nominell gleichrangig, aber der Anfänger im Team und habe nichts zu sagen. Und Kor weiß zwar am besten, wie wir schnell und gut vorankommen, ist uns drei Wissenschaftlern aber unterstellt. Er bringt Aspra sicher nicht dazu, einen Finger krumm zu machen, wenn der keine Lust hat.
Aspra ist einer der Gründe, warum ich das Ende dieses Einsatzes herbeisehne. Zuerst hatte ich mich gefreut, dass ein Siganese als Materialwissenschaftler mitkommt. Aus recht eigennützigen Gründen, zugegeben: Wenn man vier Wochen auf engstem Raum mit drei Kollegen zusammenlebt, ist es gut, wenn einer davon nur 13 Zentimeter groß ist. Aber wenn diese 13 Zentimeter geballte Missgunst sind, tausche ich ihn sofort gegen einen zweieinhalb Meter langen, dafür gut gelaunten Ertruser.
»Glaubst du, die Schmeicheltour bringt dir was, wenn du deine Ergebnisse einreichst?«, ätzt Aspra weiter. »Sieh's positiv: Zumindest brauchst du nicht lang für deinen Bericht.«
Ich stehe am Rand des Felssimses. Ganz kurz erwäge ich, ihn über die Kante zu schnippen. Aber das würde sich wirklich nicht gut in der Beurteilung lesen, glaube ich. Außerdem ist das wohl einer der Momente, wo ein Anzug-Antigravprojektor trotz Ortungsrisiko eingeschaltet werden dürfte.
Ein letztes Mal blicke ich in die Tiefe. Niedrige, dunkle Bauten drängen sich dort zwischen die Arme eines Flussdeltas und eine Menge künstlich angelegter Kanäle. Die einzige größere Fläche ohne Wasserlauf ist das Landefeld des kleinen Raumhafens, auf dem gerade eine wasserstoffgetriebene Trägerrakete gebaut wird. Außerdem warten die Chenno dort mehrere Raumshuttles, die sie für den Kontakt mit ihrer Mondstation nutzen.
Groß ist die Siedlung nicht. Wer wie ich in Terrania aufgewachsen ist, auf den wirkt die Siedlung sogar lächerlich. Wenn vierzigtausend Chenno in ihr leben, ist das viel. Lilja kennt bestimmt die genaue Zahl. Sie hat ja im Gegensatz zu mir sinnvoll forschen dürfen.
»Aus dem Weg.« Aspra reißt mich aus meinen Gedanken. Verblüffenderweise hat er sich doch entschieden zu helfen. Allerdings verwendet er einen Antigravitationsprojektor für den Transport, was klar gegen die Einsatzvorschriften für verdeckte beobachtende Feldforschung verstößt.
»Schalt das ab«, sagt Kor schneidend. Sofort wird meine Laune besser. Dass Kor und ich uns nähergekommen sind, war der einzige Lichtblick in diesem ganzen desaströsen Campingtrip. Ich habe ihn nicht kommen hören, obwohl er schwer bepackt ist und er sicher kein Antigravaggregat mit verräterischer Streustrahlung benutzt hat.
»Und wieso?«, fragt Aspra. »Glaubst du, die Kröten können Gravitationswellen anmessen oder energetische Rückstände?«
»Vorschrift ist Vorschrift.« Der Satz passt nicht zu Kor, der eher fünfe gerade sein lässt. Umgekehrt ist eigentlich Aspra der Pedant in unserem Team. Aber wenn es um seine eigene Bequemlichkeit geht, ist er flexibler als im Urteil über seine Teamkollegen.
»Herrje. Die kennen da unten nicht mal Antigravitation«, doziert Aspra. »Die reiten noch mit Wasserstoffraketen auf Feuerbällen zu ihrem Mond und halten das für eine Leistung!«
»Es gibt Lebensformen, die können Gravitationsschwankungen mit ihren natürlichen Sinnen wahrnehmen«, erkläre ich.
»Oh«, sagte Aspra, »unsere Biologin gibt Unterricht! Und, gehören die Chenno dazu? Steht das in deinem Abschlussbericht?«
Ich presse die Lippen aufeinander. Warum muss er darauf herumreiten? Vier Wochen, und nicht einen Chenno habe ich untersuchen können. Einen Abend habe ich vorsichtig die Möglichkeit angedeutet, heimlich einen Verstorbenen zu exhumieren und zu obduzieren. Oh Mann, hat Lilja mir da den Marsch geblasen. Respekt vor fremden Kulturen, Wahrung der Totenruhe, das volle Programm.
Im Ergebnis habe ich: nichts. Vier Wochen Einsatz. Meine erste große Expedition, seit ich bei der Explorerflotte bin. Ich wurde ausgewählt, obwohl ich die mit Abstand jüngste Exobiologin an Bord der MUNGO bin und einige erfahrenere Kollegen ebenfalls scharf auf den Einsatz waren. Aber ich wollte mich profilieren, habe es geschafft, mich durchzusetzen – und komme nun mit leeren Händen zurück; gerade mal mit ein paar Analysen von ungewöhnlich stark phosphoreszierenden Moosen, die ich aus purer Langeweile durchgeführt habe. Was für eine Bauchlandung.
»Und welche bahnbrechenden Entdeckungen hast du gemacht, du Experte?«, fragt Kor. Er ist der einzige Nicht-Wissenschaftler im Team, kümmert sich darum, dass unsere Technik funktioniert. Auf dieser Mission keine gigantische Herausforderung, aber Explorerteams forschen ja nicht nur wie wir hier, sondern auch mal in wesentlich schwierigeren Umfeldern. Und wenn man über Wochen vom Mutterschiff getrennt ist und die lebenswichtigen Systeme ausfallen, braucht man jemanden, der das Wartungshandbuch beiseite feuert und kreative Lösungen findet. Ich bin sicher, Kor Chappal kann einen Hyperantrieb mit Spucke und ein paar Spulen aus einem alten Toaster reparieren.
»Keine«, antwortet Aspra gelassen. »Und ich habe vor, mich bei Zeniq über Ryksdottirs restriktive Missionsleitung zu beschweren. Es ist schon auffällig, dass sie jede Beobachtung machen kann, die sie möchte, während wir kurzgehalten werden und keine Proben nehmen dürfen.«
Was eine Lüge ist – Aspra hat jede Menge Material- und Gesteinsproben analysiert. Lilja hat nur verboten, dass er bestehende, benutzte Architektur und Kunstwerke anbohrt. Dass die Chenno nichts Interessanteres verbauen als Stein und Blei, ist sicher nicht ihre Schuld.
»Tu das, wenn du das für das Richtige hältst«, sage ich kühl. Ich werde bei so einem Quatsch nicht mitmachen. Die Terraner haben das, was sie über die letzten Jahrtausende erreicht haben, nicht geschafft, indem sie sich mit Dienstaufsichtsbeschwerden überzogen haben. Außerdem bin ich 24 Jahre alt und habe noch viele Jahrzehnte in der Flotte vor mir. Ich möchte, dass meine Kollegen mich mögen!
*
Eine halbe Stunde später sind wir fertig, und ich finde mich mit Kor im Innern des Shifts wieder, der die letzten vier Wochen unsere Heimat war. Aspra ist draußen geblieben – er ist beleidigt, dass ich bei seiner Stuhlsägerei nicht mitmache.
Kor und mir soll es recht sein. Mein Freund grinst mich an. »Vielleicht ist es besser, wenn wir jetzt erst mal nicht rausgehen, damit wir nicht von einem wütenden Siganesen angefallen werden. Was können wir bloß anfangen mit der restlichen Zeit in dieser romantischen Unterkunft?«
Ich weiß genau, was er vorhat. »Aber Aspra ...«
Kor schraubt eine Thermoskanne auf und präsentiert mir das leere Innere. »... ist nicht hier.« Deckel wieder drauf.
Ich lache und werfe ein Kissen nach ihm. »Nicht nett!«
»Jeder bekommt, was er verdient«, sagt er schulterzuckend, und ein unerklärlicher Anflug von Trauer huscht über seine Züge.
Der Moment ist so schnell vorbei, wie er gekommen ist. Er schlendert zu mir und setzt sich neben mich auf den Rand meiner Pritsche. »Also, schöne Dame, habe ich dich hier nicht schon einmal gesehen?« Er legt seinen Arm um mich, und mir gefällt es. Wir können wenigstens das Ende einer furchtbaren Reise angenehm machen.
Aspra funkt. Ich drehe den Empfang ab.
Lilja funkt, und Kor verdreht die Augen. »Ja?«
»Habt ihr die Einsatzanzüge schon verstaut?«
Die Frage irritiert uns. Die Antwort muss sie kennen. »Na klar. Wir starten in anderthalb Stunden, wenn du dich erinnerst.«
»Tun wir nicht. Da ...«
»Was?« Selten war ich so schnell auf hundertachtzig wie in diesem Augenblick. »Was heißt das, wir starten nicht?«
»Es tut sich was in der Stadt! Eine riesige Prozession! Die Chenno laufen alle zum Landefeld. Wir müssen das aufzeichnen für eine spätere Analyse!«
»Chefin«, sagt Kor vorsichtig. »Captain Zeniq dürfte es nicht lustig finden, wenn wir ...«
»Ich habe ihn bereits verständigt, er hat zugestimmt. Wir bleiben drei Tage länger. Jetzt packt die Anzüge aus und kommt runter zu mir!«
Ich warte, bis die Verbindung endet, dann flippe ich aus. Wir waren fast schon weg gewesen von diesem Drecksplaneten, und nun verlängert sich dieser Höllentrip noch um drei Tage!
Kor gibt mir ein Handzeichen, dass ich still sein soll, und nimmt einen neuen Anruf von Lilja entgegen. »Sag Marlynn, sie soll sich nicht aufregen. Vermutlich startet oder landet eines ihrer Shuttles. Wenn wir die ersten Schritte einer unbekannten Zivilisation ins All mitfilmen können, haben wir als Team ein starkes Ergebnis, mit dem wir jahrelang angeben können. Wir alle.«
Ich gebe es ungern zu, aber damit kriegt sie mich. Ich schiebe die schon eingelagerten Kisten beiseite, die den Zugang zu unseren Fluganzügen blockieren.
*
Man kann sagen, was man will – wir sind vielleicht nicht die Art eingeschworenes Team, wie sie in den Werbespots für und Trivids über die terranische Flotte immer gezeigt wird. Aber wenn es darauf ankommt, arbeiten wir professionell und ziehen an einem Strang. In fünf Minuten sind wir voll ausgerüstet und schweben über der Stadt, um das Geschehen aus verschiedenen Winkeln zu filmen und später zu analysieren.
Es ist zwar bemerkenswert, wie schnell Lilja das Antigravverbot aufhebt, wenn es um ihr eigenes Forschungsgebiet geht. Aber ich muss zugeben: Ihre Entscheidung wirkt gerechtfertigt. So etwas wie heute haben wir die letzten vier Wochen nicht zu sehen bekommen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, wo wir sonst immer nur einzelne Chenno gesehen haben, die träge ihrer Wege gegangen sind. Ich hatte noch nie die Chance, so viele von ihnen auf einmal zu beobachten.
Die Bewohner von Chentap sehen aus wie überdimensionierte Kröten, etwa anderthalb Meter lang, allerdings ohne die aufgesetzten Augen. Stattdessen haben sie vier von Hautfalten geschützte Sehorgane, zwei über dem Obermund nach vorn gerichtet, zwei an den Seiten des Kopfes. Das Maul ist groß und besteht aus zwei halbkreisförmigen Kieferleisten ohne Zähne. Von der oberen hängen schleierartige Barten herab, deren Sinn sich mir bei Landbewohnern nicht erschließt. Vielleicht halten sie insektengroße Flugtiere aus den Verdauungs- und Atemwegen raus.
Nicht das einzige Rätsel dieser Spezies, eigentlich sogar eines der kleineren. Ihre Fortbewegungsweise ist absonderlich: Ihre langen Hinterbeine schieben sie langsam vorwärts. Ihre vorderen Extremitäten trippeln unter dem Körper mit, damit sie nicht auf dem Bauch kriechen. Diese Vorderärmchen aber laufen in kugelförmige Muskelballen aus, von denen je vier kurze Tentakel abgehen, die wie lange, hochbewegliche Finger steuerbar sind. Ziemlich äquivalent menschlichen Händen – aber um sie zu benutzen, müssen die Chenno sich auf den Hintern setzen.
Gleichzeitig zu gehen und die Arme zu benutzen, ist ihnen nicht möglich. Ich hätte sehr viel mehr Verständnis für diesen Körperbau, wenn es sich um Wasserbewohner oder Amphibien handelte – das war auch die Ausgangshypothese meiner beobachtenden Analyse. Aber in vier Wochen haben wir es nicht ein einziges Mal gesehen, dass ein Chenno auch nur eine Zehe ins Wasser gesteckt hätte.
Ebenso rätselhaft ist ihre Verständigung. Sie verstehen Sprache. Das ist eindeutig, denn ihre Mondbasis schickt Sprachnachrichten an die Bodenstation: einen artikulierten Singsang, an dem unsere Translatoren bislang gescheitert sind. Aber wir haben bislang keinen Chenno gefunden, der diese Sprache auf dem Planeten verwendet.
Wenn sie untereinander kommunizieren, setzen sie sich auf die Hinterbeine und gestikulieren in einer Art Fingeralphabet oder Gebärdensprache. Davon liegen uns möglicherweise genug Aufzeichnungen vor, um sie zu entschlüsseln. Bloß, in unserem Shift fehlen die technischen Möglichkeiten dazu, da die Standardtranslatoren auf akustische, nicht auf optische Signalübermittlung ausgerichtet sind. Zweifellos wird Lilja nach unserer Rückkehr mit einem Xenolinguisten daran arbeiten.
Unterhalb des Obermauls, zwischen den Vorderarmen, hat der Atemapparat eine zweite Öffnung, die meines Erachtens zur Produktion artikulierter Laute geeignet ist. Nur wie gesagt tun die Chenno gerade das nicht. Sie brüllen nur laut, wenn sie irgendjemandes Aufmerksamkeit erringen wollen. Ist ihnen das gelungen, lassen sie sich auf den Hintern plumpsen und führen ihr Zeichengespräch.
Nichts davon ergibt Sinn, insbesondere nicht bei einer raumfahrenden Zivilisation.
Insofern ist es schon spannend, dass an unserem letzten Tag – nein, unserem viertletzten, vielen Dank, Lilja – etwas Unerwartetes passiert. Vielleicht bringt das noch mal Licht in ein paar unserer Rätsel.
Immer mehr Chenno schieben sich auf die Straßen und Wege. Möglicherweise ist die ganze Stadt auf den Beinen. Alle kriechen auf den Hauptweg zu, die schnurgerade Straße, die durch die ganze Stadt landeinwärts zum Raumhafen führt.
Dort senkt sich nun ein Raumfahrzeug aus dem Himmel, ein Shuttle, nicht viel fortschrittlicher als das Landemodul, das die Menschheit einst bei ihrem ersten Mondflug verwendet hat. Es kommt langsam auf einer genau kontrollierten Flamme aus brennendem Wasserstoff runter. Wenn dabei in Bodennähe etwas schiefgeht, können der Feuerball und die Trümmer die halbe Bevölkerung auslöschen. Ich anstelle der Chenno würde also Abstand halten.
Sie tun das Gegenteil. Immer näher schieben sie sich an den Raumhafen. Die Straße ist voll, doch in der Mitte bildet sich nun über die ganze Länge ein Spalier. Es erreicht die volle Breite, als das Landemodul aufsetzt – ohne Unfall, ohne Explosion. Die Chenno mögen behäbig wirken, aber ihre Technik haben sie im Griff.
Ein Ton erklingt, den ich zuerst nicht zuordnen kann. Bassig, wie ein Nebelhorn. Ich kann die Quelle nicht ausmachen. Vor mir, unter mir, hinter mir, von überallher kommt der Klang. Manchmal ändert er kurz die Höhe, um dann auf die Ausgangsfrequenz zurückzukehren. Ist das eine Art Sirene?
Nein, es sind die Chenno – sie singen! Also können sie doch mehr mit ihrem Zweitmund tun als unkontrolliert schreien. Aus vierzigtausend Kehlen erklingt gemeinsamer Gesang, alldurchdringend. Meine Bauchdecke flattert von der Frequenz.
Kor schickt ein Funkbild an uns alle. Er ist am nächsten beim Landefeld und kann die Geschehnisse dort aufzeichnen. Eine Rampe fährt aus dem Landemodul, und vier Chenno treten heraus.
Ich habe gehofft, so etwas wie Kröten in Raumanzügen zu sehen, aber diese Skurrilität bleibt uns verwehrt. Wie ihre Artgenossen tragen sie einen steifen Überwurf in gedeckten Farben, allerdings mit breiten, helltürkisen Borten.
Die vier transportieren ein Tuch, jeder eine Ecke im Maul, da sie ihre Hände ja zur Fortbewegung benötigen. In der Mitte des straff gespannten Karrees lagert etwas – ein Stück Ladung, das die Astrokröten vom inneren ihrer zwei Monde mitgebracht haben.
Kor zoomt heran. Ich bin gespannt, aber das Ergebnis ist enttäuschend: Es ist nur ein Klumpen dunkelgraues Mondgestein. Er ist groß, ich bin überrascht, dass die vier ihn mit ihren Mündern halten können. Aber trotzdem nur ein Klumpen Stein. Langweilig für mich – vielleicht sieht Aspra, unser Materialwissenschaftler, das anders. Auf den ersten Blick sieht das Zeug genauso aus wie das Material, das er in den letzten Wochen x-fach untersucht hat, und das war profanes Bleierz.
Die Chenno sehen offenbar irgendetwas darin, das sich uns nicht erschließt. Die vier Wesen schieben sich – immerhin in erstaunlichem Tempo, sodass wir beim Zusehen nicht die Geduld verlieren – das Spalier entlang, das vom Raumhafen bis zur Küste reicht, zwischen den Tausenden Stadtbewohnern hindurch. Überall dort, wo sie entlangkommen, wird der dröhnende Gesang lauter und höher.
»Täusch ich mich, oder steht das Wasser deutlich höher als sonst?«, fragt Aspra über Funk.
Ich mag ihn nicht. Seine Beobachtungen freilich sind meist auf den Punkt, das muss ich zugeben. Die vier Chenno kriechen nicht nur auf das Meer zu, das Meer kommt ihnen entgegen – mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
»Die Monde«, erklärt Kor, der zwar kein Wissenschaftler ist, aber eben doch derjenige von uns, der sich mit physikalischen Phänomenen am besten auskennt. »Kann es daran liegen?«
Ich habe keinen Zugriff auf astronomische Daten, aber Lilja als Expeditionsleiterin kann das abrufen. »Bingo!«, ruft sie aufgeregt. Der archaische Ausdruck hat sich an Bord der MUNGO eingebürgert. Ich will nicht darüber nachdenken, was das über uns als Menschen aussagt. »Beide Monde und die Sonne stehen in Konjunktion, ziemlich direkt über uns. Daher die extreme Springflut!«
Ein Zufall, dass die Chenno genau in diesem Augenblick gelandet sind? Oder war ihr Zeitplan genau darauf ausgerichtet? Innerhalb der letzten 20 Minuten haben wir mehr über dieses Volk erfahren als während der letzten vier Wochen, oder zumindest mehr Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen bekommen.
Die vier Astronauten und Lastträger haben die Wasserkante erreicht. Gehen sie weiter? Sehe ich meine Annahme, dass diese Wesen sich im Wasser bewegen können, doch noch bestätigt?
Ja. Oh ja. Und wie. Nur auf andere Weise als erwartet. Nicht die Astronauten tauchen ein, sondern andere Chenno gehen an Land. Ich muss nachher noch einmal die Aufnahmen prüfen, aber ich bin felsenfest sicher, dass sie nicht aus der Stadt kommen, sondern direkt aus dem Wasser.
Und sie unterscheiden sich massiv von den Landbewohnern: Sie tragen andere Kleidung, prächtige Gewänder, mit glänzendem Metall und geschliffenen Steinen verziert. Jetzt an Land kleben sie am Körper wie nasses Leinen. Aber wenn sie damit schwimmen, muss es prächtig aussehen, als schwämme da eine schimmernde Wolke.
Mir wird schwindelig, als ich die Implikation begreife. Die Chenno sind Amphibien, so viel ist jetzt klar. Aber nicht nur das: Ein Teil ihres Volkes lebt offenbar dauerhaft unter Wasser und hat nur zu besonderen Anlässen Kontakt zur Landbevölkerung.
Und der Optik nach sind die Wasserbewohner erheblich kultivierter. Wir haben vier Wochen lang dem trägen, langweiligen Teil dieses Volkes nachspioniert, obwohl unser Shift zu Unterwassereinsätzen durchaus in der Lage ist!
Als Erster geht ein Chenno mit einer Art Kopfschmuck an Land, einem türkisgrün leuchtenden Helm. Offenbar gibt es eine Unterwasservariante der Leuchtmoose, die ich untersucht habe. Oder es gibt eine profanere Erklärung, wasserdichte Lampen etwa. Auf die Distanz schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es leuchtender Schmuck, wo wir bisher nur dröge Farben in Erdtönen gesehen haben.
Dem Anführer folgen vier andere ohne Leuchthelme, aber im selben festlichen Stil gewandet. Sie treten zu den vier Steinträgern und übernehmen feierlich ihre Last. Der Gesang der Zehntausenden Chenno um die Szene herum schwillt an und wird mehrstimmig. Was auch immer wir da für eine Zeremonie bezeugen, sie nähert sich ihrem Höhepunkt.
»Ein zweites Raumschiff!«, ruft Aspra.
»Was?«, fragt Lilja verblüfft.
Kor richtet seine Kamera in den Himmel und zoomt für uns den leuchtenden Punkt heran. Da kommt tatsächlich noch etwas vom Firmament herab. Allerdings reitet es nicht auf einem Feuerball wie die Rakete der Chenno zuvor. Das muss ein fortgeschritteneres Antriebssystem sein.
Die Chenno haben es ebenfalls bemerkt. Ihr Gesang verändert sich. Er wird noch einmal lauter, aber zum ersten Mal dissonant. Er schmerzt in meinen Ohren. Ich bekomme Gänsehaut. »Was ist das?«
»Kugelraumer!«, ruft Kor. Er hat recht, aber es ist keines der geläufigen Modelle. Nichts Terranisches, Arkonidisches, Tefrodisches oder so. Und ganz sicher ist es kein Beiboot der MUNGO, was meine erste Vermutung gewesen wäre.
Wie groß das Schiff ist, ist schwer abzuschätzen, weil die Distanz nicht bekannt ist. Natürlich könnten wir es anpeilen, aber ein Schiff, das offenbar über einen Antigrav-Landemechanismus verfügt, würde das mit Sicherheit registrieren.
Wie auch die Antigravantriebe unserer Anzüge. Verdammt! »Runter auf den Boden!«, funke ich mit geringstmöglicher Intensität.
Kor begreift am schnellsten. »Unnötige Energieverbraucher abschalten.«
Dann endlich übernimmt unsere Expeditionsleiterin das Kommando. »Deflektoren bleiben an, auch die Luftaufbereitung. Alles andere abschalten. Jeder schlägt sich allein durch, wir treffen uns beim Shift! Funkstille!«
Der Kugelraumer schwebt inzwischen etwa 15 Meter über dem Landefeld, völlig reglos. Die Größe ist immer noch schwer zu schätzen, weil die blau-silbrige Oberfläche völlig glatt ist und dem Auge keinen Orientierungspunkt bietet. Wenn ich raten muss, ist das Schiff etwas kleiner als eine terranische Korvette, also um die fünfzig Meter im Durchmesser.
An mehreren Dutzend Stellen bilden sich Löcher in der Oberfläche. Kleine Flugroboter schweben daraus hervor, grausilberne Oktaeder, eine Spitze zum Boden gewandt. Immer mehr, Dutzende, Hunderte, ein ganzer Schwarm.
2.
So schnell war ich noch nie auf dem Boden. Was geschieht hier? Was sind das für Maschinen? Warum ... Die nächsten Schüsse. Schreie. Mir wird klar, dass Fragen niemandem helfen.
Die Chenno brauchen länger als wir Terraner, um zu verstehen, was da passiert. In den vier Wochen, die wir auf ihrer Welt sind, haben wir keine einzige gewalttätige Auseinandersetzung beobachtet. Sie scheinen das Konzept von Krieg nicht zu kennen, hat Lilja einmal abends postuliert.
Aber jetzt braust ein Sturm über diese Insel der Seligen, überrollt sie komplett. Die Chenno am Rande der Prozession wissen wohl gar nicht, was sie da sehen. Metallkörper am Himmel, die Lichtstrahlen Richtung Boden werfen. Dass diese tödlich sind, begreifen sie gar nicht. Das erkennen nur die Chenno in unmittelbarer Nähe der Einschlagstellen – die Nebenleute der Toten. Sie reagieren instinktiv und richtig: Sie wollen fort.
Aber die außen Stehenden weichen nicht, weil sie den Ernst der Lage nicht begreifen. Und ihre Zeichensprache ist nicht geeignet, die Information schnell und in alle Richtungen zu verteilen. Es folgt, was folgen muss: Binnen weniger Sekunden bricht Panik aus, nicht nur wegen der um sich schießenden Roboter, sondern weil Chenno von anderen Chenno niedergetrampelt werden.
Ich selbst stehe genauso starr wie die Prozessionsbesucher an den Rändern, die weichen und fliehen müssten, es aber einfach nicht tun. Mein Hirn nimmt die Vorgänge zur Kenntnis, aber mein Körper setzt die Schlüsse daraus nicht um. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf – wir befinden uns auf einer bis zum Erbrechen friedlichen und langweiligen Welt!
Ein wesentlicher Teil meines Verstandes versucht mir einzureden, dass ich mich täusche. Ich hatte schnell reagiert, als ich meinen Begleitern gesagt habe, sie sollten landen. Aber diese Anweisung hatte ich gegeben, damit wir nicht geortet werden und unsere wissenschaftliche Mission nicht gefährden. Die Situation ist nun blitzschnell gekippt. Es geht um Leben und Tod, und ich bin zu keiner Entscheidung mehr fähig. Wie auch? Ich bin Wissenschaftlerin, kein Raumsoldat!
Durch mein Verharren gefährde ich mich selbst. Der Ernst der Lage wird mir erst bewusst, als endlich Bewegung in die Chenno kommt. Hunderte gewaltige Krötenkörper drängen in die schmale Seitengasse, in der ich runtergekommen bin. Anders als bislang beobachtet können diese Wesen auch an Land verflixt schnell sein. Ich wende mich um, als die Masse auf mich zukommt, und renne los.
Nur: Der einzige Ausgang des Sträßchens wird ebenfalls von einer Flut von Leibern versperrt.
Die Flugroboter, die für das Massaker und die Panik verantwortlich sind, verteilen sich und schießen weiter. Sie sind keine hocheffizienten Kampfmaschinen, scheint mir, und sie brauchen längere Pausen zwischen ihren Schüssen. Das ist gut für die Chenno insgesamt, die wohl sonst einfach niedergemäht worden wären.
Davon können sich die, die getroffen werden, aber auch nichts kaufen. Sogar ich bin in Gefahr, denn einer der Angreifer fliegt über die Gasse, in der ich mich eng an die Wand drücke, um nicht von den Fliehenden umgerissen und totgetrampelt zu werden. Gleich mehrmals ertappe ich mich mit der Hand auf dem Multifunktionsarmband oder dem Brustmodul meines Einsatzanzugs. Ich will fort, will den Gravopak einschalten. Aus dem Gedränge entkommen, in die Sicherheit des Stützpunktes fliegen.
Das Risiko ist gewaltig, dass der Einsatz eines solchen Aggregats bemerkt würde. Im Moment sind Zufallstreffer das Gefährlichste für mich. Würde ich die Anzugtechnik benutzen, würde ich mich möglicherweise aktiv zur Zielscheibe machen.
Das Massaker geht weiter. Keine anderthalb Meter vor mir trifft ein rot glimmender Thermostrahl einen bedauernswerten Chenno. Im Tageslicht sieht der Strahl nicht einmal besonders grell aus. Aber sogar ich, alles andere als eine Waffenexpertin, weiß, dass der Großteil seiner Energie im infraroten Spektrum fließt, nicht sichtbar für menschliche Augen.
Sichtbar ist dagegen die Wirkung: Der getroffene Chenno streckt seine Glieder von sich, als würden Kräfte an allen seinen vier Extremitäten zerren. Die braune, feuchte Haut wird grau und stumpf. Ich höre einen Schrei. In dem allgemeinen Chaos und Lärm bin ich trotz der kurzen Distanz nicht sicher, ob er von dem Sterbenden kam oder von jemandem, der die Szene nur beobachtet. Ich selbst war es nicht. Glaube ich.
Schockstarre. Obwohl die Wirklichkeit wie gehabt in wildem Chaos weiterfließt, obwohl Chenno aus beiden Richtungen in die Gasse drängen, sich gegenseitig blockieren und den Toten unter sich begraben ... obwohl all das geschieht, scheint es mir, als stünde auf einmal alles still.
Der Roboter ist weitergeflogen. Es ist nicht lange her, da habe ich mich darüber mokiert, dass ich vier Wochen lang keine toten Chenno zum Sezieren bekommen habe.
Seit Beginn des Angriffs gibt es mehr als genug Auswahl. Ich schaue auf mein Multifunktionsarmband und bin fassungslos: Das ist nicht einmal 120 Sekunden her!
Es muss der Schock sein, der da aus mir spricht. Oder vier Wochen auf engem Raum mit Johann Aspra. Oder beides. Ein solcher Zynismus sieht mir nicht ähnlich.
Es ist ein kleiner und kleinlicher Gedanke, aber vielleicht gibt er mir gerade deshalb meine Handlungsfähigkeit zurück. Mich selbst zu schelten, daran bin ich gewöhnt. Damit kann ich umgehen, besser jedenfalls als mit einem plötzlichen Massenmord.
Ich löse mich aus der Schockstarre und klettere in einen Fensterrahmen, greife nach dem niedrigen Dach über mir. Damit bin ich halbwegs aus der Bahn der drängelnden und quetschenden Leiber. Niemand in der Masse kann gegen etwas Unsichtbares – mich! – gedrückt werden und Alarm schlagen. Nach oben gibt mir die Dachkante ein wenig Deckung gegen die Strahlen. Vielleicht kann ich mich sogar in Richtung Hauptstraße hangeln? Dort gibt es mehr Platz, möglicherweise entdecke ich einen Fluchtweg ...
Es gelingt, aber das macht es nicht zu einer guten Idee. Die Hangelei über den Köpfen der Chenno gibt mir Zeit zum Nachdenken. Meter für Meter arbeite ich mich voran und frage mich, wie es dem Rest meines Teams ergeht.
Ich höre nichts von ihnen. Halten sie die Funkstille ein? Oder sind sie schon tot? Wer sagt eigentlich, dass die feindlichen Roboter wegen der Chenno da sind? Was, wenn sie eigentlich uns suchen und jagen? Habe ich irgendeinen Grund, diese Option auszuschließen?
Ich erreiche die Hauptstraße, bleibe aber erst noch einmal hängen, obwohl meine Arme allmählich schmerzen. Sie ist immer noch voll, aber lang nicht mehr so wie noch vor fünf Minuten. Zwischen den panischen Chenno kann ich den Boden sehen – und Hunderte Leichen.
Einige sind grau und ausgedörrt, getroffen von Thermostrahlen. Die meisten sind jedoch immer noch glitschig-braun. Sie wurden totgetrampelt. Die Angst vor dem Angriff forderte wohl mehr Opfer als der Angriff selbst. Jedenfalls bislang, denn die schwebenden Oktaeder schießen weiter, schweben dabei ruhig über die Siedlung wie dahintreibende Ballons in einer Frühlingsbrise.
Ich plane meinen Weg zurück zum Shift. Einmal mehr wird mir bewusst, dass ich keine Soldatin bin. Ein trainierter Kämpfer hätte wohl kaum denselben idiotischen Fehler gemacht wie ich: auf der falschen Seite des Kanals zu landen.
Ich kann meine Dummheit kaum fassen. 30 Meter in Richtung des Berges hätte ich fliegen müssen, bevor ich meinen Antigrav abschaltete. Dann hätte ich einen geraden Weg über Land. So aber müsste ich einen mehrere Hundert Meter langen Kanal entlanglaufen, von dem ich glaube, dass es dort irgendwo eine Brücke gibt. Sicher bin ich mir nicht.
Oder ich verwende doch den Gravopak. Wenn die Roboter es bemerken und auf mich schießen – ob ich den Schmerz noch spüre? Oder bin ich dann sofort tot?
Ich hänge zu sehr am Leben, um es zu probieren.
Ich würde die Schuld an meiner Situation gerne auf irgendjemand anderes schieben, und sei es ein missgünstiges Schicksal. Aber ich fürchte, das Desaster habe ich mir allein zuzuschreiben.
Wieder frage ich mich, was die anderen machen. Konkreter: Ob sie genau so dumm waren wie ich. Kor hatte gar keine Chance, sich genauso dämlich anzustellen wie ich. Er war in der Nähe des Raumhafens, als der Angriff begann. Bis dahin reicht der Kanal nicht. Aber wo waren Lilja und Aspra zu dem Zeitpunkt? Sind sie möglicherweise schon auf halbem Weg zu unserem Stützpunkt, während ich noch mitten in der Siedlung an einer Dachrinne hänge und mir das Jaulen verbeiße?
Dann ist die Zeit zum Grübeln vorbei. Drei Dinge passieren gleichzeitig: Die Rinne bricht. Einer der unheimlichen Todbringer driftet über das Dach und erschießt einen Chenno etwa 15 Meter von mir entfernt. Und zwei Dutzend Chenno, überrascht von diesem Angriff, ändern plötzlich ihre Laufrichtung und walzen auf die Stelle zu, auf der ich gerade schmerzhaft auf dem Rücken lande.
Ich rolle mich auf die Seite, versuche fortzukommen – zu langsam. Ein Chenno stolpert über mich, stürzt völlig überrascht und schreit dumpf. Die, die ihm folgen, haben mich unter meinem Deflektorschirm natürlich auch nicht gesehen, sind genauso überrascht und rennen ungebremst in ihren gestrauchelten Begleiter. Eine ganze Stampede trampelt und stolpert über mich hinweg.
Unter größten Mühen bringe ich meine Arme nach oben, um meinen Kopf zu schützen. Ein Reflex, denn eigentlich schützt der Helm des Anzugs meinen Kopf. Tritte gegen die Beine, Tritte auf die Brust, Tritte in den Unterleib. Schreie, weil immer mehr Chenno bemerken, dass etwas nicht stimmt. Wie lange wird es dauern, bis die Roboter aufmerksam werden?
*
Da spüre ich Hände – menschliche Hände. Jemand packt mich unter den Armen und zieht mich aus dem Pulk. Wir legen nur eine kurze Strecke zurück, vielleicht zwei Meter – aber sie machen den Unterschied. Ich werde nicht totgetrampelt wie die vielen Chenno, die ich gesehen habe. Ich werde leben!
Mein Blick klärt sich. Dank der Antiflexfunktion meines Helmvisiers sehe ich meinen Retter: Es ist Kor.
Er zieht mich auf die Beine und deutet auf den Berg. Er sagt etwas. Ich verstehe ihn nicht.
»Was?«, rufe ich.
»... fliegen«, kann ich mühsam ausmachen.
Ich rufe nun nicht mehr, ich schreie. Noch so ein dummer Fehler. Natürlich, Funk geht nicht, wir wollen schließlich keine ortbaren Signale ausstrahlen – nicht mehr als nötig jedenfalls. Die Helmlautsprecher sind ebenfalls ziemlich auffällig. Aber auf das Naheliegende komme ich nicht.
Kor zieht mich zu sich heran. Sein Helm klonkt gegen meinen. Natürlich! Die Helme übertragen die Vibrationen des Schalls direkt.
Es klingt dumpf, aber verständlich. »Wir müssen fliegen«, sagt Kor.
»Wir haben Befehl, das nicht ...«
»Befehl ist mir egal, ich will überleben!«
»Und die Ortung?«
»Wie willst du hier denn sonst wegkommen?«
Ich überlege, so gut das mit rasendem Herz möglich ist, und mit mehr Adrenalin als Blut in den Adern. Nachdem ich gerade schon auf meinen ersten Metern am Boden beinahe totgetrampelt worden bin, erscheint es mir nicht mehr realistisch, die ganze Strecke bis zur Kanalbrücke zu laufen.
Diesmal habe ich die offensichtliche Lösung. »Wir tauchen!«, rufe ich.
»Was?«, ruft Kor, aber ich packe ihn einfach an der Hand und ziehe ihn mit mir, quer über die Straße. Wir lassen uns von der Masse treiben, mit einem leichten Drall nach links zur Uferpromenade.
Kor versteift sich, als er endlich begreift, was ich vorhabe, doch ich ziehe ihn mit mir. Wir fallen etwa anderthalb Meter, dann klatschen wir ins Wasser.
Von einem Moment auf den anderen sind wir in einer völlig neuen Welt. Es ist ruhig. Ich fühle mich geborgen. Aufgewühlter Sand vom Grund mindert die Sicht, aber nicht so stark, dass man nichts mehr erkennen könnte. Ich sehe mich um, erwarte fliehende Chenno, die sich mit eleganten Beinstößen Richtung offenes Meer in Sicherheit bringen. Doch es scheint, als wären wir in diesem ruhigen, dämpfenden Medium ganz für uns allein.
Hat jemand die Spritzer bemerkt? Ich weiß es nicht. Sind wir sicher? Ich weiß es nicht. Können Thermostrahlen uns unter Wasser überhaupt erreichen? Das weiß ich erst recht nicht. Kor weiß das bestimmt. Ich werde ihn fragen. Bald. Erstaunlicherweise ist für den Moment jedes Gefühl von Dringlichkeit von mir abgefallen.
Ich bin nicht gern in engen, geschlossenen Räumen. Ein weiterer Grund, warum ich mich die vergangenen Wochen so unwohl gefühlt habe. Der Shift, unser Zuhause, war an sich schon beengt. Zudem hatte ich noch die Angst, der Berg könnte jederzeit über uns zusammenstürzen – eine lächerliche und unbegründete Angst, wie Aspra mir spöttisch versicherte. Unser Geologe und Materialwissenschaftler hat die Statik der Höhle geprüft. Meine Furcht konnte das nicht besänftigen, dafür zeigten die Hänge des Bergs viel zu viele Spuren frischer Steinlawinen.
Unter Wasser, von allen Seiten durch das Medium bedrängt, abgeschnitten von Klängen und dem größten Teil des Tageslichts, mit einer Sichtweite von weniger als zehn Metern, müsste meine Klaustrophobie voll zuschlagen. Sollte man meinen. Das Gegenteil ist richtig. Ich fühle mich geborgen, durch eine dicke, weiche Schicht getrennt von und geschützt vor einer Welt, die mir Böses will.
Kor sieht das offenbar anders. Er zappelt neben mir, unkontrolliert, fast wie ein Fisch auf dem Trockenen – ein eigenartiges Bild angesichts unseres Umfelds, aber es ist das, was mein Hirn mir ausspuckt.
Ich ziehe Kor zu mir oder mich zu ihm und lege die Scheibe meines Helmvisiers an die seine. Immerhin bin ich lernfähig. »Was hast du?«, frage ich, und die Vibration des Schalls überträgt sich wieder zu ihm, ganz ohne Funk.
»Nichts«, behauptet er, aber ich sehe sein Gesicht aus kurzer Distanz, erkenne die Scham ... Und verstehe. Kurz muss ich lachen. Es tut mir leid, aber es ist ein so banales Problem in einer Auf-Leben-und-Tod-Lage, dass ich nicht anders kann.
»Warte«, sage ich, »ich zeige dir, wie man schwimmt! Es ist einfach, und in dem Anzug kann dir eh nichts passieren!« Das stimmt so nicht, denn es ist nur ein leichter Anzug, kein SERUN, den wir tragen. Dessen Schutz ist begrenzt. Ich will ihm jedoch Mut machen, nicht ihn noch mehr verunsichern.
Angeblich gab es einmal eine Zeit, in der fast jedes terranische Kind schwimmen gelernt hat. Heutzutage nicht mehr. Wir haben als Spezies den Weltraum erobert und die Wunderwelt unter Wasser aus dem Blick verloren. Vermutlich hätte ich sonst früher bemerkt, dass die Chenno Amphibien sind.
Sehr langsam führe ich den Brustschwimm-Armschlag vor und schiebe mich einen ersten Meter in Richtung unseres Ziels voran. Kor imitiert die Bewegung unsicher. Er schafft nur einen halben Meter, aber es ist ein Anfang. Ich zeige ihm einen Daumen aufwärts und mache einen weiteren Zug.
Nach kurzer Zeit gelingt ihm das Schwimmen einigermaßen. Wir kommen jedenfalls voran. Über uns tobt wahrscheinlich immer noch das Inferno, aber hier unten sind wir für den Moment sicher. Ich kann mich sogar amüsieren. Ich bin 24 Jahre alt, er 31. Ich komme aus einer reichen, behütenden Familie. Er hat so viel mehr erlebt als ich. Sonst lerne ich von ihm. Aber nun gibt es etwas, das ich ihm zeigen kann ...
Nur zwei Meter vor uns stürzt etwas ins Wasser. Ein toter Chenno. Seine trockene graue Haut wird unter Wasser wieder braun. Das gibt ihm freilich das Leben nicht wieder. Blut fließt aus seiner Brust. Hoffentlich gibt es hier keine Haien vergleichbare Meeresräuber.
Der Moment der Ruhe, die Illusion des Friedens – sie sind zerstört. Ich will nur noch schnell weg und in Sicherheit. Ich beschleunige meine Schwimmzüge. Kor macht notgedrungen und ungeschickt mit.
Wir arbeiten uns durch das Kanalsystem, das die Stadt durchzieht. Gelegentlich sehen wir tote Chenno. Keine lebenden. Es ist mir ein Rätsel, warum sie sich nicht auf diesem Weg in Sicherheit bringen. Haben die landlebenden Exemplare der Spezies die Fähigkeit zur Wasseratmung verloren?
So oder so, das Wasser spielt eine größere Rolle für sie, als wir dachten. Während wir die Befestigung entlangschwimmen, passieren wir alle paar Meter große, runde Rohre, die in Richtung der Häuser weisen. Wie Abwasserrohre wirken sie nicht, dafür sind sie viel zu riesig. Ein weiteres Rätsel dieser Zivilisation, das wir nicht bemerkt haben, weil wir nur ihr Verhalten an Land betrachtet haben. Was sind wir bloß für eine Schande für die stolze terranische Explorerflotte!
Und dann erreichen wir das westliche Ende des Kanalsystems. Das ist der Moment der Wahrheit: Haben wir uns weit genug von den Angreifern entfernt? Oder haben sie uns bemerkt und lauern nur darauf, dass wir den Kopf aus dem Wasser strecken, um uns mit zwei schnellen Schüssen zu grillen?
Einer von uns muss zuerst gehen. Kor presst die Lippen aufeinander, nickt und taucht auf. Mir stockt der Atem. Mein Herz pocht wild.
Und dann läuft alles gut. Kor hat die Promenadenkante zu fassen bekommen und zieht sich in die Höhe.
Ich folge ihm Sekunden später. Tatsächlich sind die Roboter weit entfernt. Natürlich, keine Garantie, dass wir in Sicherheit sind. Thermostrahlen reichen weit. Und das Massaker ist nicht beendet. Schnell weg!
Wir hinterlassen eine Tropfspur, als wir uns unsichtbar aus der Siedlung schleichen. Ich suche nach ähnlichen Fährten, die auf Lilja oder Aspra hindeuten könnten. Nichts dergleichen. Nach wie vor wissen wir nicht, ob sie entkommen sind – und falls ja, auf welchem Weg.
Die Höhle, in der wir unseren Shift versteckt haben, liegt in etwa fünfhundert Metern Höhe. Luftlinie! Der Weg ist steil. Sagte ich Weg? Eher ein Pfad, der Hang, über den er führt, ist voll von bröseligem Geröll. Wir haben unser Versteck danach ausgesucht, dass es nur mit unserer terranischen Technik bequem erreicht werden kann, aber nicht zu Fuß.
Genau das müssen wir aber. Hinterher ist man schlauer.
Im Wasser habe ich die Führung übernommen, nun ist Kor an der Reihe. Er bewegt sich verblüffend sicher, findet die Stellen, an denen man auftreten kann, ohne dass der halbe Berg ins Rutschen kommt. Dass das leicht geschehen kann, beweisen die breiten, hellen, noch nicht verwitterten Schneisen rechts und links von uns. Es wäre ein albernes Ende: mysteriösen todbringenden Robotern entronnen, um bei einer Lawine umzukommen. Ich bin froh, jemandem zu folgen, der uns diese Schmach ersparen kann.
Der Aufstieg dauert eine Weile, aber nach etwas mehr als einer halben Stunde sind wir am Ziel. Wir erklimmen den Felssims, der wie ein kleiner Balkon vor unserer Höhle in die Luft ragt. Mit schmerzenden Beinen staksen wir zum Shift.
Im Innern erwarten uns Lilja und Aspra schon. Erleichtert lasse ich mich auf meinen Stammplatz fallen.
3.
Ich ignoriere Aspra. Ohnehin meist das Beste, was man tun kann. »Wie ist die Lage?«, frage ich stattdessen Lilja.
»Unverändert«, antwortet sie. »Die Flugroboter schießen die Chenno ab, und die können sich nicht wehren. Viele sind inzwischen aus der Stadt geflohen, aber die Roboter haben ihren Aktionsradius ebenfalls ausgedehnt. Nur ein kleiner Teil von diesen Dingern scheint wirklich schießen zu können. Die anderen sind Suchroboter, und wenn einer davon einen Flüchtigen entdeckt hat, kommt ein Killer und erledigt die Arbeit.«
Die Arbeit. Wenn ich lumineszierende Moose untersuche, ist das die Arbeit. Das Niederschießen intelligenter Lebewesen ist es nicht, zumindest nicht in meinem Wortschatz. Aber vermutlich muss sich Lilja auf ihre Weise davor schützen, unsere Erlebnisse zu nah an sich heranzulassen. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie mein Gehirn sich unten in der Gasse einfach ausgeklinkt und mit absurden Nebensächlichkeiten beschäftigt hat.
»Was können wir tun?«, frage ich.
»Nichts«, antwortet Kor. »Wenn wir zu starten versuchen, orten sie uns sicher und schießen uns ab, sobald wir aus der Deckung der Höhle raus sind. Wenn wir die MUNGO anfunken: dasselbe.«
»Das habe ich nicht gemeint«, gebe ich zurück, und bin etwas entsetzt, dass ich das überhaupt klarstellen muss. »Was können wir tun, um den Chenno zu helfen?«
Aspra lacht herzhaft, aber ohne eine Spur Freundlichkeit.
»Was?«, fahre ich ihn an.
»Nichts können wir tun«, sagt er. »Nicht das Geringste.«
Ich will das nicht wahrhaben und sehe zu Lilja. Man sieht ihr an, dass sie scharf nachdenkt. Über was?
Aspra spricht weiter. »Jede Maschine, die wir anschalten, lenkt nur Aufmerksamkeit auf uns. Und kurz danach sind wir tot. Danke, aber ohne mich.«
»Das mit den Maschinen«, giftet Kor ihn an, »war dir egal, als du hierhergeflogen bist. Du hättest uns alle umbringen können, wenn sie dich geortet hätten!«
Für einen Moment frage ich mich, wovon er da redet, dann schäme ich mich. Ich bin ein derart unerfahrenes Küken. Natürlich kann ein Siganese ohne Einsatz eines Antigravs keinen 500 Meter hohen Berg erklimmen, jedenfalls nicht in der kurzen Zeit seit Beginn des Angriffs. Johann Aspra ist nur 13 Zentimeter groß. Für ihn ist das eine Höhe, die für mich fast einem Achttausender entspricht, also den höchsten Bergen überhaupt auf Terra.
»Was bedeutet,« sagt Lilja grüblerisch, »dass Johanns Antigraveinsatz nicht zur Entdeckung geführt hat. Möglicherweise orten die Roboter nicht auf die charakteristische Streustrahlung hin, weil sie wissen, dass die Chenno diese Technik überhaupt nicht besitzen. Mit uns rechnet hier schließlich keiner.«
Das Nachdenkliche in ihren Zügen weicht entschlossener Härte. »Wie können wir das nutzen?«, fragt sie. »Für uns oder für die Chenno?«
»Die Chenno wollen nicht gerettet werden«, behauptet Aspra. »Sonst würden sie einfach ins Wasser hüpfen.«
Das glaube ich nicht, sonst würden sie nicht versuchen, über Land zu fliehen. Dass niemand versucht hat, in die Kanäle zu entkommen, muss einen anderen Grund haben. Wieder kommt mir die Frage in den Sinn: Hat der landlebende Teil der Chenno möglicherweise die Fähigkeit verloren, im Wasser zu atmen?
»Die Suchroboter erweitern den Aktionsradius«, meldet Kor. Er starrt auf einen Bildschirm im Shift. Da erst bemerke ich, dass eine der Sensorenkisten, die wir vor Kurzem zum Abflug verstaut haben, geöffnet wurde und schräg im Laderaum steht. Lilja und Aspra waren also nicht untätig, sondern haben einen Teil der Beobachtungsphalanx wieder aufgebaut.
Leider hat Kor noch mehr zu melden. »Ein paar von Dingern driften ziemlich genau in unsere Richtung. Wenn sie Metall orten können, werden sie den Shift bemerken.«
»Dann versuchen wir den Durchbruch!«, schlage ich vor. »Wenn sie uns ohnehin bemerken, können wir versuchen, ins All zu kommen!«
»Oder«, sagt Aspra scharf, »für die von uns mit durchschnittlicher Intelligenz aufwärts und ohne ausgeprägte Todessehnsucht: Wir verstecken den Shift und warten, bis die Gefahr vorbei ist.«
Kor fährt auf, als Aspra mich beleidigt, aber Lilja bedeutet ihm, ruhig zu bleiben.
»Wie stellst du dir das vor?«, fragt sie Aspra.
Unser Geologe und Materialwissenschaftler grinst und zeigt Richtung Decke. »Poröses Gestein voller Wasseradern«, antwortet er. »Der Berg bröckelt sowieso vor sich hin. Wenn wir den Shift gegen die Decke krachen lassen, stürzt die Höhle ein. Das Gestein gibt uns Ortungsschutz und zeigt den Robotern, dass in dieser Höhle sowieso nichts überlebt hat.«
»Wenn wir den Antrieb ...«, beginnt Kor.
Aspra unterbricht sofort. »Kein Antrieb. Nur Schwerelosigkeit. Der Shift verliert sein Gewicht, behält aber seine Masse. Wir können ihn mit Muskelkraft gegen die Decke schleudern. Dann sollten wir nur schnellstens aus der Höhle raus.«
Dieser Teil des Plans erschreckt mich, denn damit verlieren wir unsere Basis – zumindest, bis sich die Situation draußen verändert und wir die Höhle wieder räumen können. Aber das ist besser, als im Innern des Schwebepanzers auszuharren und ohne Infos von außen die Stunden, Tage oder Wochen abzusitzen. Zudem: Meine Klaustrophobie würde sich bedanken, wenn ich ohne Ausweg unter Tonnen von Gestein begraben sitze. Aspra hat recht, wir müssen raus aus dieser Kiste.
Nur: wohin? Lilja stellt die Frage.
»Es gibt andere Höhlen im Berg«, doziert Aspra mit selbstgefälliger Überlegenheit. »Sehr hübsche sogar, ich habe mir ein paar angesehen. Wir können auf Moospolstern schlafen, geschützt von einem pittoresken Wasserfall, der den Eingang verbirgt. Für den Shift sind diese Höhlen zu klein. Für uns sind sie groß genug.«
Daran gefällt mir einiges nicht. Das fängt damit an, dass Moosbetten für einen ein paar Hundert Gramm schweren Siganesen bequemer sind als für ausgewachsene Terraner von ... nun, ich will hier nicht mein Gewicht diskutieren.
Bloß, was wäre die Alternative? Entdeckung durch die Roboter. Nicht schön, ganz und gar nicht. Also behalte ich meine Bedenken für mich.
Und auch Kor gibt Aspra kein Kontra, gegen jede Gewohnheit. Er ist sogar als Erster draußen, nachdem wir Vorräte eingepackt und uns sicherheitshalber alle bewaffnet haben. Er aktiviert den Antigrav des Shifts, und verpasst dem zehn mal vier Meter großen Panzer einen gewaltigen Tritt. Wider besseres Wissen erwarte ich, dass er sich dabei alle Zehen bricht.
Das geschieht nicht. Stattdessen steigt das viele Tonnen schwere Ungetüm in die Höhe. Wir anderen packen mit an und geben zusätzlichen Schwung. Dann nehmen wir die Beine in die Hand und fliehen Richtung Sims.
Mit einem ohrenbetäubenden Knirschen bohrt der Schwebepanzer sich ins Gestein. Die von Aspra prognostizierte Kettenreaktion beginnt. Risse im Fels, Staub, herabschwebende Brocken. Der Shift erhält sein Gewicht zurück und fällt mit irrwitzigem Getöse aus zwei Metern Höhe auf den Boden.
Die Erschütterung gibt der Höhle den Rest. Ich sehe nichts mehr, nur noch Staub. Der Lärm lässt keinen Zweifel daran, dass der komplette Hohlraum zusammenbricht. Der Plan hat funktioniert.
Der einzige Haken daran ist, dass wir den Planeten nicht mehr verlassen können.
Erst in drei Tagen erwartet uns die MUNGO PARK zurück. Ich frage mich, was passieren wird, wenn wir uns nicht melden. Werden sie ein Rettungskommando schicken? Oder ergreifen sie die Flucht, wenn sie auf den Widerstand der Roboter treffen? Was, wenn die Roboter Verstärkung im All haben und die MUNGO zerstören? Sitzen wir dann bis ans Ende unserer Tage auf diesem Planeten fest?
Und wie weit ist dieses Ende entfernt, wenn die mörderischen Roboter von unserer Anwesenheit erfahren?
*
Sagte ich, der einzige Haken sei, dass wir den Planeten nicht mehr verlassen können? Wir sind nicht einmal 300 Meter weit gekommen, als mir klar wird, wie falsch diese Einschätzung war.
»Roboter unten am Hang!«, ruft Aspra. »Landen, wir müssen klettern. Und jemand muss mich tragen.«
Kor aktiviert eine Funktion seines Anzugs, vermutlich den optischen Zoom. »Sie verfolgen einen Chenno.« Kurze Pause, dann: »Der ist winzig. Das muss noch ein Kind sein.«
Er ist schwierig, zu verstehen. Ein anhaltendes Knirschen übertönt ihn beinahe und verrät, dass der Berg hinter uns noch lange nicht zur Ruhe gekommen ist.
Auch ich schalte den Zoom meines Visiers an. Allerdings betrachte ich den großen Felsvorsprung vor unserem ehemaligen Stützpunkt. Unseren »Balkon«. Ein Spalt zieht sich von oben senkrecht hindurch, knapp vor der Felswand. Gesteinsstaub wolkt heraus.
Ich schlucke, als mir klar wird, was das bedeutet. Der Sims wird brechen und in die Tiefe stürzen. Genau dorthin, wo gerade ein unschuldiges und ahnungsloses Kind vor zu allem entschlossenen Mördern flieht.