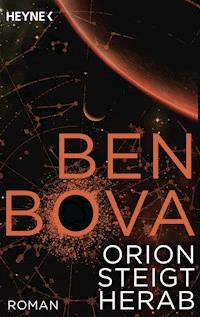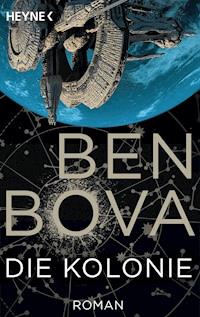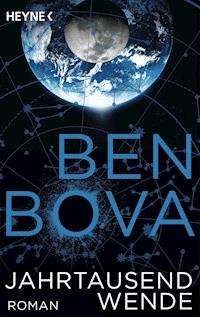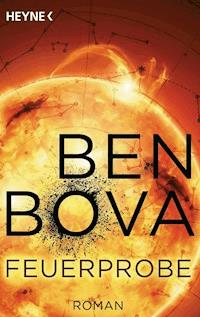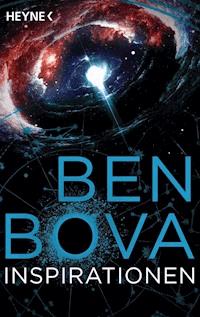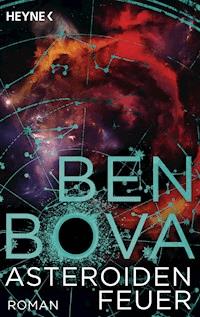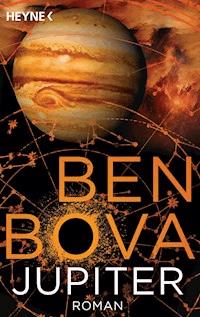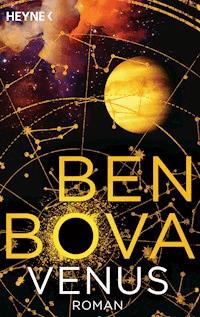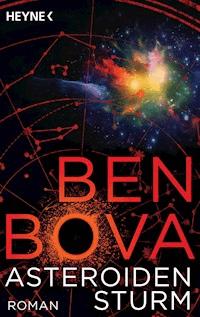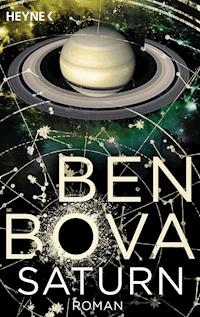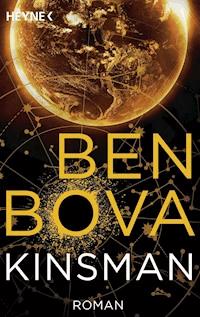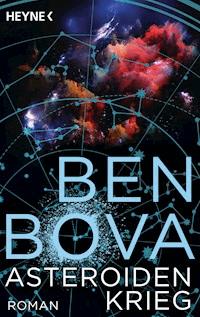
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Asteroidenkrieg beginnt
Während die letzten Rohstoffe dahinschwinden, steht die Erde vor einer gigantischen Klimakatastrophe. Da fasst Dan Randolph, ein privater Raumfahrtunternehmer, einen so atemberaubenden wie riskanten Plan: Er will eine Expedition in den Asteroidengürtel des Sonnensystems schicken, um die ungeheuren Ressourcen zwischen Mars und Jupiter für die Erde Menschen zu erschließen und damit die Zukunft zu sichern. Seinem Gegenspieler Martin Humphries, Erbe des milliardenschweren Humphries Trust, ist das Schicksal der Erde völlig gleichgültig. Er lebt in einer luxuriösen Idylle auf dem Mond und sein einziges Ziel ist es, sein Vermögen zu mehren und seine Macht auszubauen. So beabsichtigt er, Randolphs Raumfahrtunternehmen seinem Trust einzuverleiben, um das Know-how zu übernehmen und zu gegebener Zeit selbst Ansprüche im Asteroidengürtel zu erheben. Und aus diesem Grund setzt er alles daran, Randolphs Expedition scheitern zu lassen – und geht dabei buchstäblich über Leichen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.diezukunft.de
DAS BUCH
Die nicht allzu ferne Zukunft: Während die letzten Rohstoffe dahinschwinden, steht die Erde vor einer gigantischen Klimakatastrophe. Da fasst Dan Randolph, ein privater Raumfahrtunternehmer, einen so atemberaubenden wie riskanten Plan: Er will eine Expedition in den Asteroidengürtel des Sonnensystems schicken, um die ungeheuren Ressourcen zwischen Mars und Jupiter für die Erde und ihre Bewohner zu erschließen und damit die Zukunft der Menschheit zu sichern. Seinem Gegenspieler Martin Humphries, Erbe des milliardenschweren Humphries Trust, ist das Schicksal der Erde allerdings völlig gleichgültig. Er lebt in einer luxuriösen Idylle auf dem Mond und sein einziges Ziel ist es, sein Vermögen zu mehren und seine Macht auszubauen. So beabsichtigt er, Randolphs Raumfahrtunternehmen seinem Trust einzuverleiben, um das Know-how zu übernehmen und zu gegebener Zeit selbst Ansprüche im Asteroidengürtel zu erheben. Und aus diesem Grund setzt er alles daran, Randolphs Expedition scheitern zu lassen – und er geht dabei buchstäblich über Leichen …
DER AUTOR
Ben Bova, 1932 in Philadelphia geboren, ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren unserer Zeit. Insbesondere mit den Romanen aus der sogenannten Sonnensystem-Reihe »Mars«, »Venus« und »Jupiter« war er außerordentlich erfolgreich. Bova lebt und arbeitet in Florida.
Inhaltsverzeichnis
Memphis
»Mein Gott«, murmelte der Pilot immer wieder. »Mein Gott, mein Gott, mein Gott.«
Der Helikopter flog nach Norden und wurde zwischen dem verwüsteten Land unter sich und den dicken grauen Wolken am Himmel über sich von Turbulenzen geschüttelt, während er der Interstate 55 vom Memphis International Airport zu den Ruinen der verwüsteten Stadt zu folgen versuchte.
Den Highway sah man nicht. Er war bis zum Horizont mit Flüchtlingen übersät: Ein endloser Strom aus Personenwagen, Lastwagen und Bussen quälte sich Stoßstange an Stoßstange vorwärts, und wie Ameisen durcheinander wuselnde Fußgänger trotteten im sintflutartigen Regen an den Straßenrändern entlang. Frauen schoben Kinderwagen, und Männer und Jungen zogen Karren, hoch mit Hausrat beladen, den sie aus den Häusern gerettet hatten. Das Wasser schwappte schon an die Deichkronen und stieg unaufhaltsam weiter. Es drohte die unglücklichen Menschen zu verschlingen, die alles hatten aufgeben müssen – ihre Häuser, ihre Hoffnungen, ihre ganze Welt –, um sich vor den steigenden Fluten in Sicherheit zu bringen.
Dan Randolph spürte, wie die Sicherheitsgurte ihm in die Schulter schnitten, während er von seinem Platz hinter den zwei Piloten finster aus dem Fenster schaute. Er hatte hämmernde Kopfschmerzen, und die Filterstopfen in den Nasenlöchern verursachten ihm wieder Schmerzen. Das Bild des mächtigen Flüchtlingsstroms, der sich träge über den Highway wälzte, zog ihn so in den Bann, dass er kaum spürte, wie der Hubschrauber von den Windstößen durchgeschüttelt wurde. Es ist wie in einem Kriegsgebiet, sagte Dan sich. Nur dass der Feind Mutter Natur ist. Die Flut war schon schlimm genug, aber die Erdbeben brachen ihnen das Rückgrat.
Dan setzte wieder das elektronisch verstärkte Fernglas an die Augen und spähte in dem durchnässten Elendszug nach einem Gesicht, nach einer Person, der einen Frau, zu deren Rettung er hergekommen war. Es war aussichtslos. Es mussten eine halbe Million Menschen dort unten sein, sagte er sich. Wenn nicht noch mehr. Es glich der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Der Hubschrauber wurde von einem plötzlichen Windstoß durchgeschüttelt, sodass das Fernglas schmerzhaft gegen Dans Augenbraue geprellt wurde. Er wollte dem Piloten etwas zurufen und sah dann, dass sie schon in die nächste Wolke geflogen waren. Dicke Regentropfen prasselten gegen die Fenster des Helikopters und raubten Dan fast die Sicht.
Der Pilot ließ die transparente Schutzwand zurückfahren, die Dans Kabine isolierte. Dan unterdrückte den Impuls, sie wieder mit Schmackes zuzuschieben. Wozu ist eine sterile Barriere denn gut, wenn sie geöffnet und der Außenluft eine Bresche geschlagen wird?
»Wir müssen umkehren, Sir«, schrie der Pilot gegen das Dröhnen der Triebwerke an.
»Nein!«, rief Dan. »Nicht ehe wir sie gefunden haben!«
Der Pilot drehte sich halb auf dem Sitz um, schaute Dan an und zeigte mit dem Finger auf die regennasse Frontscheibe. »Mr. Randolph, Sie können mich feuern, wenn wir gelandet sind, aber ich werde da nicht hindurchfliegen.«
Hinter den rubbelnden Scheibenwischern erkannte Dan vier tödliche, schlanke dunkle Säulen, die am anderen Ufer des angeschwollenen Mississippi rotierten und Staub und Schutt aufwirbelten, wo sie den Boden berührten. Sie sahen wie sich windende Schlangen aus, die über den Boden rasten und alles in ihrem Weg zerschmetterten: Gebäude flogen auseinander, Bäume wurden entwurzelt, Autos wurden wie trockenes Laub durch die Luft gewirbelt, Holzhäuser wurden in ihre Einzelteile zerlegt. Die Infrastruktur ganzer Ortschaften wurde ›en passant‹ von der gnadenlosen Urgewalt der Tornados zerstört. Es war ein Bild der Verwüstung, so verheerend wie nach einem Raketenangriff.
Der Feind ist Mutter Natur, sagte Dan sich erneut, als er wie betäubt auf die heranziehenden Tornados starrte. Es war unmöglich, ihnen Einhalt zu gebieten, und er wusste es. Man vermochte sie nicht zu bestechen, ihnen gut zuzureden, sie zu verführen oder mit Drohungen gefügig zu machen. Zum ersten Mal, seit er ein Kind gewesen war, fühlte Daniel Hamilton Randolph sich total machtlos.
Während er die Trennwand wieder schloss und in den Taschen nach dem antiseptischen Spray kramte, drehte der Helikopter ab und flog wieder zu dem zurück, was vom internationalen Flughafen noch übrig war. Die Nationalgarde von Tennessee hatte das Gelände abgesperrt; der Flughafen war die letzte Verbindung des Großraums Memphis mit dem Rest des Landes. Die Fluten hatten die Stromversorgung lahmgelegt, Brücken eingerissen und Straßen mit einer lehmig braunen Brühe überschwemmt. Der größte Teil der Stadt stand schon seit Tagen unter Wasser.
Dann kam das Erdbeben. Es hatte eine satte Neun auf der Richterskala und war so stark, dass es Gebäude von Nashville bis nach Little Rock und noch so weit nördlich wie St. Louis zerstörte. New Orleans hatte schon seit Jahren unter Wasser gestanden, derweil der unerbittlich steigende Golf von Mexiko die Küstenlinie von Florida bis Texas neu zeichnete. Der Mississippi war bis hinauf nach Cairo über die Ufer getreten und stieg weiter.
Wo nun die Kommunikation zusammengebrochen war, Millionen Obdachlose im strömenden Regen umherirrten und das Land von Nachbeben erschüttert wurde, die stark genug waren, um Wolkenkratzer zum Einsturz zu bringen, suchte Dan Randolph nach dem einzigen Menschen, der ihm etwas bedeutete, der einzigen Frau, die er je geliebt hatte.
Er setzte das Fernglas ab und legte den Kopf zurück. Es war hoffnungslos, Jane da draußen unter all den Leuten finden zu wollen …
Der Copilot hatte sich auf dem Sitz umgedreht und klopfte an die transparente Kunststofftrennwand.
»Was?«, schrie Dan.
Der Copilot versuchte erst gar nicht, den Triebwerkslärm durch die Trennwand zu übertönen, sondern er deutete auf den Ohrhörer des Helms. Dan verstand und hob die Sprechgarnitur auf, die ihm auf den Boden gefallen war. Er hatte sie schon eingesprüht, als man sie ihm überreicht hatte und bestäubte sie abermals mit dem Antiseptikum.
Als er sich das Kopfbügelmikrofon aufsetzte, hörte er die metallische, von statischem Rauschen unterlegte Stimme eines Nachrichtensprechers: »… wurde eindeutig als Jane Scanwell identifiziert. Die ehemalige Präsidentin wurde durch eine Laune des Schicksals auf President’s Island gefunden, wo sie anscheinend versuchte, einer Familie bei der Flucht vor den steigenden Fluten des Mississippi zu helfen. Ihr Boot war anscheinend gekentert, stromabwärts getrieben und hatte sich dann in den Baumkronen der Insel verfangen.
La Guaira
Es regnete auch in Venezuela, als Dan Randolph schließlich zu seinem Hauptquartier zurückkehrte. Ein neuer Hurrikan tobte in der Karibik, fegte über Barbados und die Inseln unter dem Wind hinweg und lud zweihundertfünfzig Liter Regen pro Quadratmeter auf der Insel La Guaira sowie auf Caracas ab. Und Nachschub war schon unterwegs.
Dan setzte sich hinter den großen kahlen Schreibtisch. Er war noch immer mit der zerknitterten Hose und dem Pullover bekleidet, die er auf der Reise von den Staaten getragen hatte. Im Büro roch es modrig. Durch den unaufhörlichen Regen schimmelte es, obwohl die Klimaanlage auf Hochtouren lief. Die schützenden Nasenstöpsel hatte er herausgenommen; die Luft im Büro wurde ständig gefiltert und mit starkem ultraviolettem Licht entkeimt.
Dan lehnte sich im Bürostuhl, der mit weichem hellbraunem Leder bezogen war, zurück und ließ den Blick über den sturmgepeitschten Startkomplex schweifen. Die Raketen waren wieder in die Montagehallen gebracht worden. In diesem Sturm wäre selbst der Start der robusten, zuverlässigen Raumclipper ein zu großes Risiko gewesen. Die Starttürme schwankten sichtlich in dem mit Orkanstärke wehenden Wind und wurden von horizontal anbrandenden Regenbahnen gepeitscht; bei ein paar kleineren Gebäuden waren schon die Dächer abgedeckt worden. Das Meer hinter den Starttürmen war ein Hexenkessel mit weiß gischtenden Wellen. Der Wind heulte wie ein Raubtier und ließ sogar die doppelt verglasten Fenster von Randolphs Büro erklirren.
Wir werden nun schon vom dritten Sturm heimgesucht, und dabei ist noch nicht einmal der vierte Juli. Als ob die Geschäfte nicht schon schlecht genug gingen, und nun müssen wir uns auch noch mit diesen Stürmen rumärgern. Wenn das so weitergeht, bin ich bald erledigt.
Wir verlieren, sagte Dan sich. Wir befinden uns im Krieg und verlieren ihn. Verdammt, wir haben ihn schon verloren. Es hat gar keinen Zweck, sich etwas vorzumachen.
Die Feuchtigkeit machte sich als Schmerz tief in den Knochen bemerkbar. Es war eine quasi-arthritische Erinnerung an sein Alter und an die Strahlenkrankheit, die er sich vor Jahren zugezogen hatte. Ich sollte nach Selene zurückkehren, sagte er sich. Ein Mensch mit einem kollabierten Immunsystem sollte sich nicht auf der Erde aufhalten, wenn es nicht sein muss.
Trotzdem saß er stundenlang einfach nur da und starrte auf den tobenden Sturm. Aber er sah nur das Gesicht von Jane Scanwell, erinnerte sich an den Klang ihrer Stimme, die Berührung ihrer Finger, die seidig weiche Haut, ihren Geruch und wie förmlich die Sonne aufging, wenn sie den Raum betrat. Er erinnerte sich daran, wie sie sein Leben erfüllt hatte, obwohl sie eigentlich nie richtig zusammen waren, nicht mehr als ein paar flüchtige Stunden hier und da, bevor sie sich wieder zerstritten. Es gab einfach zu viel, das sie trennte. Nachdem sie das Weiße Haus verlassen hatte, war es ihnen gelungen, ein paar Tage auf einem tropischen Atoll zu verbringen. Und selbst das hatte im Streit geendet.
Wenigstens hatten sie die Dinge einmal aus der gleichen Sicht gesehen, hatten dasselbe Ziel gehabt, denselben Kampf auf derselben Seite geführt. Der Treibhauseffekt bedeutete Krieg, ein Krieg, bei dem die globale Zivilisation der Menschheit gegen die blindwütigen Kräfte der Natur stand. Jane war das genauso bewusst wie Dan. Sie wollten zusammen in diesen Krieg ziehen.
Und sie war darin umgekommen.
Soll ich weitermachen?, fragte Dan sich. Was hat das noch für einen Zweck? Ihm war zum Weinen zumute, aber die Tränen kamen nicht.
Dan Randolph hatte immer schon größer gewirkt als seine tatsächliche Körpergröße. Er war ein robust gebautes Weltergewicht und noch immer gut in Form. Weil er aber schon in den Sechzigern war, musste er sich in der Sporthalle schinden, um die Kondition aufrechtzuerhalten. Das einst sandfarbene Haar war fast völlig grau; das Personal nannte ihn hinter seinem Rücken ›Silberfuchs‹. Er hatte das Gesicht eines Boxers mit einem kräftigen Kinn und einer Nase, die man ihm vor Jahren platt geschlagen hatte, als er noch Bauarbeiter im Weltraum gewesen war. Trotz des ganzen Reichtums, den er seit jenen frühen Tagen angehäuft hatte, hatte er sich die Nase nie richten lassen. Für manche war das ein perverser Ausdruck von Machismo. Die hellgrauen Augen, die oft vergnügt gefunkelt hatten wegen der Dummheit der Menschen, waren nun matt und traurig.
Ein akustisches Signal ertönte, und der Monitor eines Computers wuchs langsam und lautlos aus dem Tisch.
Dan drehte sich auf dem Stuhl zum Bildschirm um. Seine junge Verwaltungsassistentin schaute ihn mit ernstem Gesicht an. Die aus Caracas gebürtige Teresa war groß, langbeinig und hatte einen schokoladenbraunen Teint, dazu dunkelbraune Mandelaugen und dichtes, schimmerndes mitternachtsschwarzes Haar. Vor ein paar Jahren hätte Dan noch versucht, sie ins Bett zu bekommen und wäre wahrscheinlich auch erfolgreich gewesen. Doch nun war er einfach nur verärgert, weil sie ihn aus seinen Erinnerungen riss.
»Es ist gleich Zeit zum Abendessen«, sagte sie.
»Na und?«
»Martin Humphries wartet schon den ganzen Tag auf Sie. Zack Freiberg bittet darum, dass Sie diesen Mann zu einem Gespräch empfangen.«
Dan verzog das Gesicht. Zack war der Erste gewesen, der Dan vor dem drohenden Klimakollaps gewarnt hatte.
»Nicht heute, Teresa«, sagte er. »Ich will heute niemanden sehen.«
Die junge Frau zögerte für einen Moment und fragte dann zaghaft, beinahe furchtsam: »Soll ich Ihnen das Essen auf einem Tablett bringen?«
Dan schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht hungrig.«
»Sie müssen aber etwas essen.«
Er schaute auf ihr Bild auf dem Monitor. Sie war überaus besorgt und fürsorglich und schien wirklich zu befürchten, dass ihr Chef das Zeitliche segnete. Aber er spürte Zorn in sich aufsteigen, eine sinnlose blinde Wut.
»Nein, in Dreiteufels Namen«, herrschte er sie an. »Sie müssen etwas essen. Ich kann gottverdammt tun und lassen, was ich will, und wenn Sie an Ihrem Job hängen, sollten Sie mich, zum Teufel, in Ruhe lassen.«
Sie riss die Augen auf und öffnete den Mund, sagte aber nichts. Dan schnippte mit dem Finger, und der Bildschirm wurde schwarz. Noch ein Fingerschnippen, und er verschwand in der Nische in der Tischplatte aus poliertem Rosenholz.
Dan lehnte sich im Stuhl zurück und schloss die Augen. Er versuchte die Erinnerungen aus dem Bewusstsein zu verbannen, aber das war unmöglich.
Er hatte so kühne Visionen gehabt. Schon klar, ein oder zwei Jahrhunderte globaler Erwärmung würden zu einem Klima-Kollaps führen. Keine allmähliche Erwärmung, sondern ein plötzlicher, abrupter Wechsel des Erdklimas. Die in den Weltmeeren gespeicherte latente Wärme würde schlagartig in die Atmosphäre entweichen. Die Eiskappen am Nordpol und in der Antarktis würden abschmelzen. Der Meeresspiegel würde über ein, zwei Jahrzehnte stark ansteigen. Heftige Stürme würden in schneller Folge toben. Die klimatischen Änderungen würden Ackerland in Wüste verwandeln.
Was soll’s? Wir werden die Ressourcen des Alls zur Lösung dieser Probleme nutzen. Energie? Wir werden Solarkraftwerke bauen und Energie aus dem All an jeden Ort abstrahlen, wo sie benötigt wird. Rohstoffe? Wir werden den Mond und die Asteroiden ausbeuten; es gibt dort mehr Bodenschätze als auf der ganzen Erde. Lebensmittelproduktion?
Nun, das wäre allerdings ein Problem. Das ist uns allen bekannt. Aber mit genügend Energie und Rohstoffen könnten wir die landwirtschaftlichen Anbaugebiete bewässern, die durch die Klimaänderung zur Wüste geworden sind.
Ja, sicher. Und was haben wir getan, als die Hälfte der Weltstädte überflutet wurde? Was hätten wir zu tun vermocht? Was haben wir getan, als die Stromversorgung zusammenbrach? Als Erdbeben und Springfluten Japans industrielle Kapazität zerstörten, was haben wir da getan? Rein gar nichts. Und als dieses Erdbeben den Mittleren Westen platt gemacht hat, was taten wir da? Wir versuchten den Überlebenden zu helfen, und Jane ist bei diesem Versuch ums Leben gekommen.
Die Tür zum Büro wurde aufgestoßen, und ein hünenhafter rotbärtiger Mann kam herein. Er trug ein mit kunstvollen Schnitzereien verziertes Teakholztablett, das mit dampfenden Speisen beladen war. In seinen Pranken wirkte das Tablett wie ein Utensil aus einer Puppenküche.
»Teresa sagt, dass du was essen musst«, vermeldete er in einem lieblichen Tenor und stellte das Tablett auf Dans Schreibtisch ab.
»Ich sagte ihr doch, dass ich keinen Hunger habe.«
»Du kannst dich nicht zu Tode hungern. Iss was.«
Dan warf einen Blick aufs Tablett. Eine Schüssel mit dampfender Suppe, ein Salat, ein Hauptgang, der sich unter einer Edelstahlglocke verbarg, und eine Kanne Kaffee. Kein Wein. Nichts Alkoholisches.
Er schob dem rothaarigen Riesen das Tablett zu. »Iss du das, George.«
Big George zog einen Stuhl an den Schreibtisch, schaute seinem Boss in die Augen und schob das Tablett wieder zu Randolph.
»Iss«, sagte er. »Das tut dir gut.«
Dan erwiderte den Blick von George Ambrose. Er kannte Big George, seit es ihn als Flüchtling auf den Mond verschlagen hatte und er sich mit einer Schar Renegaten, die sich selbst ›Mond-Untergrund‹ nannten, vor den Behörden von Selene City versteckt hatte. Big George war nun Dans Leibwächter und trug maßgeschneiderte Anzüge statt geflickter Overalls, aber er wirkte noch immer wie ein halb wilder Grenzer: Er sah aus wie Rübezahl, wie die Art von Mann, der einem mit einem Lächeln den Kopf zwischen die Schultern klopft und das nicht einmal persönlich meint.
»Ich sag dir was«, sagte Dan, wobei ein Lächeln sich in sein Gesicht stahl. »Ich teile es mit dir.«
George erwiderte das Grinsen. »Gute Idee, Boss.«
Die nächsten Minuten aßen sie stumm, wobei George sich das ganze Hauptgericht einverleibte, das sich als eine dicke Scheibe Rippensteak erwies. Dan aß ein paar Löffel Suppe und knabberte am Salat.
»Besser als in den alten Zeiten, eh?«, sagte George mit vollem Mund. »Abgefuckte Soyaburger und recycelte Pisse zum Trinken.«
Dan ignorierte den Versuch des jüngeren Manns, ihn aufzuheitern. »Hat Teresa schon Feierabend gemacht?«, fragte er.
»Nee.«
Verärgert warf Dan einen Blick auf die Armbanduhr. »Sie ist nicht meine Haushälterin, gottverdammt. Ich will nicht, dass sie um mich rumscharwenzelt wie …«
»Dieser Dödel von Humphries wartet noch immer draußen«, sagte George.
»Immer noch? Er wartet immer noch? Es ist fast neun Uhr, um Himmels willen. Was hat er für ein Problem? Sitzt er wegen des Sturms hier fest? Wieso ist Teresa nicht auf die Idee gekommen, ihn in einer Gästesuite einzuquartieren?«
George schüttelte den struppigen Kopf. »Er sagte, dass er so lang warten würde, bis du ihn empfängst. Er hätte nämlich einen Termin, lässt er dich wissen.«
Dan stieß einen müden Seufzer aus. »Ich komme gerade von der Beerdigung zurück, und ich soll einen Termin einhalten, der schon vor Wochen vereinbart wurde.«
»Teresa sagt, er macht sie nervös.«
»Nervös?«
»Er macht sie an. Ich hab’s selbst gesehen.«
»Teresa kann schon selbst auf sich aufpassen«, murmelte Dan mit gerunzelter Stirn.
»Du sprichst aus Erfahrung?«, fragte George grinsend.
»Er macht sie schon die ganze Zeit an, seit er auf mich wartet?«
»Soll ich ihn rauswerfen?«, fragte George.
Für einen Moment erfreute Dan sich an der Vorstellung, wie George seinen ungebetenen Besucher hochkant aus dem Gebäude warf. Doch dann wurde er sich bewusst, dass der Kerl einfach morgen wiederkommen würde. Ich muss mich wieder ums Geschäft kümmern, sagte er sich. Ich kann diese Sache nicht ewig vor mir herschieben.
»Bring das Tablett raus«, sagte er zu Big George, »und schick diesen Humphries rein.«
George leckte sich die Lippen. »Soll ich noch Nachtisch und Kaffee bringen?«
»Na gut«, sagte Dan, der keine Lust auf einen weiteren Disput mehr hatte. »Tu das.«
Grinsend ergriff George das mit Essensresten beladene Tablett mit einer Hand und ging zur Tür. Dan sah, dass der Schreibtisch mit Krumen übersät war. Verärgert wischte er sie auf den Boden.
Teresa erschien in der Tür. »Mr. Martin Humphries«, sagte sie. Sie wirkte angespannt, sagte Dan sich. Humphries musste ihr wirklich zugesetzt haben.
Martin Humphries wirkte recht jung. Er war kleinwüchsig, noch ein paar Zentimeter kleiner als Teresa und schien ein körperlicher Schlaffi zu sein. Er hatte hängende Schultern und ›Rettungsringe‹ um die Hüfte, die vom bordeauxfarbenen Blazer nur unzureichend kaschiert wurden. Trotzdem schien er Energie auszustrahlen, als er mit raumgreifenden Schritten durchs Büro auf Dans Schreibtisch zuging.
Dan stand auf und streckte die Hand über den Schreibtisch.
»Es tut mir Leid, dass ich Sie habe warten lassen«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln.
Humphries ergriff Dans Hand und drückte sie fest. »Das macht nichts«, erwiderte er. »Es tut mir Leid, Sie in Ihrer Trauer zu stören.«
Seine Augen sagten Dan, dass er mit diesen Worten nur der Etikette genügen wollte. Martin Humphries hatte ein rundes, beinahe jungenhaftes Gesicht, aber seine Augen waren hart wie Diamant, kalt und grau wie das sturmgepeitschte Meer vor dem Fenster.
Als sie sich setzten, kam George ins Büro zurück. Er trug ein Tablett mit Gebäck und der einschlägigen Kaffeekanne, nur sie dass diesmal um zwei Porzellantassen mit Untertassen ergänzt wurde. Trotz seiner Körpergröße und -fülle bewegte George sich mit der Leichtfüßigkeit eines Tänzers – oder eines Fassadenkletterers. Weder Dan noch Humphries sagten ein Wort, als George das Tablett routiniert auf dem Tisch abstellte und das Büro geschwind auf leisen Sohlen verließ.
»Ich hoffe, ich habe Sie nicht vom Abendessen abgehalten«, sagte Dan und deutete auf das Gebäck.
Humphries ignorierte das Tablett. »Kein Problem. Ich habe die Unterhaltung mit Ihrer Sekretärin genossen.«
»Ach ja?«, sagte Dan.
»Sie ist wirklich eine Perle. Am liebsten würde ich sie von Ihnen abwerben.«
»Keine Chance«, sagte Dan schroff.
»Ist auch nicht so wichtig«, sagte Humphries mit einem beiläufigen Achselzucken. »Ich bin gekommen, um mit Ihnen über die aktuelle Lage zu sprechen.«
Dan zeigte aufs Fenster. »Sie meinen den Treibhauseffekt?«
»Ich meine, wie wir der Weltwirtschaft helfen können, sich von den horrenden Verlusten zu erholen, die sie erlitten hat – und wie wir dabei einen satten Gewinn machen.«
Dan runzelte die Stirn. Er griff nach einem der kleinen kunstvollen Gebäckstücke und beschloss dann, sich zuerst eine Tasse Kaffee einzuschenken. Dans Firma, die Astro Manufacturing Corporation, stand kurz vor dem Bankrott, und die gesamte Finanzwelt wusste es.
»Gegen einen satten Gewinn hätte ich nichts einzuwenden«, sagte er zurückhaltend.
Humphries lächelte, doch es war ein kaltes Lächeln.
»Woran denken Sie?«, fragte Dan.
»Die Erde ist durch diese plötzliche Klimaänderung ins Chaos gestürzt worden«, sagte Humphries.
»Ja, der Klimakollaps«, pflichtete Dan ihm bei.
»Selene und die anderen Mondsiedlungen hingegen kommen ziemlich gut zurecht.«
Dan nickte. »Auf dem Mond gibt es keine Energieengpässe und keine Rohstoffknappheit. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie sind mittlerweile fast autark.«
»Sie könnten der Erde helfen«, sagte Humphries. »Indem sie Solarstrom-Satelliten bauen und die Erde mit Rohstoffen beliefern. Und durch die Produktion von Gütern, die die Menschen benötigen und die sie wegen der zerstörten Fabriken nicht bekommen.«
»Wir haben das zuvor schon versucht«, sagte Dan. »Und wir versuchen es noch. Aber es ist nicht genug.«
Humphries nickte. »Und zwar aus dem Grund, weil Sie sich auf die Ressourcen beschränken, die Sie vom Mond erhalten.«
»Und von den erdnahen Asteroiden«, ergänzte Dan.
»Ja, den NEAs.« Humphries nickte, als ob er diese Antwort erwartet hätte.
»Was schlagen Sie also vor?«
Raumstation Galileo
Sie waren hinter ihr her.
Pancho Lane steckte noch immer im Raumanzug. Sie jagte schwerelos durchs Labormodul und erschreckte die japanischen Techniker bei ihrem Flug durch den zentralen Korridor, wobei sie sich alle paar Meter mit kräftigen Händen an der Labor-Ausrüstung abstieß. Hinter sich hörte sie die zornigen Rufe der Männer.
Wenn einer von diesen Hirnis auf den Trichter kommt, in den Anzug zu steigen und mich auf einer EVA1 abzufangen, bin ich erledigt, sagte sie sich.
Es hatte als Spiel angefangen, als Wettstreit. Welcher von den Piloten, die sich an Bord der Station befanden, hielt es am längsten im Vakuum aus? Es waren sechs ›Raketenjockeys‹ der Astro Corporation, die auf den Rücktransport nach Selene City warteten: vier Männer, Pancho und das neue Mädchen, Amanda Cunningham.
Pancho hatte sie natürlich angestachelt. Das war Teil des Plans. Sie hatten sich alle in der Bordküche versammelt und wären buchstäblich abgehoben, wenn sie sich nicht in den Fußschlaufen verankert hätten, die am Boden unterm Tisch und ums einzige Tischbein befestigt waren. Die Unterhaltung hatte sich schließlich nur noch ums Vakuum-Atmen gedreht: Wie lang vermag man im Weltraum den Atem anzuhalten, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen?
»Der Rekord liegt bei vier Minuten«, hatte einer der Männer gesagt. »Er wird von Harry Kirschbaum gehalten.«
»Harry Kirschbaum? Wer, zum Teufel, ist das? Ich habe noch nie von ihm gehört.«
»Er ist jung gestorben.«
Darüber hatten alle gelacht.
Amanda, die gerade erst von der Technischen Universität in London zum Team gestoßen war, hatte das engelsgleiche Gesicht eines Schulmädchens mit weichem blondem Lockenhaar und großen, unschuldigen blauen Augen – aber ihre Kurven raubten den Männern den Atem. »Bei einer Übung im Vakuum-Tank musste ich den Helm einmal verstellen«, sagte sie.
»Wie lang hat das gedauert?«
Sie zuckte die Achseln, und nicht einmal Pancho entging, wie ihr Overall sich über den Rundungen spannte. »Etwa zehn Sekunden. Vielleicht fünfzehn.«
Pancho mochte Amanda nicht. Sie hielt sie für eine kleine Schlampe, die sich mit einem britischen Oberklasse-Akzent schmückte. Nur ein Blick auf sie, und die Männer vergaßen Pancho. Das war schade, denn ein paar von den Typen waren wirklich nett.
Pancho war dünn und sehnig und hatte die langen schlanken Beine ihrer afrikanischen Vorfahren. Ihre Haut war nicht dunkler als eine schöne Bräune, die man sich unter der Sonne von Texas holte, aber sie hatte ein Allerweltsgesicht mit einem spitzen Kinn, das sie als Pferdegebiss bezeichnete und kleine, schielende braune Augen. Das Haar trug sie immer so kurz, dass das Gerücht kursiert hatte, sie sei lesbisch. Das stimmte nicht. Aber sie hatte die Kraft eines Manns in den langen, muskulösen Armen und Beinen und ließ sich in keiner Disziplin von einem Mann besiegen – es sei denn, sie legte es darauf an.
Das Zubringer-Fahrzeug, das sie nach Selene zurückbringen sollte, verspätete sich. Die Düse an einem der Triebwerke hatte einen Riss, und die Flugsicherung wollte auf keinen Fall riskieren, dass die sechs Astronauten in einem maroden Raumfahrzeug transportiert wurden. Sie würden das Vehikel in den Weiten des Alls reparieren, während sie dem Mond entgegen fielen.
Also warteten die sechs in der Bordküche und unterhielten sich über Vakuum-Atmen. Einer der Männer behauptete, er habe es eine ganze Minute lang im Vakuum durchgehalten.
»Das erklärt auch deinen niedrigen IQ«, sagte sein Kumpel.
»Niemand hat es bisher eine ganze Minute geschafft.«
»Sechzig Sekunden«, beharrte der Mann auf seiner Version.
»Das hätte die Lunge doch gar nicht ausgehalten.«
»Wenn ich’s euch doch sage, eine Minute. Auf die Sekunde genau.«
»Ohne bleibende Schäden?«
Er zögerte und schaute plötzlich verschämt.
»Na?«
»Der linke Lungenflügel ist kollabiert«, sagte er mit einem bemüht lässigen Achselzucken.
Sie kicherten.
»Ich würde die sechzig Sekunden wahrscheinlich schaffen«, sagte Pancho.
»Du?«, fragte der Mann neben ihr verblüfft. »Aber Mandy, die hat den erforderlichen Brustumfang.«
Amanda lächelte scheu. Doch dann holte sie tief Luft und trat den Beweis an.
Pancho unterdrückte den Ärger über das Balzverhalten der Männer.
»Neunzig Sekunden? Unmöglich!«
»Wollt ihr darauf wetten?«, fragte Pancho.
»Niemand hält es für neunzig Sekunden im Vakuum aus. Es würde einem die Augen ausdrücken.«
Pancho bleckte grinsend die Zähne. »Welche Summe wollt ihr denn dagegen setzen?«
»Wie sollen wir den Gewinn eigentlich einstreichen, wenn du tot bist?«
»Oder dir einen bleibenden Hirnschaden zuziehst.«
»Sie hat eh schon einen Dachschaden, wenn sie glaubt, dass sie es neunzig Sekunden im Vakuum aushält.«
»Ich werde das Geld auf einem Konto deponieren, von dem ihr fünf es im Fall meines Todes oder einer Behinderung abheben könnt«, sagte Pancho ruhig.
»Ja, sicher.«
Sie deutete auf das Telefon, das neben dem Sandwichspender an der Wand hing und sagte: »Elektronische Überweisung. Der Vorgang dauert gerade einmal zwei Minuten.«
Sie schwiegen.
»Wie viel?«, fragte Pancho und musterte sie.
»Ein Wochenlohn«, stieß einer der Männer hervor.
»Ein Monatslohn«, sagte Pancho.
»Ein ganzer Monat?«
»Wieso nicht? Wenn du so verdammt sicher bist, dass ich es nicht schaffe, warum setzt du dann keinen Monatslohn? Ich werde fünf Monatsgehälter aufs Konto einzahlen, sodass jeder von euch abgesichert ist.«
»Einen Monatslohn.«
Schließlich hatten sie sich geeinigt. Pancho wusste, dass sie darauf spekulierten, dass sie nach zwanzig, dreißig Sekunden aufgeben würde, um sich nicht umzubringen und dass sie dann ihr Geld einsacken würden.
Sie würde ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.
Also rief sie über das Telefon in der Küche ihre Bank in Lubbock an. Mit ein paar Tipps aufs Tastenfeld des Telefons hatte sie ein neues Konto eingerichtet und fünf Monatslöhne eingezahlt. Die anderen fünf Astronauten starrten auf den kleinen Bildschirm, um sich davon zu überzeugen, dass Pancho sie nichts übers Ohr haute.
Dann riefen sie der Reihe nach bei ihren Banken an und überwiesen einen Monatslohn auf Panchos neues Konto. Pancho lauschte dem Gedudel des Tonwahltelefons und legte sich eine Strategie für den Wettkampf zurecht.
Pancho schlug vor, dass sie die Luftschleuse am anderen Ende des Wartungsmoduls nahmen. »Wir wollen doch nicht, dass irgend so ein Wissenschaftsfritze Wind von der Sache bekommt und in seinem Übereifer den Sicherheitsalarm auslöst«, sagte sie.
Sie waren alle damit einverstanden. Also schwebten sie durch zwei Labormodule und das schäbig wirkende Wohnmodul, wo die Langzeit-Forscher untergebracht waren und erreichten schließlich die geräumige Wartungseinheit. Hier suchte Pancho sich einen Raumanzug aus dem halben Dutzend Standard-Modellen aus, die am Schott hingen. Wegen ihrer Körpergröße wählte sie den Anzug in der größten Ausführung. Sie streifte ihn sich schnell über, wobei die anderen ihr sogar dabei halfen, in die Stiefel zu schlüpfen und die Anzugssysteme ausprüften.
Pancho stülpte sich den Helm über den Kopf und arretierte mit einem Klicken den Halsring.
»In Ordnung«, sagte sie durchs offene Helmvisier. »Wer stoppt meine Zeit?«
»Ich mach das«, sagte einer der Männer und hob den Arm, an dem ein digitaler Chronograph prangte.
»Du gehst in die Schleuse«, sagte der Mann neben ihm, »pumpst die Luft ab und öffnest die Außenluke.«
»Und du beobachtest mich durch das Bullauge«, sagte Pancho und tippte mit behandschuhten Knöcheln an das dicke runde Fenster in der Innenluke der Luftschleuse.
»Alles klar. Wenn ich ›jetzt‹ sage, öffnest du das Visier.«
»Und ich stoppe die Zeit«, sagte der Mann mit der tollen Uhr.
Pancho nickte im Helm.
Amanda schaute besorgt. »Bist du auch ganz sicher, dass du das durchziehen willst? Du setzt dabei dein Leben aufs Spiel, Pancho.«
»Sie kann jetzt keinen Rückzieher mehr machen.«
»Es sei denn, sie will fünf Monatsgehälter abschreiben.«
»Im Ernst«, sagte Amanda. »Ich wäre bereit, von der Wette zurückzutreten. Schließlich …«
Pancho streckte die Hand aus und strich ihr übers blonde Lockenhaar. »Keine Sorge, Mandy.«
Dann trat sie durch die offene Luke der Luftschleuse, klappte das Visier herunter und winkte ihnen zu, während sie die Luke mit dem Stellrad schloss. Sie hörte, wie die Pumpen ratternd anliefen; das Geräusch erstarb aber schnell, als die Luft aus der metallwandigen Kammer gesogen wurde. Nachdem die Anzeigelampe an der Innenluke auf rot gewechselt hatte, betätigte Pancho den Schalter, mit dem die äußere Luke geöffnet wurde.
Im ersten Moment vergaß sie, weshalb sie überhaupt hier draußen war, als sie von der atemberaubenden Schönheit der Erde geblendet wurde, die unter ihr ausgebreitet lag. Sie war strahlend hell, mit leuchtend blauen Meeren und dicken Wolken, die so blendend weiß waren, dass einem bei ihrem Anblick fast die Augen schmerzten. Es war ein grandioses Bild, ein überwältigendes Panorama, bei dem ihr Herz jedes Mal höher schlug.
Du hast etwas zu erledigen, Mädchen, rief sie sich in Erinnerung.
Sie drehte sich zur Innenluke um und sah fünf Gesichter, die sich vor dem kleinen Bullauge drängten. Pancho wusste, dass keiner von ihnen auf die Idee gekommen war, ein Funkgerät mitzunehmen. Also wies sie mit dem behandschuhten Finger aufs Helmvisier. Sie alle nickten heftig, und der Mann mit der Hightech-Uhr hielt sie hoch, sodass Pancho sie zu sehen vermochte.
Die anderen traten vom Bullauge zurück, während der Mann konzentriert auf die Uhr schaute. Er hielt vier Finger hoch, dann drei …
Pancho begriff, dass er herunterzählte.
La Guaira
Martin Humphries schaute pikiert. »Was ist denn so lustig am Asteroidengürtel?«
Dan schüttelte den Kopf. »Es ist gar nicht lustig. Es ist nur … Ich hätte das von Ihnen nicht erwartet. Sie haben doch einen Ruf als knallharter Geschäftsmann.«
»Ich halte mir zumindest zugute, dass ich einer bin«, erwiderte Humphries.
»Dann vergessen Sie den Gürtel«, sagte Dan barsch. »Ich bin schon dort gewesen und habe die Lage gepeilt. Er ist zu weit weg; die Kosten würden den Gewinn um das Tausendfache übersteigen.«
»Aber man hat es schon versucht«, insistierte Humphries.
»Einmal«, sagte Dan. »Von diesem verrückten Gunn. Und er wäre fast dabei draufgegangen.«
»Aber dieser eine Asteroid wäre schon fast eine Billiarde Dollar wert gewesen, wenn man ihn in die Mondumlaufbahn gebracht hätte.«
»Ja, und der verdammte GEC hat ihn sich unter den Nagel gerissen und Gunn in den Bankrott getrieben.«
»Diesmal wird das aber nicht passieren.«
»Und wieso nicht? Glauben Sie nicht, der GEC würde alle Ressourcen beschlagnahmen, die wir zur Erde bringen? Genau aus diesem Grund wurde der Globale Wirtschaftsrat doch gegründet – um den ganzen internationalen Handel der Erde zu kontrollieren.«
Humphries lächelte kalt. »Ich werde mit dem GEC schon klar kommen. Darauf können Sie sich verlassen.«
Dan schaute ihn ein paar Sekunden lang stumm an. Schließlich schüttelte er den Kopf und erwiderte: »Darauf kommt es nicht an. Ich wäre sogar bereit, dem GEC den Vortritt zu lassen.«
»Wirklich?«
»Ja, zum Teufel. Wir haben einen globalen Notstand. Jemand muss doch Ressourcen zuteilen, Preise kontrollieren und darauf achten, dass niemand aus dieser Krise einen Vorteil zieht und in die eigene Tasche wirtschaftet.«
»Das stimmt wohl«, sagte Humphries bedächtig. »Trotzdem bin ich der Ansicht, dass mit der Ausbeutung des Gürtels viel Geld zu machen ist.«
Dan nickte zustimmend. »Es gibt da draußen jede Menge Ressourcen, das steht fest. Schwermetalle, organische Stoffe und anderes Zeug, das der Mond uns nicht bietet.«
»Ressourcen, die die Erde braucht und für die der GEC zu zahlen bereit wäre.«
»Die Asteroiden ausbeuten«, sinnierte Dan. »Das wäre eine große Unternehmung. Eine richtig große Unternehmung.«
»Aus diesem Grund bin ich auch hier. Astro Manufacturing hat die erforderlichen Ressourcen.«
»Astro Manufacturing steht kurz vor dem Bankrott, und das wissen Sie auch.«
»Ich spreche auch nicht von finanziellen Ressourcen«, sagte Humphries mit einer beiläufigen Geste.
»Ach nein?«
»Nein.« Humphries drehte sich zum Fenster und deutete mit dem Finger auf die sturmumtoste Startanlage. »Sie haben das technische Know-how, das entsprechend ausgebildete Personal, die Raketen und die Infrastruktur, um uns in den Weltraum zu befördern.«
»Aber ich stecke auch schon in der Bredouille, weil der Markt für Start-Services zusammenbricht. Wie sollen die Leute denn noch auf dem Mond produzierte Elektronik kaufen, wenn sie durch Überschwemmungen und Erdbeben ihre Existenz verlieren.«
Humphries hob fragend die Brauen.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Dan. »Es gibt auch noch den Energiemarkt. Sicher. Aber wie viele Solarenergie-Satelliten könnten wir im Erdorbit parken? Der verfluchte GEC hat sie gedeckelt. Wir bauen gerade den vorletzten. Nach diesen zwei wird es keine weiteren Energie-Satelliten geben.«
Bevor Humphries nach dem Grund zu fragen vermochte, fuhr Dan schon fort: »Das gottverdammte Großasiatische Energie-Konsortium hat sich beschwert, dass die Energiesatelliten ihnen die Preise ruinieren. Und die verfluchten Europäer haben sich mit ihnen solidarisiert. Geschieht ihnen allen recht, wenn sie sich den Arsch abfrieren, wenn der Golfstrom versiegt.«
»Der Golfstrom?«, fragte Humphries ungläubig.
Dan nickte bekümmert. »Das ist eine der Projektionen. Der Treibhauseffekt verändert bereits die Meeresströmungen. Wenn der Golfstrom abreißt, verwandelt Europa sich in einen Kühlschrank, und die Engländer bekommen ein Wetter wie in Labrador.«
»Und wann? Wie bald?«
»In zwanzig Jahren vielleicht. Vielleicht auch erst in hundert. Fragen Sie fünf verschiedene Wissenschaftler, und Sie bekommen zehn verschiedene Antworten.«
»Da eröffnen sich doch ungeahnte Möglichkeiten«, sinnierte Humphries. »Ganz Europa erstarrt in Kälte. Überlegen Sie doch mal! Das wäre eine echte Goldgrube!«
»Ein guter Witz«, erwiderte Dan. »Ich halte es eher für eine Katastrophe.«
»Für Sie ist das Glas schon halb leer. Für mich ist es erst halb voll.«
Dan verspürte den Drang, diesen opportunistischen Grünschnabel aus dem Büro zu komplimentieren. Stattdessen lehnte er sich im Sessel zurück und murmelte: »Das ist wie eine bizarre griechische Tragödie. Die globale Erwärmung verwandelt Europa in eine Tiefkühltruhe. Wenn das keine Ironie des Schicksals ist.«
»Wir sprechen über den Energiemarkt«, sagte Humphries, der sich inzwischen wieder gefasst hatte. »Was ist mit dem Helium-3 vom Mond?«
Dan fragte sich, ob sein Besucher ihn nur auf die Schippe nehmen wollte. »Das ist ein Nullsummenspiel«, sagte er reserviert. »Es gibt nicht so viele Fusionskraftwerke dort oben – dank der Anti-Atomkraft-Idioten. Und die Gewinnung von Helium-3 aus dem Mondboden ist nicht gerade billig. Fünfzig Teile pro Million hören sich vielleicht für einen Chemiker gut an, aber ein Vermögen lässt sich damit nicht verdienen, sage ich Ihnen.«
»Dann bräuchten Sie also eine Finanzspritze, um die Ausbeutung der Asteroiden in Angriff zu nehmen«, sagte Humphries.
»Eher eine komplette Transfusion«, knurrte Dan.
»Das ließe sich einrichten.«
Dans Brauen gingen hoch. »Wirklich?«
»Ich kann das Kapital bereitstellen«, sagte Humphries geschäftsmäßig.
»Wir reden aber mindestens von vierzig oder fünfzig Milliarden.«
Humphries wedelte mit der Hand, als ob er ein lästiges Insekt verscheuchen wolle. »Für einen Demonstrationsflug bräuchte man nicht so viel.«
»Ein bloßer Demo-Flug würde aber auch schon ein paar Milliarden kosten«, sagte Dan.
»Wahrscheinlich.«
»Und wo wollen Sie diese Summen überhaupt hernehmen? Heute will doch niemand mehr in die Raumfahrt investieren.«
»Es gibt aber Leute, die bereit wären, so viel Geld in die Erschließung des Asteroiden-Markts zu investieren.«
Dan verspürte einen Anflug von Hoffnung. Es könnte funktionieren! Den Asteroidengürtel erschließen. Die Ressourcen zu den bedürftigen Menschen der Erde bringen. Doch dann schossen ihm wieder die Zahlen durch den Kopf, mit der unerbittlichen Stringenz von Newtons Bewegungsgesetzen.
»Wissen Sie«, sagte er müde, »wenn wir wenigstens imstande wären, die Kosten zu decken, dann würde ich es versuchen.«
Humphries wirkte enttäuscht. »Würden Sie sich wirklich mit Kostendeckung zufrieden geben?«
»Verdammt richtig. Die Menschen brauchen diese Ressourcen. Wenn es uns gelänge, sie ihnen zu beschaffen, ohne uns damit in den Bankrott zu treiben, würde ich sogar zum verdammten Pluto fliegen, wenn es sein müsste.«
Humphries entspannte sich sichtlich und sagte: »Ich weiß, wie wir das schaffen und trotzdem einen ordentlichen Gewinn einstreichen.«
»Und wie?«, fragte Dan mit widerstrebender Neugier.
»Fusionsraketen.«
Bei den Sieben Städten von Cibola, dieser Mann ist ein Fanatiker, sagte Dan sich. Noch schlimmer: Er ist ein Enthusiast.
»Eine Fusionsrakete wäre ein Novum«, sagte er zu Humphries. »Fusionsenergie-Generatoren sind zu groß und schwer für Fluganwendungen. Das weiß doch jeder.«
Mit dem Grinsen einer Katze, die soeben einen Kanarienvogel verputzt hat, erwiderte Humphries: »Die irren sich alle.«
Raumstation Galileo
Während Panchos fünf Astronauten-Kameraden hinter der Luftschleuse des Wartungsmoduls belämmert schauten, flog sie in der Schwerelosigkeit zum Metallausleger des robotischen Lastkrans, der aus der Raumstation ragte. Er war im Moment untätig und bog sich ohne eine stabilisierende Nutzlast-Masse durch, als Pancho ihn mit beiden Händen packte und sich wie ein Akrobat zu den Handgriffen hinaufschwang, die in die Außenhaut des Moduls eingelassen waren.
Pancho fragte sich, ob die anderen inzwischen gemerkt hatten, was für ein Spiel sie spielte. Sie zog sich an den Handgriffen über die Hülle wie ein Affe, der sich von Ast zu Ast hangelte. Für einen Beobachter außerhalb der Raumstation hätte es ausgesehen, als ob sie sich kopfüber bewegte, doch aus Panchos Perspektive hing die Raumstation über ihrem Kopf, und sie pendelte wie ein Kind in einem schwerelosen Dschungel-Abenteuerspielplatz.
Sie lachte im Helm, als sie das Ende des Wartungsmoduls erreichte und mit Leichtigkeit das Kopplungsstück zum Wohnmodul überbrückte.
»He, Pancho, was, zum Teufel, tust du da draußen?«
Sie hatten sich nun doch ein Funkgerät besorgt, sagte sie sich. Aber solang sie noch nicht durchblickten, brauchte sie sich keine Sorgen zu machen.
»Ich mache einen Spaziergang«, sagte sie. Durch die Anstrengung war sie etwas außer Atem.
»Was ist mit unsrer Wette?«, fragte einer der Männer.
»Ich bin in ein paar Minuten zurück«, log sie. »Wartet auf mich.«
»Was hast du vor, Pancho?«, fragte Amanda. In ihrer Stimme schwang Argwohn mit.
Pancho verlegte sich auf die Antwort aus Kindertagen. »Nix.«
Die Funkverbindung brach ab. Pancho erreichte die Luftschleuse am Ende des Wohnmoduls und gab den Standardcode ein. Die Außenluke glitt auf. Sie schlüpfte hindurch und verriegelte die Luke, ohne jedoch abzuwarten, bis die Schleuse sich mit Luft gefüllt hatte. Sie stieß einfach die Innenluke auf und schloss sie gleich wieder. Es wurde ein automatischer Sicherheitsalarm ausgelöst, der aber abbrach, nachdem der Druckausgleich im Modul stattgefunden hatte. Dann entledigte Pancho sich der unförmigen Anzugshandschuhe, klappte das Visier hoch und ging zum Telefon, das neben dem Luftschleusen-Schott an der Wand hing.
Die mit einem feinen Gehör und geradezu fotografischem Gedächtnis gesegnete Pancho gab die Bankdaten der fünf Astronauten ein, gefolgt von den jeweiligen Geheimzahlen. Mutter hatte immer schon gesagt, ich solle Musiker werden, sagte Pancho sich, als sie das gesamte Guthaben aller Konten auf ihr Bankkonto überwies. Sie ließ aber jeweils einen Internationalen Dollar stehen, damit die Bankcomputer nicht den komplexen Vorgang der Kontenauflösung einleiteten.
Als sie damit fertig war, schwang das Schott am anderen Ende des Wohnmoduls auf, und die fünf Astronauten schoben sich der Reihe nach durch.
»Was geht hier vor?«, fragte der erste, der durchgekommen war.
»Nix«, beteuerte Pancho erneut. Dann tauchte sie durch die Luke an ihrem Ende des langen schmalen Wohnmoduls.
Sie schwebte ins japanische Labormodul und stieß sich mit den Händen an den Ausrüstungsgestellen ab, die den Durchgang auf beiden Seiten säumten. Damit schreckte sie die Techniker auf, die hier arbeiteten. Sie lachte innerlich und fragte sich, wie lang es wohl dauern würde, bis die Raketen-Jockeys spitzkriegten, dass sie ihre Konten geplündert hatte.
Es dauerte nicht allzu lang. Als Pancho wieder in der Bordküche eintraf, schleuderten die Männer ihr wüste Flüche hinterher.
»Wenn ich dich in die Hände kriege, breche ich dir jeden einzelnen Knochen in deinem Gerippe!«, war noch eine der milderen Drohungen.
Selbst Amanda war so erzürnt, dass wieder ihr angestammter Arbeiterklasse-Akzent durchbrach: »Wir hängen dich an den Daumen auf, ich schwör’s!«
Solang ich den Vorsprung vor ihnen halte, wird mir nichts passieren, sagte Pancho sich, während sie durchs europäische Labormodul in die Beobachtungsstation flog, wo sie unter und hinter den klobigen Teleskopen und Schalttafeln Deckung suchte. Sie hörte zwar noch ihr Gebrüll, wusste aber nicht, ob sie immer noch hinter ihr her waren. In der Zwischenzeit hätten einer oder mehrere einen Raumanzug anzulegen, die Station zu verlassen und sich draußen auf die Lauer zu legen vermocht.
Und wirklich: Als sie ins russische Wohnmodul platzte, standen zwei Männer in Raumanzügen und mit hochgeklappten Visieren am entgegengesetzten Ende und erwarteten sie wie zwei Polizisten in Schutzausrüstung.
Pancho bremste ab. Eine der Trennwände, die Intimsphäre schaffen sollten, glitt zurück, und ein stoppelbärtiges, verschlafenes Männergesicht schaute heraus. Dann verschwand es schnell wieder und schob die Wand mit gemurmelten slawischen Worten zu, die wie Flüche klangen.
Die anderen drei – Amanda und zwei Männer – kamen durch die Luke hinter ihr. Pancho saß in der Falle.
»Was, zum Teufel, versuchst du hier abzuziehen, Pancho?«
»Du hast unsre Bankkonten abgeräumt!«
»Wir sollten dich aufknüpfen, du Arsch!«
Sie lächelte und breitete besänftigend die Arme aus. »Kommt schon, Leute, ihr könnt in der Schwerelosigkeit keinen aufknüpfen. Das wisst ihr doch.«
»Das ist nicht lustig«, blaffte Amanda, wobei sie sich wieder auf den aufgesetzten Oxford-Akzent verlegte.
»Ich werde euch das Geld zurückerstatten, in Ordnung?«, sagte Pancho.
»Du tätest verdammt gut daran!«
»Und die Wette hast du auch verloren. Also bekommt jeder von uns ein Monatsgehalt von dir.«
»Nein«, widersprach Pancho. »Das Vakuum-Atmen hat gar nicht erst stattgefunden, also ist die Wette hinfällig.«
»Dann wollen wir wenigstens unser Geld zurück!«
»Sicher. Kein Problem.«
Amanda zeigte auf das Telefon an der Wand. »Du hast etwas von Rückerstattung gesagt.«
Demütig schwebte Pancho zum Telefon und tippte ihre Kontonummer ein. »Ihr müsst mir eure Kontonummern geben, damit ich euch das Geld zurücküberweisen kann«, sagte sie.
»Wir werden unsre Kontonummern selbst eingeben«, erwiderte Amanda.
»Ihr vertraut mir nicht?« Pancho musste an sich halten, um nicht vor Lachen zu prusten.
Sie alle schauten sie grimmig an.
»Aber das war doch nur ein Scherz«, sagte sie. »Ich wollte euer Geld doch nicht behalten.«
»Hätte nicht viel gefehlt, und du hättest es behalten«, sagte einer der Männer barsch. »Zum Glück ist Amanda dir auf die Schliche gekommen.«
Pancho nickte in Amandas Richtung. »Du bist die Klügste von allen, Mandy«, sagte sie im Brustton der Überzeugung.
»Spar dir das«, kanzelte Amanda sie ab und wandte sich an die Männer: »Wir müssen alle die Geheimzahlen ändern, denn sie hat sie offensichtlich herausgefunden.«
»Ich werde gleich die Kontonummer ändern«, sagte einer der Männer.
»Und ich werde die Bank wechseln«, meinte ein anderer.
Pancho seufzte und setzte einen zerknirschten und reumütigen Gesichtsausdruck auf. Innerlich wollte sie sich vor Lachen schier ausschütten. Was für ein Coup! Und keiner von diesen Dummdödeln hat erkannt, dass in dieser halben Stunde, die sie mich gejagt haben, ihr Geld auf meinem Konto Zinsen gebracht hat. Es ist zwar nicht sehr viel, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Chengdu, Provinz Sichuan
Dan musste durch den Mundschutz schreien, um sich bei dem Lärm auf der Baustelle überhaupt Gehör zu verschaffen.
»Zack, meine Frage lautet nur, ob er dazu imstande ist oder nicht.«
Er kannte Zack Freiberg seit mehr als zwanzig Jahren. Zack war damals ein engagierter junger Planeten-Geochemiker gewesen, der sich der Erforschung der Asteroiden gewidmet hatte, und Dan hatte ihn von der Universität abgeworben. Freiberg hatte von seinen akademischen Freunden herbe Kritik einstecken müssen, weil er sich beim großen bösen Dan Randolph verdingt hatte, dem gierigen Kapitalisten und Vorstandsvorsitzenden von Astro Manufacturing. Doch im Lauf der Zeit hatte ein gegenseitiger Respekt sich zu einer vertrauensvollen Freundschaft vertieft. Und es war Zack gewesen, der Dan als Erster vorm Treibhauseffekt und den Auswirkungen auf das Erdklima gewarnt hatte.
Schließlich hatte der Treibhauseffekt die kritische Grenze erreicht, und die Politiker und Wirtschaftsführer der Erde hatten sie blindlings überschritten, worauf der Planet einen Klimakollaps erlitt. Zack war nicht mehr der pausbäckige Jüngling, den Dan kennen gelernt hatte. Sein rotblondes Haar war stahlgrau geworden, obwohl es noch immer voll und dicht gelockt war. In den letzten Jahren war er zäher geworden, schlanker und härter und hatte den Babyspeck verloren. Sein Gesicht war auch härter geworden, während er sah, wie seine Gleichungen und Grafiken unermessliches menschliches Leid abbildeten.
Die beiden Männer standen auf einem kahlen Bergrücken und schauten über ein ödes kohlschwarzes Tal, in dem tausende chinesischer Arbeiter unaufhörlich schufteten. Bei allen Göttern, sagte Dan sich, sie sehen wirklich aus wie eine wimmelnde Ameisenarmee. In der Mitte des Tals bliesen vier hohe Schornsteine eines großen Kraftwerks dunkelgraue Rauchwolken in den diesigen Himmel. Berge von Kohle türmten sich entlang des Schienenstrangs, der neben dem Kraftwerk verlief. Am Horizont hinterm gegenüberliegenden Höhenzug schimmerte der Jangtse-Fluss im trüben Licht der Morgensonne wie eine tödliche Würgeschlange, die langsam auf ihr Opfer zukroch. Eine schwache warme Brise trug den Geruch von Kohle und Diesel heran.
Dan schauderte und fragte sich, wie viele Milliarden Mikroben sich wohl einen Weg durch den Mundschutz und die Nasenstopfen bahnten und sich an seinem geschwächten Immunsystem vorbeizuschleichen versuchten, um sich in seinem Körper einzunisten.
»Dan, dafür habe ich wirklich keine Zeit«, schrie Freiberg gegen das Dröhnen eines riesigen Lastkraftwagens an, der auf Rädern, die beide Männer zu Zwergen degradierten, zwanzig Tonnen Schmutz und Geröll ins Tal transportierte.
»Ich muss nur ein paar Stunden deiner Zeit beanspruchen«, sagte Dan, der schon ganz heiser war von dem Geschrei. »Mein Gott, ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um dich nach deiner Meinung zu fragen.«
Es war ein Zeichen für die späte Erkenntnis der chinesischen Regierung, dass der Treibhauseffekt nicht nur dem Rest der Welt, sondern auch China schaden würde, dass sie Freiberg gebeten hatten, persönlich ihr gewaltiges Bau-Projekt zu leiten. An einem Ausgang des Tals errichteten chinesische Ingenieure und Arbeiter einen Damm, um das Kraftwerk vor dem anschwellenden Jangtse zu schützen. Am andern Ausgang baute eine Mannschaft von Yamagata Industries eine komplexe Pumpstation, um das Kohlendioxid abzusaugen, das von den Kraftwerksschornsteinen emittiert wurde, und es tief unter der Erde in den ausgebeuteten Flözen der Kohle-Lagerstätte zu speichern, die Brennstoff für die Generatoren geliefert hatte.
»Hör zu«, sagte Freiberg mit einem genervten Stirnrunzeln, »ich weiß, dass ich mein Gehalt noch immer von Astro bekomme, aber das heißt nicht, dass ich jedes Mal springe, wenn du pfeifst.«
Dan schaute ihm in die hellblauen Augen und erkannte dort Schmerz, Enttäuschung und nackte Angst. Zack gibt sich selbst die Schuld an dieser Katastrophe, sagte Dan sich. Er hat das Treibhaus-Kliff entdeckt und tut nun so, als sei das alles seine Schuld. Anstatt dass ein irrer König den Boten für das Überbringen der schlechten Nachricht ermordet, will der Bote sich selbst umbringen.
»Schau, Zack«, sagte er in aller Ruhe, die er aufzubringen vermochte, »du musst doch hin und wieder etwas essen, nicht wahr?«
Freiberg nickte ergeben. Mit solchen Schalmaientönen hatte Dan ihn in der Vergangenheit oft genug zu Dingen überredet, die er eigentlich gar nicht hatte tun wollen.
»Wenn du nicht zum Essen gehst, kommt das Essen eben zu dir«, sagte Dan und deutete auf das übergroße Wohnmobil, mit dem er gekommen war. Das Dach war mit glitzernden Solarzellen überzogen. »Wenn zur Mittagspause gepfiffen wird, komm rein und brich etwas Brot mit mir. Das ist alles, worum ich dich bitte.«
»Du willst, dass ich mir diesen Plan beim Essen anschaue? Du glaubst, ich wäre imstande, eine fachliche Entscheidung von solcher Tragweite innerhalb von einer Stunde oder noch weniger zu treffen?«
Dan zuckte entwaffnend die Achseln. »Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich bitte dich nur, einmal einen Blick darauf zu werfen.«
Freiberg schaute Dan mit dem Blick eines geprügelten Hunds an.
Trotzdem kletterte er fünf Minuten später ins Wohnmobil.
»Ich hätte es wissen müssen«, sagte er, als er an Big George vorbeiging, der den Türsteher mimte.
Das Fahrzeug war luxuriös ausgestattet. Eine attraktive junge Japanerin rührte stumm dampfendes Gemüse in einem Elektro-Wok um. Dan saß auf der kunstledernen Couchgarnitur, die sich um den ausklappbaren Esstisch zog. Er hatte sich eine Wildlederjacke um die Schulter gehängt, obwohl es nach Freibergs Dafürhalten fast zu warm im Fahrzeug war. Zack sah den Abdruck, den der Mundschutz auf Dans Gesicht hinterlassen hatte.
»Was zu trinken?«, fragte Dan, ohne jedoch aufzustehen. Ein halb leeres Glas mit einem moussierenden Getränk stand vor ihm auf dem Tisch.
»Was hast du denn anzubieten?«, fragte Freiberg und setzte sich auf den Eckplatz der Couch. Der Tisch war bereits für zwei Personen gedeckt.
»Ingwerbier«, sagte Dan. »George hat es mir schmackhaft gemacht. Es enthält keinen Alkohol und ist außerdem gut für die Verdauung.«
Freiberg hob die Schultern. »Gut, dann nehme ich das auch.«
George holte eine braune Flasche aus dem Kühlschrank, öffnete sie und schenkte Freiberg ein Glas ein.
»Passt gut zu Brandy, weißt du«, sagte er zu Freiberg, als er ihm das Glas reichte.
Der Wissenschaftler nahm ihm das Glas wortlos ab, und George bezog wieder Posten an der Tür, wobei er die Arme vor der massigen Brust verschränkte wie ein professioneller Rausschmeißer.
»Hättest was wissen müssen?«, fragte Dan, nachdem er von seinem Getränk genippt hatte.
Freiberg machte eine ausladende Geste. »Dass du selbst hier draußen in der Pampa ein Leben im Luxus führst.«
Dan lachte. »Wenn es einen schon in die Wildnis verschlägt, kann man es sich wenigstens etwas gemütlich machen.«
»Es ist aber ziemlich warm hier drin«, beanstandete Freiberg.
Dan lächelte ihn an. »Du bist das Leben in der Wildnis gewohnt, Zack. Ich nicht.«
»Ja, stimmt wohl.« Freiberg warf einen Blick auf das Gemälde über Dans Kopf: Ein kleines Mädchen stand unter einem Banyan-Baum. »Ist das echt?«
»Holoprint«, sagte Dan. »Ein Vickrey.«
»Schön.«
»Wo lebst du denn hier draußen?«
»In einem Zelt«, sagte Freiberg.
»Das habe ich mir gedacht«, sagte Dan mit einem Nicken.
»Es ist ein ziemlich gutes Zelt, was man von einem Zelt halt erwarten kann, aber es ist kein Vergleich damit.« Er ließ anerkennend den Blick über den Essbereich schweifen. »Wie viele Räume gibt es hier noch?«
»Nur noch zwei: ein Büro und ein Schlafzimmer. Natürlich mit einem Doppelbett.«
»Natürlich.«
»Du wirst gut darin schlafen – es ist deins.«
»Der Holoprint?«
»Das Wohnmobil. Das ganze Geraffel. Ich werde am späten Nachmittag abreisen. Wenn du jemanden auftreibst, der George und mich zum Flugplatz fährt, kannst du das Ding behalten.«
»Kannst du dir es überhaupt leisten, es herzugeben?«, platzte Freiberg heraus. Er war bass erstaunt. »Nach dem, was ich gehört habe …«
»Für dich, Zack«, fiel Dan ihm ins Wort, »gebe ich den letzten Penny. Wenn es sein muss.«
Freiberg schaute verschmitzt. »Du willst mich bestechen.«
»Ja. Wieso nicht?«
»In Ordnung«, sagte der Wissenschaftler mit einem entsagungsvollen Seufzer. »Zeig mir diesen Plan, den du erwähnt hast.«
»He, George«, rief Dan, »bring mir doch bitte mal das Notebook.«
Nach einer guten Stunde schaute Freiberg vom Notebook-Monitor auf und sagte: »Ich bin zwar kein Raketeningenieur und habe nur rudimentäre Kenntnisse über Fusionsreaktoren, aber ich vermag in diesem Konzept keinen offensichtlichen Fehler zu finden.«
»Glaubst du, dass es funktionieren würde?«, fragte Dan gespannt.
»Woher, zum Teufel, soll ich das wissen?«, blaffte Freiberg ihn an. »Wieso bist du den ganzen Weg hierher gekommen, um meine Meinung über etwas einzuholen, von dem du weißt, dass es außerhalb meines Fachgebiets liegt?«
Dan zögerte für einen Moment und sagte dann: »Weil ich dir vertraue, Zack. Dieser Humphries ist ein aalglatter Typ. Alle Experten, mit denen ich mich in Verbindung gesetzt habe, sagen zwar, dass diese Fusionsrakete fliegen würde, aber woher weiß ich denn, dass er sie nicht gekauft hat? Er hat irgendetwas in der Hinterhand, eine versteckte Agenda, und diese Idee mit der Fusionsrakete ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, er will sich Astro schnappen.«
»Das ist ein toller Metaphern-Mix«, sagte Freiberg mit einem widerstrebenden Grinsen.
»Stör dich nicht an der Semantik. Ich traue Humphries nicht. Aber ich traue dir.«
»Dan, meine Meinung zählt hier überhaupt nicht. Ebenso gut könntest du George oder die Köchin fragen.«
Dan beugte sich vor und sagte: »Du kennst die richtigen Leute, Zack. Du könntest die Experten kontaktieren, mit denen Humphries zu tun hatte, und ihnen auf den Zahn fühlen. Du könntest mit anderen Leuten sprechen, den wirklichen Spezialisten auf diesem Gebiet und ihre Meinung einholen. Sie würden mit dir sprechen, Zack, und sie würden sich auch verständlich ausdrücken. Du könntest …«
»Dan«, sagte Freiberg kühl, »ich versuche bereits, sechsunddreißig Stunden am Tag zu arbeiten.«
»Ich weiß«, sagte Dan. »Ich weiß.«
Freiberg hatte sich ganz der Anstrengung verschrieben, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, die weltweit von den mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken, Fabriken und Kraftfahrzeugen ausgestoßen wurden.
Angesichts der katastrophalen Klimaänderungen aufgrund des Treibhauseffekts versuchten die Nationen der Welt verspätet und widerstrebend das Ruder herumzureißen. Unter der Führung des Globalen Wirtschaftsrats versuchten die Hersteller auf der ganzen Welt verzweifelt, Automobile und andere Fahrzeuge auf Elektromotoren umzustellen. Dazu musste jedoch die globale Energieerzeugungs-Kapazität verdreifacht werden, und Kraftwerke auf der Basis fossiler Brennstoffe waren eben schneller und kostengünstiger zu bauen als Kernkraftwerke. Es gab immer noch beträchtliche Ölvorräte, und die Kohlevorräte waren noch einmal um ein Vielfaches größer. Kraftwerke auf der Basis der Kernspaltung kamen nicht infrage, weil die Öffentlichkeit Angst vor Kernenergie hatte. Und die Fusionsgeneratoren steckten noch in den Kinderschuhen und stießen ebenfalls auf den erbitterten Widerstand der Öffentlichkeit, für die alles ›Atomare‹ ein rotes Tuch war.
Also wurden immer mehr mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke gebaut, vor allem in den aufstrebenden Industrienationen wie China und Südafrika. Der GEC bestand darauf, dass neue Kraftwerke die Kohlendioxid-Emissionen abschieden, das gefährliche Treibhausgas sammelten und es in den Untergrund pumpten.
Zachary Freiberg hatte sein Leben der Aufgabe gewidmet, das Treibhaus-Desaster abzumildern. Er hatte sich als Chef-Wissenschaftler bei Astro Manufacturing auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen und reiste als Leiter großer Bauprojekte um die Welt. Seine Frau hatte ihn verlassen, die Kinder hatte er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen und sein Privatleben war ein Scherbenhaufen. Aber er verspürte eben den Drang, nach besten Kräften bei der Verlangsamung des Treibhauseffekts mitzuhelfen.
»Wie sieht’s aus?«, fragte Dan.
Freiberg schüttelte den Kopf.
»Es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gelingt uns einfach nicht, die Treibhaus-Emissionen signifikant zu reduzieren.«
»Aber ich dachte …«
»Wir reißen uns den Arsch auf … wie lange geht das schon so? Zehn Jahre. Alles für die Katz. Als wir anfingen, wurden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe jährlich sechs Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Luft geblasen. Weißt du, wie viel es heute ist?«
Dan schüttelte den Kopf.
»Fünf komma drei Milliarden Tonnen«, sagte Freiberg fast zornig.
Dan grunzte.
Freiberg zeigte durchs Fenster auf die vorbeirumpelnden riesigen Laster und knurrte: »Yamagata versucht, die ganze Flotte auf Elektrizität umzustellen, aber die Chinesen fahren noch immer mit Diesel. Manche Leute scheren sich einen Dreck darum! Die Russen sprechen schon davon, das so genannte ›jungfräuliche Land‹ in Sibirien zu kultivieren, wo der Permafrost schmilzt. Sie wollen die Region in eine neue Kornkammer wie die Ukraine verwandeln.«
»Dann hätte das Ganze vielleicht doch noch ein Gutes«, murmelte Dan.
»Das ist für den Arsch«, echauffierte Freiberg sich. »Die Weltmeere erwärmen sich immer noch, Dan. Wenn es uns nicht gelingt, den Temperaturanstieg zu stoppen und das im Permafrost eingelagerte Methan freigesetzt wird …«
Dan wollte zu einer Antwort ansetzen, doch Freiberg ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Weißt du eigentlich, wie viel Methan im Permafrost gebunden ist? Zweimal zehn hoch sechzehn Tonnen. Zwanzig Trilliarden Tonnen! Der dadurch bewirkte Temperaturanstieg würde das ganze Eis in Grönland und der Antarktis zum Schmelzen bringen. Überhaupt jeden Gletscher auf der Welt. Wir würden alle ersaufen.«
»Ein Grund mehr«, sagte Dan, »die Mission zum Asteroiden-Gürtel voranzutreiben. Wir könnten dort alle Metalle und Mineralien schürfen, die die Erde braucht, Zack! Wir könnten die industriellen Aktivitäten der Erde ins All auslagern, wo sie die Umwelt nicht schädigen.«
Freiberg schaute Dan ungläubig an.
»Wir können es schaffen!«, bekräftigte Dan. »Wenn diese Fusionsrakete funktioniert. Das ist der Schlüssel zu der ganzen verdammten Sache: Ein effizienter Antrieb vermag die Kosten des Asteroiden-Bergbaus auf ein Niveau zu drücken, wo er wirtschaftlich lebensfähig ist.«
Für eine Weile sagte Freiberg nichts. Er schaute Dan nur ärgerlich und verdrießlich zugleich an.
»Ich werde ein paar Anrufe für dich tätigen, Dan«, nuschelte er schließlich. »Mehr kann ich nicht tun.«
»Mehr kann ich auch nicht verlangen«, erwiderte Dan und rang sich ein Lächeln ab. »Und eine Fahrt zum Flugplatz für George und mich.«
Selene City
Der Zollinspektor machte zunächst große Augen, als er des Käfigs mit den vier lebenden Mäusen ansichtig wurde, die sich darin tummelten.
Dann schaute er mit einem grimmigen Ausdruck zu Pancho auf. »Haustiere sind in Selene verboten.«
Die anderen Astronauten hatten die Einreiseformalitäten problemlos erledigt und Pancho mit dem kritischen Zöllner allein gelassen. Der Flug zum Mond war ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, ohne dass Panchos Kameraden bemerkt hätten, dass sie ihre Bankkonten um die Zinserträge für eine halbe Stunde erleichtert hatte. Und selbst wenn sie diese kleine Gaunerei doch noch entdeckten, war der fragliche Betrag zu gering, um sich deswegen in die Haare zu kriegen, sagte Pancho sich. Es ging ihr nämlich weniger ums Geld als um die Raffinesse des Coups.
»Das sind keine Haustiere«, eröffnete sie dem Zöllner cool. »Das ist Frischfleisch.«
»Frischfleisch?« Die dunklen Augenbrauen des Manns wölbten sich fast bis zum Haaransatz.
»Genau, Frischfleisch. Für meinen Leibwächter.« Sie kannte die meisten Zollinspektoren, doch dieser Typ war neu; Pancho hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Sieht nicht schlecht aus, sagte sie sich. Der dunkelblaue Overall harmoniert schön mit den Augen. Aber schon etwas älter. Hat schon graue Schläfen. Muss aber genug verdienen, um sich eine Verjüngungstherapie leisten zu können.
Als ob er wüsste, dass er mit weiblicher List und Tücke auf Linie gebracht werden sollte, fragte der Zollinspektor: »Ihr Leibwächter isst Mäuse?«
Pancho nickte. »Jawohl, Sir, das tut er.«
»Und wo ist dieser Leibwächter?«, fragte der Inspektor unfreundlich.