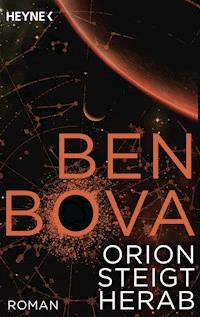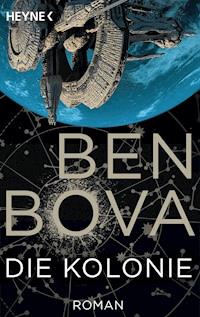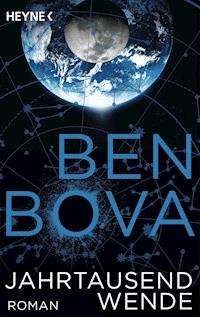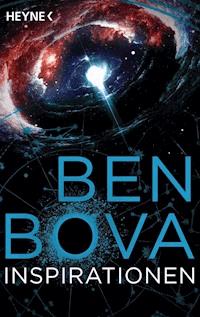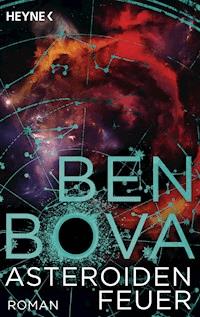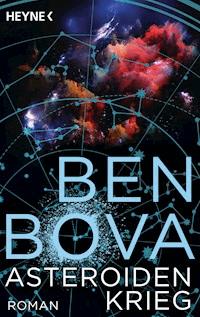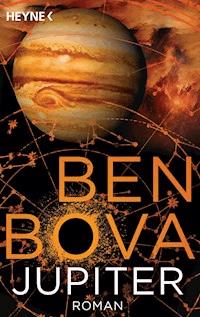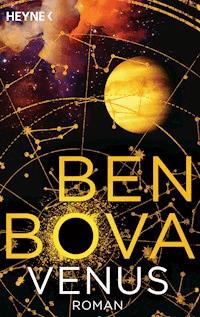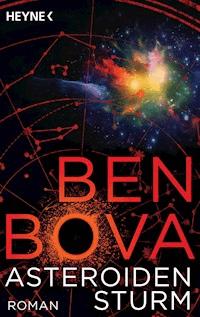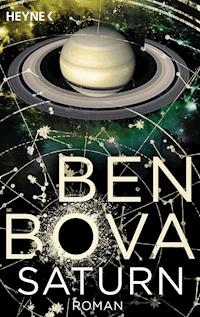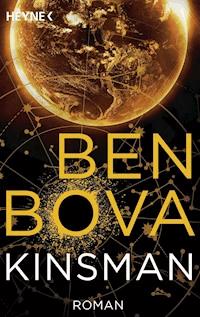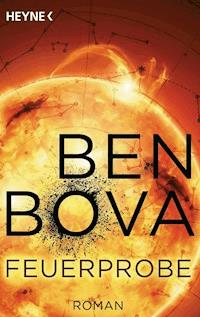
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Menschheit am Abgrund
Ein schwerer Sonnensturm versengt die Erde. Vom Ural westwärts wandernd, verbrennen die Strahlen Europa zu Asche, lässt Gletscher schmelzen und Flüsse verdampfen. Bevor die Sonne über Amerika aufgeht, ist der Sturm vorbei – doch die automatischen Verteidigungsanlagen der Sowjetunion haben den Sonnensturm als Angriff interpretiert und leiten einen Gegenschlag ein, der die Vereinigten Staaten vernichtet. Einzig die Mondbasis überlebt – doch sie ist abhängig von Rohstofflieferungen von der Erde. Douglas Morgan fliegt zur Erde, um die Lage zu sondieren und die Kolonisten zu retten – doch es ist nichts mehr so, wie es einmal war …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
BEN BOVA
FEUERPROBE
Roman
Das Buch
Ein schwerer Sonnensturm versengt die Erde. Vom Ural westwärts wandernd, verbrennen die Strahlen Europa zu Asche, lässt Gletscher schmelzen und Flüsse verdampfen. Bevor die Sonne über Amerika aufgeht, ist der Sturm vorbei – doch die automatischen Verteidigungsanlagen der Sowjetunion haben den Sonnensturm als Angriff interpretiert und leiten einen Gegenschlag ein, der die Vereinigten Staaten vernichtet. Einzig die Mondbasis überlebt – doch sie ist abhängig von Rohstofflieferungen von der Erde. Douglas Morgan fliegt zur Erde, um die Lage zu sondieren und die Kolonisten zu retten – doch es ist nichts mehr so, wie es einmal war …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
TEST OF FIRE
Aus dem Amerikanischen von Norbert Stresau
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1982 by Ben Bova
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Feuer stellt
die güldnen Dinge auf die Probe,
Für Jay Klein, Gentleman und Sänger.
Und für Frank und Bev Herbert,
Prolog
Es war eine prächtige mondlose Nacht. Eine leichte Sommerbrise strich durch den Wald und brachte die Bäume in der Dunkelheit zum Rauschen. Hoch oben auf dem Berggipfel, weitab vom Lärm und Licht der Städte, glitzerten Tausende von Sternen an einem Firmament, das so unermesslich wie wunderbar erschien.
Die Pfeife fest zwischen die Zähne geklemmt, lehnte sich Dr. Robert J. Lord an die Brüstung der Observatoriumskuppel. Im Schatten neben sich konnte er gerade noch die reizenden Gesichtszüge der Studentin erkennen.
»So wird Ihr Leben künftig aussehen«, sagte er in weichem, genau berechnetem Flüsterton. »Falls Sie sich entschließen, Ihren Abschluss in optischer Astronomie zu machen, werden Sie Nacht für Nacht hier oben sein und bis zum Morgengrauen arbeiten.«
Jenny Robertson versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie kalt ihr war. Man schrieb Mitte August, doch hier oben auf den Bergen waren die Nächte von New England beinahe winterlich. Ich werde ihn nicht merken lassen, dass ich friere, sagte sie sich. Körperliche Unannehmlichkeiten sind etwas, mit dem sich Astronomen abfinden müssen. Und davon abgesehen, ein Frösteln, und er wird sofort versuchen, seinen Arm um mich zu legen.
»Die ganze Nacht«, wiederholte Lord versonnen. »Das kann ziemlich einsam werden.«
Jenny kannte seinen Ruf. Für einen Mann um die Fünfzig befand sich Dr. Lord in recht guter Verfassung, dachte sie bei sich, obwohl ihr dieses Alter recht betagt vorkam. Jede Studentin seiner Abteilung kannte die Statistik: zweimal verheiratet, zweimal geschieden, und eine Eins bekam man von ihm auf dieselbe Art, wie es Hester Prynne gelungen war.
»Aber steuert nicht der Computer das Teleskop, sobald man erst einmal die Koordinaten für die Beobachtungen der betreffenden Nacht eingegeben hat?« Sie verschränkte die Arme und wünschte sich, dass sie einen dickeren Pullover angezogen hätte. »Ich meine, sie müssen doch nicht die ganze Nacht hier oben bleiben, oder?«
Lord nahm die Pfeife aus dem Mund und fummelte an ihr herum, während er sich im Geist um eine Antwort bemühte. Er wollte diese vorlaute Studentin mit ihren üppigen Rundungen mit seiner Hingabe an die Astronomie beeindrucken.
»Oh, sicher, Sie können sich die Arbeit vom Computer und den Bildverstärkern und den Kameras abnehmen lassen«, meinte er in einem unbeschwerten Tonfall, der schon etwas Herablassendes an sich hatte. »Aber manche von uns ziehen es vor, hier oben auf dem Posten zu bleiben und sicherzugehen, dass alles seinen rechten Gang läuft. In dieser Hinsicht bin ich etwas altmodisch, schätze ich.«
»Aber nein«, erwiderte sie rasch. »Ich denke, Sie sind sehr – na ja – engagiert.« Und im Stillen sagte sie sich, dass der Trick darin bestand, ihm eine gute Note abzuluchsen, ohne dass ihr seine Hände zu dicht auf den Leib rückten.
Bescheiden zuckte Lord die Achseln. »Sehen Sie, es gibt immer die Möglichkeit, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Ein Fehler in den Geräten, vielleicht. Oder am Himmel erscheint plötzlich irgendwas, und man möchte sich ohne Umschweife näher damit befassen.«
»Ist Ihnen schon einmal ein völlig unerwartetes Phänomen untergekommen?«, fragte Jenny. »Etwas, das noch nie jemand zuvor gesehen hat?«
»Äh, nein«, gab er zu. »Noch nicht, aber …«
Er unterbrach sich. Plötzlich fiel ihm auf, wie deutlich er ihr Gesicht sehen konnte. Er wandte sich um und betrachtete den östlichen Himmel. Er war milchweiß. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war hell genug, dass er die Zeiger ohne Mühe erkennen konnte.
»Zwei Uhr zwölf«, murmelte er. »Sonnenaufgang ist erst in fünf Stunden.«
Ein Schwall warmer Luft blies an ihnen vorbei. Jenny fühlte, wie sie sich entspannte, und ihre Gänsehaut verschwand. Doch Lord starrte nur mit offenem Mund auf den heller werdenden Himmel.
»Das kann nicht sein«, sagte er. »Das kann einfach nicht sein.«
Der Wind frischte heftig auf und wurde wärmer, beinahe so heiß wie zur Mittagszeit im Hochsommer. Der ausgedehnte Wald um den Berg seufzte und stöhnte im Wind. Der Himmel verwandelte sich zu geschmolzenem Kupfer, die Sterne verblassten. In den Bäumen unter ihnen fingen die Vögel an zu zwitschern. Und Lord starrte nach wie vor auf den leuchtenden Himmel.
»O mein Gott«, flüsterte er. »O mein Gott …«
In Rom war die Sonne bereits vor mehr als einer Stunde aufgegangen, und die Stadt wimmelte von lärmenden Autos und ihren ungeduldigen, leicht erregbaren Fahrern, die auf die Hupe drückten und sich aus dem Wagenfenster lehnten, um sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf zu werfen.
Ohne Vorwarnung wurde die Luft auf einmal unerträglich hell und heiß, als ob man überall riesige Flutlichter eingeschaltet hätte. Der Verkehr kam völlig zum Erliegen, die Menschen sahen furchtsam auf, die Fahrer befreiten sich aus ihren vollgepackten Autos, schwitzend und taumelnd, und doch wurde das Licht immer heller und heißer, unerträglich heiß, wie ein riesiges Bügeleisen, das sich glühend auf die Landschaft presste. Frauen schrien und fielen in Ohnmacht. Männer brachen auf den kochenden Asphaltstraßen zusammen. Während sich die Menschen schreiend ins Innere der Häuser flüchteten, fingen die Bäume auf den Bürgersteigen an zu schwelen. Markisen brachen in Flammen aus. Die Gärten des Vatikan erblühten in einem Feuersturm. Springbrunnen wurden zu Dampf. Unter dem brennenden Himmel verwandelte sich die gesamte Stadt in ein Meer aus Rauch und Feuer.
Ganz Italien, ganz Europa, Afrika, Asien brachen in Flammen aus. Wo immer das Sonnenlicht auftraf, erblühte Feuer und Tod. Zu Millionen, zu Hunderten von Millionen starben die Menschen auf der Stelle. Im äquatorialen Afrika loderten ganze Wälder auf, während die Tierwelt in Panik geriet und nach einer Zuflucht suchte, die es nicht gab. Auch die menschlichen Tiere wurden von Panik erfasst: die Pygmäenjäger tief in den brennenden Wäldern ebenso wie die nach westlicher Mode gekleideten Geschäftsleute in den modernen Städten, alle starben sie, entweder weil ihre Kleider Feuer fingen, als das Sonnenlicht sie berührte, oder weil sie in den Feuerstürmen erstickten, die über ganze Kontinente hinwegfegten, während sie sich vor der Sonne im Innern ihren weißglühenden Gebäude zu verstecken suchten.
Städte gerieten zu Öfen, Grasland wurde zu einem Flammenmeer. Während die Dämmerung über den kreisenden Planeten Erde weiter nach Westen zog, tötete ihr feuriger Finger alles auf seinem Weg. In der Schweiz schmolzen die Gletscher, und ihre Flut ergoss sich auf die brennenden, rauchenden Dörfer, die über die alpinen Wiesen verstreut lagen. Paris wurde zur Fackel, dann London. Nördlich des Polarkreises brachen Lappen in ihren Sommerpelzen in Flammen aus, während ihre Rentiere zusammenbrachen und auf der rauchenden Tundra schmorten.
Das Morgengrauen raste westwärts über den Atlantik, doch nun ließ seine Helligkeit langsam nach. Die Sonne verblasste so rasch, wie sie aufgeflackert war. Die Fackel war vorüber. Sie hatte weniger als eine Stunde gedauert, und gemessen am brodelnden Energiekessel der Sonne war sie wenig mehr als eine kleinere Unregelmäßigkeit gewesen. Und doch hatte sie die Hälfte des Planeten Erde in einen Scheiterhaufen verwandelt. Rauch bedeckte Asien von Tokio bis zum Ural, ganz Europa und Afrika und Australien.
Die beiden amerikanischen Kontinente entkamen dem Zorn der Sonne. Beinahe.
Tief im Inneren der Erde, unter dem massiven Granit der Uralberge, starrte Wassilij Brudnoj voller Entsetzen auf seinen Kommunikationsschirm.
Es war der größte Schirm im gesamten Raketenzentrum, beinahe fünfzehn Meter breit. Er zeigte die gesamte Sowjetunion: weiße Lichter für alle größeren Städte, rote Lichter für die militärischen Zentren, Trauben aus Orange für die Raketensilos mit ihren ICBMs.
Wassilij, nach zehn Jahren Dienst in der Roten Armee zum Captain befördert, spürte General Kubatschews entsetztes Keuchen in seinem Nacken.
»Versuchen Sie's noch mal mit Moskau«, befahl der General.
Wassilij drückte die entsprechenden Knöpfe auf seiner Konsole. Dann presste er seine freie Hand gegen den Kopfhörer an der linken Schädelseite und lehnte sich gespannt nach vorn, als ob er Moskau allein mit der Kraft seines Willens zu einer Antwort bewegen könnte.
Nichts. Nur das Rauschen der Trägerwelle.
»Sie antworten nicht, General.«
General Kubatschew hob eine türkische Zigarette an die Lippen. »Leningrad«, knurrte er. Und als Wassilij ihm erneut mitteilte, dass er keine Antwort empfing, stieß der General eine Wolke grauen Rauches aus. »Rostov. Gorki. Irgendjemand muss doch antworten.«
Wassilij versuchte es. Vergeblich. Er hielt die Augen auf den Schirm gerichtet, die Männer und Frauen hinter seinem Rücken wollte er nicht sehen. Und doch konnte er den Phantombildern ihrer Reflektionen auf dem Glas des Schirms nicht entrinnen. Sie sehen schon jetzt wie Gespenster aus, dachte er. Er hörte ihr Flüstern, ihr ängstliches Murmeln, fühlte die kalte, klamme Furcht, die das unterirdische Befehlszentrum gepackt hatte.
»Vorkuta antwortet auch nicht?«, fragte der General mit rauer Stimme, beinahe flehentlich.
»Nein, Sir.«
»Bratsk?«
»Nein.«
Wassilij hörte eine Frau schluchzen. General Kubatschew legte eine müde Hand auf die Schulter des Captains. »Es ist keiner mehr übrig«, sagte er bebend. »Nun liegt es an uns. Senden Sie den Angriffsbefehl. Senden Sie so lange, bis die letzte Rakete abgefeuert ist. Bis zur allerletzten.«
»Meine Mutter«, sagte jemand benommen. »Sie lebte in Rostov.«
Lebte. Schon jetzt dachten sie in der Vergangenheit. Wassilij Petrowitsch Brudnoj klappte die Schutzhülle über dem roten Knopf nach oben, die Zähne so fest zusammengepresst, dass er den Schmerz in seinem Kinn fühlte. Er legte seinen Daumen auf den roten Knopf und sah zum Schirm auf. Wenn die Amerikaner unsere Silos ausgeschaltet haben, sagte er zu sich, haben wir alles verloren. Doch fast im selben Moment schalteten die Trauben aus orangefarbenem Licht auf Grün.
Hinter ihm grunzte General Kubatschew: »Wenigstens funktionieren die automatischen Kontrollen noch. Nicht mal ein direkter Treffer kann sie ausschalten, so tief haben wir sie begraben.« Wassilij roch, schmeckte beinahe, den letzten Zug des General an seiner Zigarette. »Na gut, das ist also das Ende. Wenigstens werden die amerikanischen Hundesöhne nicht lange genug leben, um sich über ihren Sieg zu freuen.«
Auch auf dem Mond existierte menschliches Leben, wenn auch in einer recht prekären Lage, begraben unter dem schützenden Felsen des riesigen Kraters Alphonsus. Der luft- und beinahe wasserlose Mond war ein rauer Aufenthaltsort für die Hunderte von Ingenieuren und Techniker, die dort lebten und arbeiteten.
Tief unter dem 130 Kilometer durchmessenden Krater saß auch Douglas Morgan vor einer Konsole und betrachtete einen Fernsehschirm. Auf dem Schirm sah er drei Menschen in nüchtern weißen Hartanzügen, die oben auf der Oberfläche ihrer Arbeit nachgingen. Die Instrumente, die den Schirm auf beiden Seiten flankierten, gaben ihm sämtliche Details über seine drei Schützlinge: ihren Herzschlag, die Atemfrequenz, die Körpertemperatur, den Blutdruck, weitere Informationen. Andere Digitalanzeigen teilten ihm die Temperatur der sonnenverbrannten Mondfelsen mit, die Strahlungswerte auf der Oberfläche, die Anzahl der Tage bis zum Sonnenuntergang.
Morgan war ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern und einem massiven Brustkorb, starken, muskulösen Armen und einem sandfarbenen Haarschopf, den er ständig aus seinen blauen Augen streichen musste. Es ärgerte ihn, dass er sich mit einer reinen Überwachungstätigkeit abfinden musste. Er war glücklicher an der Oberfläche, draußen im Freien, selbst wenn er sich dafür in einen klobigen Hartanzug einschließen lassen musste.
Ganz plötzlich hellte sich der Schirm auf und die unerwartete Lichtzunahme machte ihn blinzeln. Automatisch griff er nach dem Helligkeitsregler, doch im selben Moment ertönten drei verschiedene Alarmsirenen. Seine dicken Finger erstarrten mitten in der Luft.
»Lisa, Fred, Martin … in die Luftschleuse!«, brüllte er in das Konsolenmikro. »Sofort! Bewegt euch!«
Die drei Gestalten auf dem Schirm zögerten und sahen auf, als ob ihnen jemand auf die Schulter geklopft hätte. Hinter der schwerverspiegelten Rundung des Visiers konnte man ihre Gesichter nicht erkennen. Niemand wusste, ob ein Ausdruck der Überraschung, des Ärgers oder des Entsetzens über ihre Züge huschte.
Doch Douglas Morgan kümmerte sich nicht mehr um den Schirm. Mit einem Hieb auf den Alarmauslöser schoss er aus seinem Sessel hoch und raste aus dem Beobachtungsraum zum Turbolift, der nach oben zur Luftschleuse führte.
Die drei Gestalten auf dem Schirm wurden heller, als sich das plötzlich intensiv gewordene Sonnenlicht mit wilder Heftigkeit in ihren Hartanzügen spiegelte. Misstönende Sirenen heulten durch die unterirdische Siedlung und versetzten jedermann in Panik, während Douglas Morgan in langen Niederschwerkraft-Sprüngen durch die Korridore zur Luftschleuse eilte.
Als er schließlich bei der Luftschleuse angekommen war und einen Notdruckanzug angelegt hatte, taumelten zwei der Gestalten im Hartanzug bereits durch die innere Schleusenluke. Er konnte nicht erkennen, um wen es sich dabei handelte.
»Lisa?«, rief er den Namen seiner Frau. »Lisa?«
»Ich bin hier, Doug.« Die Stimme in seinem Helmkopfhörer klang erschrocken. Aber sie war sicher, im Innern, am Leben, geschützt vor der heftigen Strahlung der aufflammenden Sonne.
»Fred ist immer noch draußen«, sagte Martin Kobol, die zweite der Gestalten im Hartanzug. »Ich habe gesehen, wie er umgekippt ist, als wir auf die Luftschleuse zugerannt sind.«
Als Lisa ihr Visier nach oben schob, kam das feingeschnittene Gesicht einer Aristokratin zum Vorschein. Ihre Augen waren vor Entsetzen geweitet.
»Wir müssen ihn da rausholen!«, meinte sie mit leiser, eindringlicher Stimme. »Doug … tu etwas!«
Aber Douglas starrte lediglich auf das Dosimeter im Brustteil ihres Anzugs. Es war vollständig schwarz. Er drehte sich zu Martin Kobol um und sah, dass auch dessen Marke schwarz geworden war.
»Es ist zu spät.« Als ihm klar wurde, was er sagte, fing er innerlich an zu zittern. »Du hast es selber gerade noch geschafft. Inzwischen ist er tot.«
»Nein!«, brauste sie auf. »Hol ihn rein! Rette ihn!« Sie machte Anstalten, das Visier wieder herunterzuklappen. Douglas packte sie, doch sie wand sich los. Es bedurfte zweier Männer, um sie von der Schleusenluke fernzuhalten.
»Das hat doch keinen Sinn, Lisa!«, schrie Douglas seine Frau an. »Die Strahlung! Er ist längst gebraten.«
»Nein! Lass mich los! Lass mich raus zu ihm!«
Kapitel 1
Ein Mensch starb auf dem Mond, als die Sonne ihre Superfackel ausstieß. Auf der Erde starben Milliarden. Die Sonne kehrte zum Normalzustand zurück und schien nun wieder gleichmäßig und friedlich, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen wäre. Sie hatte solche Fackeln schon des Öfteren ausgesandt, in der fernen Vergangenheit, bevor die menschliche Zivilisation die Erde mit Dörfern und Farmen und Städten bedeckt hatte. In hunderttausend Jahren oder so würde sie wieder eine solche Fackel aussenden.
Die gesamte Alte Welt war ein versengtes Ruinenfeld, verbrannt zu schwelender, schwarzer Ödnis. Von Island bis zur östlichen Spitze von Sibirien existierte nichts mehr außer stummer, rauchender Zerstörung. All die stolzen Stätten menschlicher Geschichte waren Scheiterhaufen, übersät mit Toten. Der Eiffelturm hielt Wacht über ein verkohltes Paris. Die Klippe der Akropolis sah auf ein versengtes Athen herab; der Gestank verwesender Leichen erhob sich über den zerschmetterten Überresten des Parthenon, der in der unerträglichen Hitze der Fackel schließlich zusammengebrochen war.
Moskau, Delhi, Peking und Sydney existierten nicht mehr. Über fünfzehnhundert Kilometer hinweg war die asiatische Tundra schwarz geworden, und die einzigen Tiere, die überlebt hatten, waren jene, die sich tief genug unter der Erde vergraben hatten, um der Hitze und den Feuerstürmen zu entrinnen, die der Fackel gefolgt waren.
In Afrika herrschte die Stille eines riesigen Friedhofs. Menschen, Elefanten, Wälder, Insekten und der Busch waren nichts weiter als spröde, verkohlte Leichen, die in der sanften Sommerbrise langsam zu Staub zerfielen. Die antiken Pyramiden hatten die glühende Fackel unbeschadet überstanden, doch die Wüste hinter ihnen hatte sich in Hunderte von Kilometern glitzernden Glases verwandelt.
Die amerikanischen Kontinente waren dem vorübergehenden Ausbruch der Sonne entkommen, nicht aber dem Zorn entsetzter Menschen. Raketen mit Atomsprengköpfen schlugen auf Nordamerika ein. Fast alle Großstädte waren von einer pilzförmigen Wolke ausgelöscht worden, und radioaktiver Fallout bedeckte den Kontinent von Ozean zu Ozean, von den gefrorenen Tundramooren Kanadas bis zu den Dschungeln von Yukatan. Alaska erhielt seinen Anteil atomarer Vernichtung; selbst Hawaii wurde bombardiert und mit tödlicher Strahlung übersprüht.
Lateinamerika überlebte beinahe unversehrt, war jedoch vom Rest der Welt durch die Meere und die radioaktive Wüste abgeschnitten, die den Zug nach Norden blockierte. Bald fingen die großen Städte wie Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima an, zu zerfallen, als ihre Bevölkerung langsam zum Ackerbau zurückkehrte, der ihnen wenigstens das Lebensnotwendige garantierte – einigen von ihnen. Selbst im glücklichen Süden, der noch nicht in das weltweite Handelsnetz eingespannt gewesen war, starben die Städte. Die althergebrachte Lebensart bestätigte sich aufs neue: Ohne mühseliges Tagwerk mit handgefertigten Werkzeugen war es unmöglich, soviel Nahrung anzubauen, dass es zum Überleben reichte. Das Furnier der Zivilisation zerbrach und blätterte rasch ab.
Die wenigen hundert Männer und Frauen auf dem Mond sahen mit wachsendem Entsetzen zu, wie ihre Mutterwelt starb. Sie selbst waren sicher im Untergrund, geschützt selbst vom normalen Schein der mächtigen Sonne. In ihren Teleskopen verfolgten sie, wie die Alte Welt unter kontinentgroßen Wolken aus Rauch und Dampf verschwand. Aus den Funkgeräten hörten sie die Schreie der Sterbenden. Dann kamen die stecknadelgroßen Lichtblitze, die den atomaren Tod der nordamerikanischen Städte markierten.
Sie sahen, sie hörten, schweigend. Wie betäubt. Und dann verwandelte sich das Entsetzen in ein Schuldgefühl. Jedermann auf der Erde starb. Die menschliche Rasse wurde von der Oberfläche ihrer Mutterwelt gefegt. Aber sie befanden sich hier oben auf dem Mond, im Innern seiner schützenden Felshülle. Sie waren in Sicherheit. Sie blieben am Leben, während ihre Mütter, Brüder, Freunde und Geliebte starben.
Nach drei Tagen tauben Entsetzens und wachsender Schuldgefühle sahen sie einander an und fingen an nachzudenken. Wie lange werden wir selbst am Leben bleiben, ohne eine Erde, die uns mit Lebensmitteln, Geräten und Arzneimitteln versorgt?
Das Schuldgefühl war da, im Geist jedes einzelnen. Der Schrecken war zu groß, als dass er sich in Worte fassen ließ; niemand vermochte seinen wahren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Die Nächte waren angefüllt mit den Schreien derer, die von Albträumen heimgesucht wurden. Doch über allem stand der Überlebenstrieb. Tief im Innern jedes einzelnen lauerte das brennende Geheimnis: Ich bin am Leben und froh darüber. Egal, was mit all den anderen passiert ist. Ich bin froh, dass es nicht mich erwischt hat.
Nicht alle in der Mondsiedlung wurden mit dem Geheimnis fertig. Manche zogen sich in die Katatonie zurück. Eine Handvoll beging Selbstmord. Andere begingen Selbstmordversuche, aber auf eine Art, die sehr rasch die Aufmerksamkeit ihrer Freunde auf sich zog. Und nachdem man ihren Versuch der Selbstzerstörung vereitelt hatte und die Psychologen sie davon überzeugt hatten, dass es keinen Grund gab, ihre Sünden auf diese Weise abzubüßen, kehrten sie in die Reihen der Gesunden zurück. Zwei von ihnen versuchten, die Lebenserhaltungssysteme der Untergrundsiedlung zu sabotieren und sich selbst und alle anderen damit umzubringen. Beide konnten rechtzeitig aufgehalten werden. Beide starben im Krankenhausbett: Einer erhielt eine Überdosis Arzneimittel, der andere erlitt einen unerwarteten Herzanfall. Der Arzt, der sich um die beiden Patienten kümmerte, zuckte nur die Achseln, und am nächsten Morgen fand man seine Leiche: Er hatte eine Überdosis Barbiturat geschluckt.
Douglas Morgan saß auf der Kante des Krankenhausbetts und starrte auf das schlafende Gesicht seiner Frau. Das Krankenhaus der Mondsiedlung umfasste lediglich sechs Betten und zwei OPs, die man in den massiven Basalt der Mondkruste gemeißelt hatte. Das größte medizinische Problem, dem sich die vier Ärzte der Siedlung vor der Sonnenfackel stellen mussten, waren gebrochene Knochen von Bergarbeitern und einige Depressionen unter jenen gewesen, die ihre Schwierigkeiten damit hatten, sich an ein Leben unter der Oberfläche anzupassen.
Nun standen die Betten leer, ausgenommen das von Lisa. Der Erzabbau war eingestellt worden. Die Depressionen, die jedermann heimsuchten, behandelte man ohne Einweisung ins Krankenhaus. Der letzte Patient, der eines der Betten belegt hatte, war der Saboteur gewesen, der an einem Herzanfall gestorben war.
Lisas empfindsames Gesicht war bleich und abgespannt. Mit geschlossenen Augen wirkte es beinahe wie eine Totenmaske. Doch wenn der Tod so wunderschön war, dachte Douglas, sollte man ihn eigentlich nicht fürchten. Kurzes dunkles Haar umrahmte ihr feingeschnittenes Gesicht und wirkte im Kontrast zu den weißen Kissen und Bezügen des Krankenhausbetts noch attraktiver.
Douglas sah hinab und bemerkte, dass seine linke Hand, mit der er sich auf dem Bett abstützte, direkt neben Lisas rechter Hand lag. Der Gegensatz zwischen den beiden faszinierte ihn. Neben seiner schweren Tatze mit den dicken Fingern wirkte ihre Hand so winzig, so zierlich, beinahe zerbrechlich. Die seine war geschaffen, um Felsen aus den Mondhöhlen zu hauen, um Gleichungen in einen Computer einzuhacken, um anderen Menschen den richtigen Weg zu weisen. Aber er kannte auch die Kraft, zu der ihre Porzellanhände imstande waren; selbst durch den dicken Druckanzug hatte er den Griff dieser Finger gespürt.
Mit einem zögernden Seufzen stieß er sich vom Bett ab und reckte sich die angespannten Nackenmuskeln. Sehnen traten hervor, als seine Finger an der Decke kratzten.
Lisa schlug die Augen auf. Sie sah ihm direkt ins Gesicht, und ihre dunklen, brennenden Augen verrieten den feinen Schnitt ihrer Gesichtszüge. Sie war stark. Trotz der scheinbaren Zerbrechlichkeit ihres Körpers war sie so stark wie eine dünne Klinge Stahl.
»Du bist wach«, sagte Douglas und kam sich im selben Moment albern vor.
»Du verlässt uns«, hielt sie ihm entgegen.
»Ja.« Er warf einen Blick auf seine Uhr. »Das Schiff fliegt in zwei Stunden. Ich muss mein Zeug zusammenpacken und …«
»Warum du?«
Die Frage überraschte ihn. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass man ihn nicht zum Anführer der Mission machen würde.
»Weshalb überhaupt diese Expedition?«, fuhr Lisa fort. »Das ist doch alles Unsinn. Keiner von euch wird lebend zurückkehren.«
»Ich glaube nicht, dass das den Tatsachen entspricht«, sagte er.
Lisas Augen wanderten ziellos durch die triste kleine Kammer, die Felswände, die mit einem Laser abgeschliffen und anschließend pastellgrün gestrichen worden waren, die fünf leeren Betten um sie herum, weiß und hart gestärkt. Schließlich betrachtete sie wieder ihren Ehemann.
»Es ist eine Dummheit«, sagte sie. »Männliche Dummheit. Du versuchst nur zu beweisen, wie tapfer du bist.«
Er lächelte beinahe. Die schrecklichen Ereignisse der letzten Tage hatten Lisas Feuer nicht ausgelöscht.
Er setzte sich wieder auf den Rand des Bettes und bemühte sich um eine vorsichtige Antwort. »Wir sind eine Gesellschaft von fünfhundertdreiundsiebzig Männern und Frauen. Die meisten von uns sind Bergwerksingenieure und Techniker. Wir haben drei Ärzte, fünf Psychologen …«
»Vier Ärzte«, verbesserte ihn Lisa.
»Drei. Haley hat letzte Nacht eine Überdosis geschluckt.«
Sie nahm die Nachricht ohne erkennbare Reaktion auf.
»Wie die Dinge momentan aussehen«, nahm Douglas den Faden wieder auf, »können wir auf uns allein gestellt nicht überleben. Und von der Erde wird keine Hilfe mehr kommen – es sei denn, wir fliegen hin und holen uns, was wir brauchen.«
»Wenn du zur Erde fliegst, wirst du umkommen.«
»Vielleicht«, gab er mit einem Achselzucken zu. »Vielleicht hast du recht, vielleicht versuchen wir nur alle unbewusst, uns in einer letzten großen Geste selber umzubringen, anstatt hier oben in diesem unterirdischen Grab herumzusitzen.«
Lisa seufzte, eine Mischung aus Müdigkeit und Ungeduld. »Du bist immer so logisch. Die Erde ist zerstört, Milliarden Menschen sind gestorben, und du bist so kühl und logisch wie einer deiner Computer.«
»Wir sind nicht tot. Jedenfalls noch nicht.« Seine Stimme klang verbissen. »Und ich will am Leben bleiben. Ich will, dass du am Leben bleibst, Lisa. Deshalb muss ich diese Mission zur Erde anführen. Wir fliegen nur bis zur Raumstation. Wir werden nicht auf der Oberfläche landen, es sei denn …«
»Ich will nicht, dass du dich umbringst«, sagte Lisa. Ihre Stimme klang ausdruckslos.
»Warum nicht?«
»Weil wir dich hier brauchen. Weil ich dich hier brauche. Du bist ein geborener Anführer. Ich brauche dich hier, um diese Siedlung beisammenzuhalten.«
Er dachte einige Augenblicke lang nach, bevor er ihr leise antwortete. »Was du damit sagen willst, ist, dass du mich hier brauchst, um durch mich die Siedlung zu leiten.«
Ihr Blick hielt dem seinen stand, aber sie gab ihm keine Antwort. Das Schweigen zwischen ihnen dehnte sich schmerzhaft aus.
Schließlich sagte Douglas: »Das ist mir egal, Lisa. Du willst die Macht. Ich nicht.«
»Du bist ein Narr«, sagte sie ohne ein Lächeln.
»Ja, das weiß ich.« Langsam stand er wieder auf und sah auf sie herab. »Das Baby … es war von Fred, nicht von mir, oder?«
Ein kaum wahrnehmbarer Ausdruck der Überraschung huschte über ihr Gesicht. »Was für einen Unterschied macht das jetzt noch?«, sagte sie dann. »Fred ist tot, und ich habe das Baby verloren.«
»Für mich macht es einen gewaltigen Unterschied.«
Sie wandte sich von ihm ab.
Plötzlich schoss seine Hand nach vorn, packte ihr schmales Kinn und drehte ihren Kopf herum, dass sie ihn ansehen musste.
»Warum?«, verlangte er. »Warum hast du es getan? Ich liebe dich.«
Sie starrte ihn mit funkelnden Augen an, bis er seinen Griff löste. »Geh zur Erde und bring dich um!«, sagte sie dann. »Genau, wie du ihn umgebracht hast. Genau, wie du mein Baby umgebracht hast. Du hast den Tod verdient!«
Kapitel 2
»Wir schaffen es«, sagte Martin Kobol. Sein langes Gesicht wirkte ernst. »Wir können überleben – meiner Meinung nach.«
Sechs von ihnen hatten sich in das enge Schlafzimmer gezwängt. Wie der Rest der Siedlung hatte man es aus dem Mondfelsen geschnitten; ursprünglich war es als Standardunterkunft für einen Bergwerkstechniker oder Wissenschaftler entworfen worden. Die Möbel bestanden aus einem einzelnen Bett, einer integrierten Wandeinheit mit Schrank, Schreibtisch, Büroschubladen und Bücherregal, und demselben Typ von Nasszelle und Toilette, die man für die Raumstation entwickelt hatte.
William Demain teilte den Raum mit seiner Frau Catherine. Nun benutzten die Demains, Kobol und drei andere Männer ihn als Treffpunkt. Die Demains und einer der Männer saßen auf dem schmalen Bett. Kobol hatte den einzigen Stuhl des Raums ergattert, die anderen beiden Männer hatten sich auf dem dünnen Teppich niedergelassen.
»Jeder von uns ist für eine Schlüsselsektion der Siedlung verantwortlich«, sagte Kobol und wies nacheinander auf alle Anwesenden. »Hydroponik, Funk, Lebenserhaltung, Krankenstation, Bergbau.« Er tippte mit dem Daumen auf seine eigene schmale Brust. »Stromversorgung«, fügte er hinzu.
»Du hast die Verwaltung vergessen.«
Überrascht wandten sie sich zu der Falttür um, die in den Korridor hinausführte. Da stand Lisa, die Hand so heftig um die Türeinfassung geklammert, als würde sie zusammenbrechen, wenn sie sich nicht irgendwo festhalten konnte. Ihr Gesicht war weiß. Sie trug einen tiefschwarzen Overall, der nicht erkennen ließ, wie schwach und zerbrechlich sie geworden war.
»Du solltest noch in der Krankenstation sein!« Mit einem Satz stand Kobol an ihrer Seite. Catherine Demain schob sich aus dem Bett hoch und ging ebenfalls zu Lisa. Gemeinsam schafften sie sie zum Stuhl.
»Ich bin in Ordnung«, protestierte Lisa. »Einfach noch ein wenig schwach nach all der Zeit im Bett.«
»Du bist von der Krankenstation bis hierher gelaufen?«, fragte Catherine Demain. »Das ist genug Bewegung für einen Tag«, sagte sie auf Lisas Nicken hin. »Du brauchst noch eine Menge Erholung.«
Kobol betrachtete sie mit seltsamem Grinsen. »Woher wusstest du, dass wir uns hier treffen? Ich meine, wir haben es nicht gerade überall verkündet …«
Ihre dunklen Augen richteten sich auf sein langes, trauriges Gesicht. »Der Tag, an dem ihr euch auf diese Weise treffen könnt, ohne dass ich etwas davon erfahre, wird der Tag sein, an dem ich mein Amt als Verwaltungschefin niederlege.«
»Es freut uns, dass du wieder auf den Beinen bist«, meinte LaStrande, der andere Mann auf dem Bett, mit ernster Stimme.
Der Rest pflichtete ihm murmelnd bei.
»Danke«, sagte Lisa. »Martin, deine Behauptung von eben stimmt nicht ganz. Die Verantwortung für die Stromversorgung liegt nicht bei dir, sondern bei Douglas.«
Kobol nickte unglücklich. »Das stimmt … wenn Douglas hier ist.« Seine Stimme klang näselnd und hatte einen Hang zum Schrillen, wenn er sich über etwas erregte. »Aber es ist schon zwei Wochen her, seit er zur Erde geflogen ist. Seit drei Tagen haben wir keinen Lagebericht mehr von ihnen empfangen.«
»Er kommt schon wieder«, sagte Lisa.
»Natürlich. Und wenn er wieder da ist, geht die Verantwortung für die Stromversorgung wieder an ihn. Aber bis er zurückkommt, liegt sie bei mir.«
Lisa lächelte ihn an. »Natürlich.«
Kobol war groß, fast so groß wie Douglas, aber knochendürr. Sieht wie ein Gerippe aus, dachte Lisa, wie eine dieser Mumien, die die Archäologen in Ägypten ausbuddeln. Für einen kurzen Augenblick durchzuckte sie ein heißes Gefühl der Reue, als ihr klar wurde, dass die Tempel, die Museen, die archäologischen Ausgrabungsstätten, die Menschen in Ägypten und England und auch sonst überall verschwunden waren, tot, verbrannt, geschmolzen im Zorn der Sonne und den noch heißeren Feuerbällen menschlicher Vergeltung.
Gewaltsam verdrängte sie den Gedanken, wie sie auch den Schmerz verdrängte, der durch ihren Unterleib fuhr. Stattdessen konzentrierte sie sich auf die anderen Menschen im Raum, die selbsternannten Anführer der isolierten kleinen Kolonie.
Demain saß auf dem Bett, den Rücken gegen die Steinwand gepresst, die Beine wie ein Embryo an die Brust gezogen. Sein aufragender, kahler Schädel verlieh ihm das Aussehen eines Säuglings, doch seine Augen hatten etwas Verschlagenes. Die Augen eines Bauern, eines Farmers. Und genau das ist er auch, dachte Lisa, auch wenn seine Farmen aus komplizierten hydroponischen Anlagen bestanden und mit Hilfe von Chemikalien, Strom und Sonnenlicht betrieben wurde, das von der Oberfläche über Glasfaserkabel nach unten gelenkt wurde.
Seine Frau hatte die Aufsicht über die Krankenstation. Trotz ihres weißen Haars war sie von strahlender Schönheit, die Haut ohne Falten, ihr Leben der Sorge um andere verschrieben, hatte Catherine eine brillante medizinische Karriere auf der Erde aufgegeben, um zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Mond zu sein.
LaStrande war ein kleiner Gnom von Mann, schon jetzt halb blind trotz Versuchen der Laserchirurgie an seinen nachlassenden Augen. Was seine Persönlichkeit betraf, war er jedoch ein regelrechtes Kraftwerk: streitbar und doch niemals beleidigend, ein Genie, was die Wartung des entscheidenden Lebenserhaltungssystems der Kolonie betraf, das er mit einem Minimum an Personal und Material sogar noch weiter ausgebaut hatte.
Blair starb an Krebs. Alle wussten es, obwohl sein rosafarbenes Gesicht recht gesund aussah und er seiner Arbeit in der Funkzentrale mit einer nie versagenden, guten Laune nachging. Marrett war ein stämmiger, lautstarker Rohdiamant, der eine Karriere als Meteorologe aufgegeben hatte, um seine letzten Tage auf dem Mond zu verbringen, wo er irgendwie zum Anführer der hartgesottenen Bergleute geworden war. Er war ruhelos und talentiert, der geborene Anführer.
Und Kobol. Sie sah zu ihm auf, wie er dort neben ihren Sessel stand, automatisch die Leitung des Treffens an sich gerissen hatte und nun nach der Macht über sie alle greifen wollte, als sei er ein eifriger kleiner Junge, der nach einem Glas voll Plätzchen griff.
Was würden sie wohl alle denken, fragte sich Lisa, wenn sie wüssten, dass Kobol der Vater des Babys gewesen war, das ich verloren habe, und nicht Fred Simpson? Was würde Douglas tun, wenn ich es ihm je gestehen würde? Einen Moment lang schloss sie die Augen. Catherine Demain bemerkte es und dachte bei sich, dass Lisa vermutlich Schmerzen hatte. Doch Lisa klammerte sich nur an die Wut, die sie Douglas gegenüber empfand, ihrem Ehemann, jenem Mann, den sie vor fünf Jahren auserwählt hatte, um ihn zu einem Anführer umzuformen, einem Riesen, einem Kommandanten, der diese armselige kleine Siedlung auf dem Mond übernehmen und sie als Basis für die politische Macht auf Erden benutzen würde.
Sie schüttelte den Kopf und versuchte, die Gedanken aus ihrem Geist zu verdrängen. Die Erde war nicht mehr. Nichts war mehr geblieben. Nicht, dass Douglas ihrem Vorbild gefolgt wäre; er hatte sich als viel zu stur und egoistisch erwiesen, um von einem anderen beeinflusst zu werden. Was für einen Fehler ich da gemacht habe, sagte sich Lisa: Zu glauben, dass ich diesen anmaßenden, schlichten Ochsen in einen Weltführer umwandeln hätte können.
Dann wurde ihr klar, dass er ebenfalls verschwunden war. Er würde nie zurückkehren. Wahrscheinlich war er jetzt schon tot. Seltsamerweise bedrückte sie der Gedanke.
»… und wenn wir den hydroponischen Output um fünfzehn Prozent steigern können«, näselte Kobol gerade mit seiner dünnen Stimme, »sollten wir dazu in der Lage sein, ohne weiteren Lebensmittelimport von der Erde auf unbegrenzte Zeit zu überleben.«
Falls die Bevölkerung nicht zunimmt, dachte Lisa.
Demain bewegte den Kopf über den angezogenen Knien hin und her. »Das schaffe ich«, seine leise Stimme war beinahe unhörbar, »falls ihr mir mehr Platz und mehr Anbaufläche zur Verfügung stellen könnt. Und mehr Energie. Wir brauchen vor allem Energie.«
»Wir schneiden dir deine Anbaufläche aus dem Fels«, versicherte ihm Marrett.
LaStrande wedelte mit der Hand durch die Luft. »Hört mal zu! Ich weiß, wie wir das Energieproblem beheben könnten. Die Sicherheitsmarge, die wir beim Lebenserhaltungssystem durchgesetzt haben, ist lächerlich hoch. Typisch irdische Übervorsicht. Ich kann die Luft- und Heizsysteme mit der halben Energie fahren, die wir jetzt dafür bereitstellen …«
»Der Hälfte?«, brauste Kobol auf. »Bist du sicher?«
LaStrande starrte ihn mit seinen kurzsichtigen Augen an. »Wenn ich sage, dass es geht, dann geht es auch. Die Recycler brauchen doch den ganzen Notstrom nicht. Kein Grund, warum wir ihn nicht in die Hydroponik umleiten sollten.«
Gedankenverloren rieb sich Kobol das Kinn.
Lisa lächelte innerlich über ihn. Der ist auch nicht gerade leicht zu beeinflussen, sagte sie sich. Aber wenigstens will er die Macht. Er hat den Ehrgeiz, der Douglas abgeht. Aber er ist hinterhältig. Wie eine Schlange. Er würde Douglas niemals offen herausfordern. Aber er hat nicht einen Moment lang gezögert, zu mir ins Bett zu kommen, nachdem ich ihn eingeladen habe. Und jetzt will er die Leitung dieser Kolonie übernehmen.
Mit einem Seufzer des Bedauerns wurde Lisa klar, dass dies alles war, was ihnen von der Welt geblieben war. Martin konnte man zu ihrem Anführer umformen. Und er würde dann unter meiner Knute stehen.
»Dann ist die Sache klar«, schloss Kobol das Gespräch ab. »Der Notstrom geht an die Hydroponik. Marrett, deine Bergleute werden sich sofort dranmachen, die hydroponische Abteilung zu erweitern. Jim …«
Doch Blair und die anderen sahen an Kobol vorbei, auf die Tür. Lisa drehte sich in ihrem Sessel um und sah ein junges Mädchen in einem dunkelgrauen Overall. Sie trug das Schulterabzeichen der Funkabteilung.
»Ja?«, fragte Blair. »Was ist?«
Ihr jugendliches Gesicht rötete sich vor Aufregung. Sie trat in den winzigen, vollgepackten Schlafraum, zwängte sich an Kobol und Lisas Stuhl vorbei und übergab Blair einen Bogen ultradünnen Plastiks – der wiederverwendbare Papierersatz der Mondsiedlung.
Blair las die Nachricht, und sein Gesicht leuchtete auf.
»Sie ist von Douglas«, sagte er. Seine Augen huschten noch immer über die getippten Worte, als könne er nicht glauben, was dort geschrieben stand. »Er ist auf dem Rückweg. Er wird in fünfundvierzig Stunden eintreffen.«
Überrascht keuchten alle auf. Lisa fühlte einen irrationalen Freudenausbruch in sich aufquellen. Idiotin!, schalt sie sich selbst. Er wird alles verderben. Alles!
Und doch vermochte sie der Woge des Glücks, die sie durchwallte, nicht Herr zu werden.
Kobols Gesicht war so grau wie das einer Leiche. Seine Lippen pressten sich zu einem blassen Strich zusammen.
»Das ist noch nicht alles.« Blair wedelte mit dem dünnen Bogen herum. »Douglas sagt, dass er fünfundzwanzig Leute mit zurückbringt. Er sagt, dass die meisten von ihnen in sehr schlechter körperlicher Verfassung sind und sofort in die Krankenstation eingeliefert werden müssen.«
Kapitel 3
Der größte Raum der unterirdischen Siedlung war eine Kombination aus Warenlager, Depot und Garage direkt neben der doppelten Metallluke der Hauptluftschleuse, die auf die Oberfläche hinausführte. Die Fahrzeuge parkten neben den glitzernden, an einen Tresorraum erinnernden Schotts, aufgestellt in präzisen Reihen entlang der farbigen Linien, die man auf den glatten Boden gemalt hatte: elektrische Gabelstapler, hochelastisch gefederte Oberflächenrover, Fahrräder, mit denen man durch die unterirdischen Korridore strampeln konnte.
Die Vorräte lagerten ebenso präzise in Reih und Glied, und jede Box und jede Kiste war sorgfältig ausgezeichnet und je nach ihrem Inhalt zu verschiedenen Sektionen arrangiert. Maschinenteile, Lebensmittel, Arzneien, Kleider – all die Dinge, die die Mondsiedlung nicht selbst herstellen konnte, standen hier, Reihe um Reihe, in Stapeln, die fast so hoch waren wie die schroffe Steindecke der Höhle.
Sie sind eine Mahnung, dachte Lisa, als sie den großen Raum betrat, eine Mahnung, wie sehr wir von der Erde abhängig sind. Können wir ohne die Erde überleben? Kobol behauptet es, aber hat er recht? Können wir überleben?
Kobol stand neben ihr, auf der anderen Seite war Catherine Demain. Sie warteten vor der Luftschleuse, am Ende des breiten Gangs, der die Vorräte von den Reihen der geparkten Fahrzeuge trennte. Hinter ihnen stand ein speziell ausgewähltes Team von Freiwilligen, bereit, die Überlebenden von der Erde in die Betten zu bringen und sie medizinisch zu betreuen.
Kobol studierte seine Armbanduhr. »Noch ein paar Minuten, höchstens.«
»Sieht im Radarscan noch alles gut aus?«, fragte Lisa.
Er zuckte die knochigen Schultern. »Ich könnte bei Blair nachfragen.« Er deutete auf das Telefon in der Wand neben der Luke.
»Nein. Schon gut. Wenn irgendwas schiefläuft, wird er es über die Lautsprecheranlage durchsagen.«
Sie hörte das Geräusch von Schuhen, die über den Plastikboden der Höhle schlurften, spürte die Gegenwart anderer Menschen. Lisa wandte sich um und sah Dutzende von Leuten aus dem Turbolift kommen und erwartungsvoll durch die Höhle schlendern.
Auch Kobol wandte sich um, und sein langes Gesicht verzog sich zu einem finsteren Blick. »Warum sind diese Leute nicht auf ihrem Posten? Ich habe niemand die Erlaubnis erteilt, hier heraufzukommen, außer den …«
Lisa legte ihre Hand auf seinen Arm und brachte ihn so zum Schweigen. Sie bemerkte, dass immer mehr Leute aus dem Turbolift kamen, aufgeregt miteinander redeten, einander angrinsten, nach vorne drängten, um Platz für die Neuankömmlinge zu machen. Fast alle trugen ihre Arbeitsuniformen, und doch erinnerte die Atmosphäre an einen Feiertagsausflug auf der Erde.
»Es müssen mindestens hundert sein«, sagte Catherine Demain und lächelte glücklich.
»Und es werden immer mehr.«
»ACHTUNG«, plärrte der Lautsprecher in der Decke. Die Echos hallten von den Felswänden nach. »DAS TRANSFER-SHUTTLE HAT AUF DER LANDEFLÄCHE AUFGESETZT …«
Das Jubeln der immer weiter anwachsenden Menge übertönte einen Teil von Blairs Nachricht. Lisa hielt sich die Hände vor die Ohren, so schmerzhaft gellte der Lärm der Menge durch die Höhle.
»… SOLLTE SICH IN ETWA FÜNF MINUTEN BEI DER LUFTSCHLEUSE BEREITHALTEN. DAS ÄRZTETEAM SOLLTE SICH IN ETWA FÜNF MINUTEN BEI DER LUFTSCHLEUSE BEREITHALTEN.«
Nun lachte die Menge, redete und drängte weiter nach vorne. Lisa sah sich dichter an die Metallluke geschoben; nicht, dass sie jemand berührt hätte, aber die emotionelle Energie der Menge hatte etwas höchst Lebendiges an sich.
»Wer, zur Hölle, hat den anderen erlaubt, ihren Posten zu verlassen?«, knurrte Kobol mit lauter werdender Stimme. »Es geht doch nicht, dass die Leute hier einfach so herumgammeln.«
Catherine Demain lachte ihn an. »Was willst du dagegen tun? Ich schätze, sie sind einfach aufgeregt wegen der Überlebenden, die Douglas mitbringt.«
Lisa beobachtete die Menge. Scheinbar hatte sich jeder der mehr als fünfhundert Bewohner der Siedlung in die Höhle gedrängt. Sie füllten den breiten Zentralgang, breiteten sich in den engeren Passagen zwischen den Kistenstapeln aus. Sogar Kinder waren gekommen, die nun auf den Mondbuggies herumkletterten, die zu berühren man ihnen bislang stets verboten hatte.
Sie waren glücklich. Sie waren aufgeregt. Sie hielten respektvoll Abstand zu den medizinischen Freiwilligen und dem Anführertrio neben der Luke, aber sie wollten Douglas' Rückkehr miterleben, Zeuge der Rettung einer Handvoll Menschen von der Erde werden.