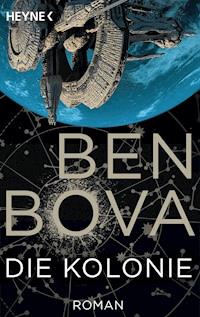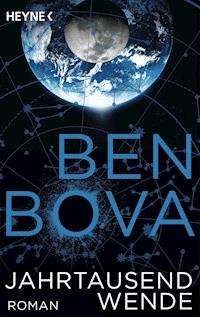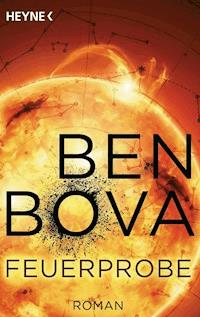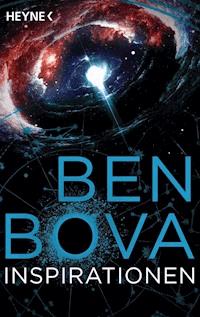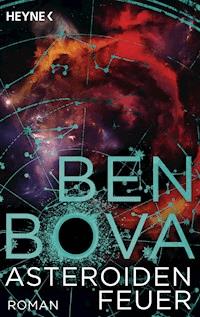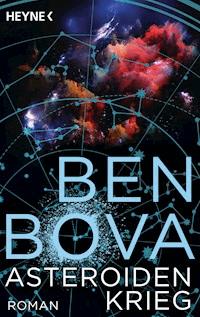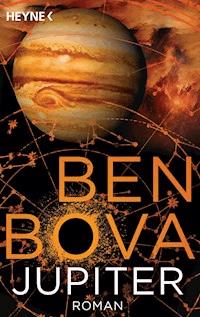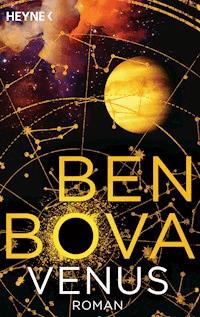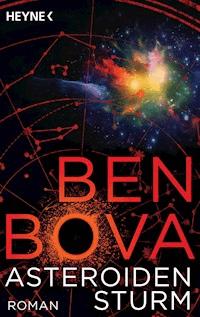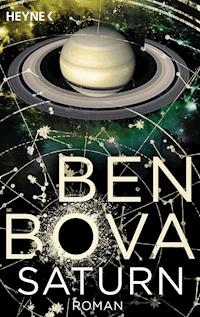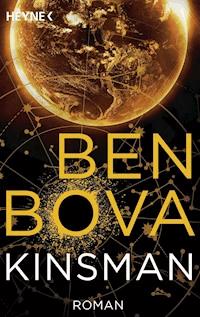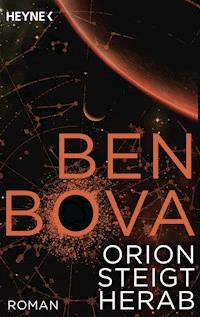
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Kampf durch Zeit und Raum
Eines Tages verliert Jack O’Ryan jede Erinnerung an die Ereignisse vor seinem 33. Geburtstag. Die Realität schlägt indes umso härter zu: Ein Bombenattentat auf die Bar verletzt die junge Frau Aretha, die Jack irgendwie bekannt vorkommt, wie jemand aus einem früheren Leben. Auf der Suche nach Aretha erfährt Jack, dass er in Wirklichkeit Orion, der Jäger, ist, der seit Jahrtausenden einen Kampf gegen Ahriman, den Widersachen, führt. Immer wieder stirbt Orion in diesem Kampf, immer wieder wird er wiedergeboren, jedes Mal an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Und immer ist da Aretha …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
BEN BOVA
ORION STEIGT HERAB
Roman
Das Buch
Eines Tages verliert Jack O'Ryan jede Erinnerung an die Ereignisse vor seinem 33. Geburtstag. Die Realität schlägt indes umso härter zu: Ein Bombenattentat auf die Bar verletzt die junge Frau Aretha, die Jack irgendwie bekannt vorkommt, wie jemand aus einem früheren Leben. Auf der Suche nach Aretha erfährt Jack, dass er in Wirklichkeit Orion, der Jäger, ist, der seit Jahrtausenden einen Kampf gegen Ahriman, den Widersacher, führt. Immer wieder stirbt Orion in diesem Kampf, immer wieder wird er wiedergeboren, jedes Mal an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit. Und immer ist da Aretha …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
ORION
Aus dem Amerikanischen von Horst Pukallus
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1984 by Ben Bova
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Das Illustrat, München
INHALT
Das Buch
Der Autor
Widmung
Erster Teil – Phönix
Interludium
Zweiter Teil – Meuchler
Interludium
Dritter Teil – Flut
Interludium
Vierter Teil – Der Krieg
Fünfter Teil – Kreis der Ewigkeit
Dem unnachahmlichen
ERSTER TEIL
1
Ich bin kein Supermann. Ich besitze Fähigkeiten, die weit über die Gaben eines normalen Menschen hinausgehen, aber ich bin genauso menschlich und sterblich wie jeder auf Erden.
Der Ursprung meiner Fähigkeiten liegt anscheinend im Aufbau meines Nervensystems. Ich kann eine völlig bewusste Kontrolle über meinen Körper ausüben. Innerhalb eines Augenblicks kann ich ihm durch die Verknüpfungen der Synapsen meinen Willen aufzwingen und jeden Körperteil tun lassen, was ich will.
Letztes Jahr habe ich binnen zwei Stunden Klavierspielen gelernt. Mein Klavierlehrer, ein gutmütiger, kleiner, ergrauter Mann, wollte absolut nicht glauben, dass ich bis zu dem Tag noch nie die Finger auf die Tasten gesetzt hatte. Anfang dieses Jahres habe ich einen Meister des Taekwondo aus der Fassung gebracht, indem ich in nicht einmal einer Woche lernte, was er sich während eines Lebens unablässigen Erarbeitens angeeignet hatte. Er gab sich Mühe, bescheiden und höflich zu bleiben, doch es war klar, dass er mir grollte und sich dafür schämte. Ich habe seinen Kursus verlassen.
Meine Fähigkeiten wachsen. Immer bin ich meinen Herzschlag und meine Atmung zu steuern imstande gewesen. Früher dachte ich, jedermann könnte es, bis ich einiges über Jogi und ihre ›rätselhaften‹ Gaben zu lesen anfing. Für mich sind ihre Tricks bloße Kinderei.
Vor zwei Monaten saß ich in einem Restaurant mitten in Manhattan. Ich neige dazu, ein Sonderling zu sein, deshalb esse ich häufig spät, um Lärm und Gedränge zu meiden. Es war schon nach 15 Uhr, und das Restaurant war fast leer. Da und dort saßen mehrere Pärchen an Tischen und unterhielten sich in gedämpftem Ton. Ein Touristenpaar mittleren Alters nahm argwöhnisch die Speisekarte mit französischen Menüs in Augenschein, misstraute offenbar Gerichten, von denen es noch nie gehört hatte. Weiter hinten hockten einige heimlich Verliebte beieinander, hielten verstohlen Händchen, schauten alle paar Sekunden zur Tür. In der Nähe meines Tischs, im vorderen Teil des Restaurants, befand sich allein eine junge Frau. Sie war schön, hatte dunkles, auf den Schultern gelocktes Haar und die ausdrucksstarken klassischen Gesichtszüge, an denen man ein Fotomodell erkennt.
Einmal sah sie zu mir herüber, und ihr ruhiger, intelligenter Blick drang bis in die Seele. Ihre Augen waren groß, grau wie das Nordmeer, und alles Wissen der Welt schien sich darin widerzuspiegeln. Plötzlich begriff ich, dass ich nicht einfach ein Einzelgänger war; ich war ein einsamer Mensch. Wie ein aus heiterem Himmel in Liebe erglühter Schnösel wäre ich in diesem Moment gern an ihren Tisch getreten und hätte mich ihr vorgestellt.
Aber da blickte sie hinüber zur Tür. Ich drehte den Kopf und sah einen Mann hereinkommen, einen außergewöhnlich gutaussehenden Mann mit goldblondem Schopf und in unbestimmbarem Alter zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Flüchtig verharrte er an der Tür, dann ging er zu der Bar beim verhangenen Spiegelglasfenster und nahm auf einem Hocker Platz. Obwohl er einen konservativen grauen Straßenanzug trug, ähnelte er mehr einem Filmstar oder einem alten griechischen Gott als einem Manhattaner Angestellten, der sein Cocktail-Stündchen vorverlegt hatte.
Die grauäugige Schöne starrte ihn an, als könnte sie sich seinem Bann nicht wieder entziehen. Er hatte so etwas wie eine Aura an sich, einen goldgelben Strahlenkranz. Wo er saß, schien die Luft beinahe zu leuchten. Tief in meinem Innern begann eine lange vergessene Erinnerung sich zu regen. Ich hatte das Gefühl, den Mann zu kennen, ihm vor langem schon einmal begegnet zu sein. Doch ich konnte mich nicht daran entsinnen, wo oder wann oder unter welchen Umständen.
Ich richtete den Blick wieder auf die junge Frau. Mit sichtlicher Anstrengung wandte sie die Augen von dem Blonden ab und schaute erneut mich an. Ihre Mundwinkel hoben sich leicht zu einem Lächeln, das einladender Art gewesen sein mochte. Da jedoch öffnete von neuem jemand die Tür, und sofort entzog die Frau mir wieder ihre Aufmerksamkeit.
Ein anderer Mann betrat das Restaurant und strebte geradewegs zur Bar, setzte sich an ihre Rundung, so dass er dem Fenster mit den Vorhängen den Rücken zukehrte. Während der eine Mann einem blonden Engel glich, hatte dieser Gast ein Aussehen mitternachtsschwarzer Unterweltlichkeit. Sein Gesicht war hart und grimmig; seine muskulöse Gestalt beulte ihm die Kleidung aus. Sein Haar war schwarz wie Pech, seine Augen unter den dicken buschigen Brauen glänzten zornig. Sogar seine Stimme klang, als mache Wut sie dunkel und schwerfällig, als er einen Brandy bestellte.
Ich trank meinen Kaffee aus und beschloss, mir die Rechnung geben zu lassen, dann beim Gehen am Tisch des Fotomodells stehenzubleiben. Ich suchte unter den vier Kellnern, die im Hintergrund des Restaurants herumlungerten – bei der Küchentür – und sich in einem Gemisch aus Französisch und Italienisch unterhielten, nach dem für mich zuständigen Mann. Das war meine Rettung.
Ein kleinwüchsiger kahlköpfiger Mann kam durch die Schwingtür der Küche gesprungen und schleuderte einen eiförmigen schwärzlichen Gegenstand durchs Restaurant. Eine Handgranate.
Ich sah alles geschehen, als spielte es sich in Zeitlupe ab. Heute ist mir klar, dass meine Reflexe schlagartig und überschnell reagiert hatten, dass ich mit phantastischer Geschwindigkeit gehandelt hatte. Ich sah, wie der Mann in die Küche zurückhuschte, wie die Kellner vor Überraschung erstarrten, die Paare an den anderen Tischen unverändert plauderten, ohne zu ahnen, dass in ein, zwei Sekunden der Tod drohte. Die junge Schönheit, die nur wenige Tische weiter saß, drehte der Granate den Rücken zu, doch der Barkellner stierte ihr entgegen, als sie auf den Teppich plumpste und über den Boden kullerte, schließlich kaum knapp eineinhalb Meter von mir entfernt liegen blieb.
Ich schrie eine Warnung und sprang über die Tische hinweg, um das junge Fotomodell aus dem Bereich der Explosion zu stoßen. Wir polterten zu Boden, ich fiel auf die Frau. Der Donnerschlag der Explosion übertönte das Klirren von Tellern und Gläsern. Es blitzte und krachte. Alles dröhnte und bebte. Dann: Rauch, Schreie, Hitze von Flammen, ätzender Gestank nach Pulver.
Unversehrt kam ich auf die Beine. Der Tisch, an dem die Frau gesessen hatte, war zerbrochen, die Wand hinter uns von Splittern verunstaltet. Qualm erfüllte das Restaurant. Ich kniete nieder und sah, dass die junge Frau die Besinnung verloren hatte. Ihre Stirn wies eine Wunde auf, doch ansonsten wirkte sie unverletzt. Ich wandte mich um, sah durch den Rauch die übrigen Gäste des Restaurants verstümmelt und blutüberströmt am Fußboden liegen, zusammengesackt an den Wänden kauern. Einige stöhnten. Eine Frau schluchzte.
Ich nahm das junge Fotomodell auf die Arme und trug es hinaus auf den Bürgersteig. Danach ging ich wieder hinein und beförderte mehrere andere Personen ins Freie. Während ich sie zwischen den Glassplittern des zerborstenen Fensters auf den Fliesen des Gehwegs ausstreckte, trafen Polizei und Feuerwehr ein, Sirenen heulten. Dichtauf folgte ein Ambulanzfahrzeug. Ich trat beiseite und ließ die berufsmäßigen Helfer eingreifen.
Die zwei Männer, die an der Theke Platz genommen hatten, waren nirgends zu sehen. Sowohl der Blonde wie auch der Schwarzhaarige schienen im selben Moment, als die Granate detonierte, verschwunden zu sein. Als ich vom Fußboden aufstand, waren sie bereits fort gewesen. Den Barkellner hatte die Explosion zerrissen. Aber seine beiden Gäste waren einfach weg.
Während die Feuerwehrleute Glut und Flammen löschten, reihten die Polizisten vier Tote auf dem Bürgersteig auf und breiteten Decken über sie. Die Sanitäter behandelten die Verletzten. Sie hoben das noch bewusstlose Fotomodell auf eine Tragbahre. Weitere Ambulanzen fuhren vor, eine Menschenmenge sammelte sich am Schauplatz des Vorfalls, diskutierte in halblautem Stimmengewirr.
»Gottverdammte IRA«, brummte ein Polizist.
»Herrje, schmeißen die Kerle jetzt auch hier Bomben?«
»Es können auch die Puertoricaner gewesen sein«, meinte ein anderer Polizist; seine Stimme bezeugte Müdigkeit und Überdruss.
»Oder die Serbokroaten. Die waren's doch, die 'ne Bombe in der Freiheitsstatue gezündet haben, erinnern Sie sich?«
Die Polizei befragte mich ein paar Minuten lang; danach verwiesen sie mich an die Sanitäter, die mich in einem Ambulanzwagen rasch untersuchten. »Sie haben Glück gehabt, Mister«, sagte ein Arzt in weißem Kittel. »Ihnen ist kein Härchen versengt worden.«
Glück. Mir war benommen zumute, es schien mir, als wäre ich rundum von dichtem Nebel umgeben. Ich konnte sehen, mich bewegen, atmen und denken. Aber ich konnte nichts fühlen. Ich wollte wütend sein, traurig oder wenigstens entsetzt. Doch ich war so ungerührt wie ein dummer Ochse, glotzte gelassenen Blicks in die Welt. Ich dachte an die junge Frau, die man gerade in eine Klinik fuhr. Was hatte mich dazu bewogen, sie zu schützen? Wer trug die Verantwortung für den Anschlag? Hatte er der Frau gegolten? Oder einem der zwei Männer an der Bar? Oder mir?
Mittlerweile waren zwei Übertragungswagen des Fernsehens eingetroffen, und die Nachrichtenreporter sprachen mit dem Polizeihauptmann, der am Tatort den Einsatz leitete, während ihre Kameraleute die tragbaren Kameras ausluden. Eine Reporterin, eine Frau mit durchdringender, näselnder Stimme, stellte mir etliche Fragen. Lustlos gab ich ihr Antworten; mein Verstand arbeitete mit fast stumpfsinniger Langsamkeit.
Sobald die Polizei mich gehen ließ, drängte ich mich durchs Gewimmel der Zuschauermenge, die das Ereignis angelockt hatte, und ging die drei Häuserblocks bis zum Büro. Ich erzählte niemandem von der Explosion. Schnurstracks habe ich mein Zimmerchen aufgesucht und die Tür geschlossen.
Als der Abend anbrach, saß ich noch immer an meinem Schreibtisch – und machte mir darüber Gedanken, weshalb man die Handgranate geworfen haben mochte und wieso es mir gelungen war, nicht getötet zu werden. Diese Überlegungen wiederum brachten mich auf die Frage, warum ich so ungewöhnliche körperliche Fähigkeiten habe; und darauf, ob die beiden seltsamen Männer, die an der Theke spurlos verschwunden waren, möglicherweise über ähnliche Gaben verfügten. Und wieder dachte ich an die junge Frau. Ich schloss die Augen, rief mir das Ambulanzfahrzeug in Erinnerung, in dem man sie abtransportiert hatte. Hl.-Geist-Hospital hatte auf der Seite des Autos gestanden. Über meinen Tischcomputer verschaffte ich mir die Anschrift der Klinik. Ich erhob mich von meinem Schreibtisch und verließ das Büro; hinter mir erlosch automatisch die Beleuchtung.
2
Erst als ich die Drehtür im Haupteingang des Heilig-Geist-Hospitals durchquerte, fiel mir ein, dass ich überhaupt nicht den Namen der Frau kannte, die ich zu besuchen beabsichtigte. Und als ich inmitten der von lauter hektischen Menschen bevölkerten Eingangshalle stand, begriff ich, wie sinnlos es wäre, eine der Krankenschwestern am Anmeldeschalter um Hilfe zu bitten, die ohnehin einen gehetzten Eindruck machten. Für einige Augenblicke wusste ich keinen Rat; da bemerkte ich einen Polizeibeamten in Uniform.
Nach und nach wandte ich mich an einen um den anderen Polizisten, denn es war eine ganze Anzahl anwesend, und bat sie um Auskünfte über die beim Attentat des heutigen Nachmittags verletzten Personen. Ich erzählte ihnen, ich käme von der Versicherungsgesellschaft des Restaurants. Nur ein Polizist, ein stämmiger Schwarzer mit feschem Schnauzbart, betrachtete mich mit Argwohn und verlangte, ich solle mich ausweisen. Ich zeigte ihm meine Mitgliedskarte der Betriebsgruppenversicherung; er warf kaum einen Blick darauf, weil sie so offiziell aussah, dass sie ihn sofort überzeugte. Vielleicht trug auch mein gänzlich selbstsicheres Auftreten zu meiner Glaubwürdigkeit bei.
Kaum eine halbe Stunde später durfte ich in ein Krankenzimmer, in dem sechzehn Betten standen, die Hälfte unbelegt. Die diensthabende Schwester führte mich zu dem Bett, in dem das junge Fotomodell lag, die Augen geschlossen, ein fleischfarbenes Plastikpflaster auf die Stirn geklebt.
»Nur ein paar Minuten«, flüsterte die Schwester mir zu. Ich nickte. »Miss Promachos!«, rief sie gedämpft, beugte sich übers Bett. »Sie haben Besuch.« Die junge Frau schlug die Augen auf; diese schimmernden grauen Augen, die so tief zu sein schienen wie die Ewigkeit. »Bloß 'n paar Minuten«, wiederholte die Schwester. Dann latschte sie davon, ihre weichen Schuhsohlen quietschten auf dem gefliesten Fußboden.
»Sie … Sie sind der Mann, der mich gerettet hat … im Restaurant.«
Ich spürte, wie mein Herz wild klopfte, und ich tat nichts, um sein Hämmern zu verlangsamen. »Sind Sie gut davongekommen?«, erkundigte ich mich.
»Ja, und das habe ich Ihnen zu verdanken. Bis auf den Kratzer an der Stirn. Aber mir ist gesagt worden, dass keine plastische Operation nötig ist. Es wird keine Narbe zurückbleiben.«
»Das ist gut.«
Sie verzog andeutungsweise den Mund. »Außerdem habe ich einige blaue Flecken am Körper und an den Beinen, weil Sie mich umgerissen haben.«
»Oh, das tut mir leid …«
Sie lachte. »Macht nichts. Wenn Sie mich nicht umgeworfen hätten …« Ihre Belustigung wich. Ihr reizendes Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an.
Ich trat näher ans Bett. »Ich bin froh, dass Sie nicht ernsthaft verletzt worden sind. Ich … ich weiß nicht einmal Ihren Namen.«
»Aretha«, sagte sie. »Nennen Sie mich Aretha.« Ihre Stimme glich einem leisen, sanften Schnurren, klang vollständig weiblich, ohne in grelle oder schrille Töne zu verfallen. Sie fragte nicht nach meinem Namen, stattdessen musterte sie mich mit völlig ruhigem, aber erwartungsvollem Blick, als rechnete sie meinerseits mit einer bestimmten Äußerung. Irgendeiner wichtigen Mitteilung. Ich begann mich unbehaglich und verwirrt zu fühlen. »Sie wissen nicht«, fragte sie, »wer ich bin, nicht wahr?«
Mein Gaumen war trocken. »Sollte ich es wissen?«
»Sie erinnern sich nicht?« An was soll ich mich erinnern?, wollte ich fragen. Doch ich schüttelte nur den Kopf. Sie hob den Arm und ergriff meine Hand. Ihre Finger fühlten sich auf meiner Haut kühl und begütigend an. »Schon gut«, sagte sie. »Ich werde Ihnen helfen. Deshalb bin ich hier.«
»Mir helfen?« Meine Gedanken wirbelten im Kreis. Was meinte sie?
»Entsinnen Sie sich an die beiden Männer, die heute Nachmittag an der Bar gesessen haben?«
»Der Blonde …« Sein Anblick gloste in meinem Gedächtnis.
»Und der andere. Der Dunkle.« Arethas Miene wirkte nun düster. »Sie entsinnen sich auch an den anderen?«
»Ja.«
»Aber Sie erinnern sich nicht daran, wer sie sind, oder?«
»Müsste ich sie kennen?«
»Sie müssen's«, erwiderte sie, packte meine Hand jetzt sehr fest. »Es ist unerlässlich.«
»Aber ich weiß nicht, wer sie sind. Bis zum heutigen Tag hatte ich sie noch nie gesehen.«
Sie ließ ihren Kopf aufs Kissen zurücksinken. »Sie haben sie schon gesehen. Wir sind ihnen beide schon einmal begegnet. Sie können sich nur nicht daran erinnern.«
Ich hörte das Quietschen der Schritte, mit denen sich die Schwester näherte. »Das ist alles reichlich verwirrend«, sagte ich zu Aretha. »Welchen Zweck hatte das Attentat in dem Restaurant? Wer steckt dahinter?«
»Das ist unwichtig. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, sich an Ihre Aufgabe zu erinnern. Was heute Nachmittag geschehen ist, war belanglos.«
»Belanglos? Vier Menschen sind umgekommen!«
Das gezischelte Flüstern der Schwester unterbrach unsere Unterhaltung. »Jetzt war's lange genug, Sir. Sie braucht Ruhe.«
»Aber …«
»Sie braucht Ruhe!«
Aretha lächelte mir zu. »Lassen Sie nur. Sie können mich morgen wieder besuchen. Dann werde ich Ihnen alles erklären.«
Widerwillig verabschiedete ich mich und verließ das Hospital. Während ich langsam durch die Betriebsamkeit im Irrgarten der Korridore des Krankenhauses ging, schenkte ich den Menschen, die an mir vorübereilten, keine Beachtung. Ihre individuellen Leidensgeschichten, ihr Kummer und Schmerz lagen mir so fern wie der entfernteste Stern. Die Bruchstücke von Informationen, die Aretha mir gegeben hatte, quälten mich, brachten meinen Verstand völlig durcheinander. Sie kannte mich! Wir waren uns schon einmal begegnet. Ich sollte mich an sie erinnern können; und an die beiden Männer, die sich an die Bar gesetzt hatten. Doch mein Gedächtnis war in dieser Hinsicht so unergiebig wie ein dunkler leerer Computer-Bildschirm.
Als ich die Eingangstreppe des Heilig-Geist-Hospitals hinabstieg, mich in der Straße nach einem Taxi umschaute, hatte ich entschieden, nicht nach Hause zu fahren. Stattdessen nannte ich dem Taxifahrer die Anschrift des Gebäudes, in dem sich das Büro befand; dort waren meine Personaldaten gespeichert.
Die Äußerlichkeiten sind rasch aufgezählt. Mein Name lautet John G. O'Ryan. Der Name hatte mir immer ein wenig missfallen, als wäre er nicht der richtige Name für mich, gar nicht mein wahrer Name. John O'Ryan. Er passte einfach nicht zu mir. Ich bin Leiter der Marktforschungsabteilung bei der Kontinentale Elektronik AG, einer multinationalen Firma, die Laser und andere Hightech-Apparaturen herstellt. Meine Personaldaten besagten, während ich sie an meinem Tischcomputer sichtete, dass ich sechsunddreißig Jahre alt war, aber ich habe mich immer jünger gefühlt … Immer?
Ich versuchte, mich an die Zeit vor meinem dreißigsten Geburtstag zurückzuerinnern, stellte erschrocken fest, dass ich es nicht konnte. An meinen dreiunddreißigsten Geburtstag vermochte ich mich deutlich zu entsinnen. Ich hatte den Abend mit Adrienna verbracht, der Sekretärin meines Chefs. Der Abend war sehr denkwürdig verlaufen. Wenige Wochen später war Adrienna zur Londoner Filiale der Firma versetzt worden, und danach hatte ich – so kam es mir vor – meine gesamte Zeit für die Computer und meine Arbeit verwendet. Ich wollte mich an Adriennas Gesicht erinnern und war dazu außerstande. Ich hatte lediglich verschwommene Vorstellungen von dunklem Haar, einem sehnigen, geschmeidigen Körper und grauen Augen voller Glanz.
An die Zeit vor meinem dreiunddreißigsten Geburtstag jedoch kamen mir keinerlei Erinnerungen. Aus Konzentration schnitt ich eine so verkrampfte Miene, dass meine Kiefermuskeln schmerzten, aber nichtsdestoweniger entsann ich mich an nichts, das länger als drei Jahre zurücklag. Ich wusste nicht einmal irgendetwas über Eltern. Ich hatte keine Kindheitserinnerungen. Außer dem begrenzten Bekanntenkreis hier im Büro kamen mir keine Freunde in den Sinn.
Mir brach am ganzen Körper kalter Schweiß aus. Wer war ich? Warum gab es mich?
Stundenlang saß ich in meinem kleinen Büro, während der Abend in nächtliche Dunkelheit überging, allein in meinem stillen klimatisierten Zimmer aus Chrom und Leder, hinter dem eleganten Schreibtisch aus brasilianischem Mahagoni, und sah mir auf dem Bildschirm des Tischcomputers meine eigenen Personaldaten an. Sie enthüllten wenig. Namen. Lebensdaten. Schulen. Nichts davon ergab für mich einen Zusammenhang oder löste auch nur die schwächste Erinnerung aus.
Ich blickte in den blitzblanken chromgerahmten Spiegel an der Wand gegenüber dem Schreibtisch. John G. O'Ryan schaute mich an: ein Fremder mit dichtem schwarzen Haar, wenig ansprechendem Gesicht von leicht mediterranem Typus (wieso dann der Name O'Ryan?), knapp unter einsachtzig groß, gut in Schuss befindlicher Statur, gekleidet wie ein leitender Angestellter, nämlich in einen dreiteiligen dunkelblauen Anzug, leicht schmuddeliges weißes Hemd und tadellos geknoteten kastanienbraunen Schlips. Den Personaldaten ließ sich entnehmen, ich sei in der Schule im Sport sehr tüchtig gewesen. Auch heute fühlte ich mich kraftvoll und robust. Aber völlig ›durchschnittlich‹. Ich konnte mich in eine Menschenmenge begeben, ohne irgendwie aufzufallen.
Wer bin ich? Ich vermochte mich des Eindrucks nicht zu erwehren, dass ich vor erst drei Jahren durch irgendeine Macht oder Kraft, die sämtliche Erinnerungen an mein vorheriges Dasein aus meinem Gedächtnis gelöscht hatte, sozusagen einfach in mein jetziges Leben gestellt worden war. Ich sah ein, dass ich herausfinden musste, wer oder was mir meine gegenwärtige Existenz beschert hatte. Und der Schlüssel zu meiner Vergangenheit war Aretha; sie wusste Bescheid, und sie wollte, dass ich alles erfuhr. Mein Herz wummerte, meine Atemzüge gingen so schnell, dass ich nahezu keuchte. Jetzt hatte ich Gefühle, und ich kostete sie für ein Weilchen aus. Dann jedoch senkte ich mittels einer bewussten Willensanstrengung den Adrenalinspiegel meines Bluts, mäßigte meinen Herzschlag und den Atemrhythmus.
Irgendwie ahnte ich, dass die Handgranate für mich bestimmt gewesen war. Nicht für Aretha oder sonst wen. Für mich. Jemand hatte versucht, mich umzubringen. Mit der vollständigen Gewissheit eines buchstäblich eingefleischten Instinkts erkannte ich, dass das Bestreben, meine Herkunft aufzudecken, Lebensgefahr bedeuten würde. Mir der Tod drohte. Doch ich konnte unmöglich darauf verzichten. Und ich begriff, dass in meine Vergangenheit, wie sie auch gewesen sein mochte, wer ich auch war, nicht nur Aretha, sondern ebenso jene beiden Männer – der Engelgleiche und der Finsterling – verwickelt sein mussten. Einer von ihnen, oder vielleicht beide, hatte mich zu ermorden versucht.
3
Am Morgen nach dem Anschlag im Restaurant betrat ich mein Büro Punkt neun Uhr, ein bisschen später, als ich es gewöhnlich tat. Ich musste den Fragen meiner Sekretärin und mehrerer Kollegen ausweichen, die entweder gestern Abend Meldungen in den TV-Nachrichten gesehen oder Morgenzeitungen in den Händen hatten, die auf der ersten Seite ein Foto von mir zeigten, wie ich zwischen den Verletzten und Toten stand.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und ließ meinen Computer das Heilig-Geist-Hospital anrufen. Der Anrufbeantwortungs-Computer der Klinik teilte mir im herzlichen Tonfall einer geübten Schauspielerin mit, die Besuchszeit sei von vierzehn bis sechzehn Uhr sowie achtzehn bis zwanzig Uhr. Miss Promachos werde als in guter Verfassung geführt. Ans Telefon könne sie gegenwärtig nicht kommen; sie werde gerade vom Arzt untersucht.
Ich kündigte meinen Besuch für vierzehn Uhr an. Anschließend erledigte ich die Arbeit eines ganzen Tages – sogar mehr – bereits im Lauf des Vormittags. Aus irgendeinem närrischen Grund fühlte ich mich richtig wundervoll. Es schien, als wären mir Schuppen von den Augen gefallen oder als hätte sich plötzlich ein Fenster geöffnet und mir Ausblick auf eine herrliche Landschaft gewährt. Gewiss, ich war mir darüber im Klaren, dass ich ein außerordentlich unvollständiges Gedächtnis hatte, dass ich nicht wusste, wer ich war oder warum es mich gab. Wahrscheinlich schwebte ich in sehr ernster Gefahr; in dieser Beziehung machte ich mir nichts vor. Doch selbst diese Einsicht war wunderbar aufregend. Vierundzwanzig Stunden zuvor war ich noch eine Art von gefühllosem Automat gewesen; ich hatte nicht einmal darüber Klarheit gehabt, dass ein Großteil meiner Erinnerungen fehlte. Ich hatte lediglich das getan, was man so zum Leben tun musste. Geatmet, aber nichts empfunden. Nun war mir, als kehrte ich, nachdem ich viel zu lange im trüben Dunkel der Tiefe verbracht hatte, an die schöne sonnenbeschienene Meeresoberfläche zurück.
Ich arbeitete die Mittagspause durch; zum Essen war ich viel zu aufgeregt. Wie ein Teenager, der es kaum erwarten kann, seine erste Verabredung einzuhalten, eilte ich kurz vor vierzehn Uhr aus dem Büro, winkte auf der von Menschen und Autos geschäftig durchwimmelten Hauptverkehrsstraße ein Taxi heran, wand mich ungeduldig auf dem Sitz, während der Fahrer den Wagen durch den Nachmittagsverkehr zum Heilig-Geist-Hospital schlängelte.
»Miss Promachos«, sagte die Krankenschwester hinter dem Pult am Eingang der Station, in der ich Aretha gestern besucht hatte, »ist vor einer halben Stunde entlassen worden.«
Ich war geschockt. Mir war zumute, als hätte mir jemand einen Knüppel um die Ohren gehauen. »Entlassen …?«
»Ja. Sind Sie Mister O'Ryan?« Ich nickte wortlos. »Sie hat für Sie eine Nachricht hinterlegt.« Die Schwester reichte mir ein gefaltetes Stück Papier, auf dem – in von Oberflächlichkeit und Hast gekennzeichnetem Schriftzug – mein Name stand. O'Ryan war falsch geschrieben. Ich faltete das Papier (ein Blatt eines Schreibblocks) auseinander und las: Keine Zeit. Der Dunkle. Und in fast unleserlichem Gekritzel: Untergrund.
Ich zerknüllte das Blatt in der Hand. »Wann ist sie fortgegangen, sagen Sie?« Die Krankenschwester, war ein erfahrenes altes Schrapnell. Der Blick ihrer verengten Augen verriet mir, dass sie sich nicht in ein Dreiecksverhältnis einmischen mochte. »Wann?«, wiederholte ich.
Sie schaute auf die Digitaluhr am Schalttafelaufbau vor ihrem Platz. »Vor achtundzwanzig Minuten, um genau zu sein.«
»Wer war bei ihr?«
»Ich habe seinen Namen nicht erfahren. Sie ist auf eigenen Wunsch entlassen worden.«
»Wie sah er aus?«
Sie zögerte. Ich konnte ihr ansehen, dass sich in ihr ein inneres Ringen vollzog. »Ein großer Mann«, sagte sie schließlich. »Nicht ganz so groß wie Sie, aber … 'n Klotz von Kerl. Verstehn Se? Breit wie'n Schrank. Wie'n Mafia-Schläger, bloß noch übler. Er sah … gefährlich aus. Beim bloßen Anblick ist mir bange geworden.«
»Dunkler Teint, schwarze Haare, buschige Brauen?«
»Das ist er.« Sie nickte. »Nur … Miss Promachos hat's anscheinend nicht vor ihm gegraust. Mir wohl, aber sie hat nicht so gewirkt, als ob sie sich vor ihm fürchtet. Sie hat sich verhalten, als würde sie ihn kennen, als gehörte er zur Familie.«
»Feine Familie …«
Die Krankenschwester hatte keine Ahnung, wohin die beiden gegangen sein mochten. Es verstieß gegen die Dienstvorschriften der Klinik, mir Arethas Anschrift zu nennen, aber die Schwester tat es trotzdem, nachdem ich sie nur ein wenig dazu gedrängt hatte. Offenbar hatte der Dunkle ihr regelrechtes Grauen eingeflößt.
Ich nahm erneut ein Taxi, um mich zu der von der Schwester genannten Anschrift fahren zu lassen, die allem Anschein nach am anderen Ende der Innenstadt lag, in der Nähe der Brooklyner Brücke. Der Taxifahrer, ein Lateinamerikaner aus Mittelamerika, fand sich bald nicht mehr im Labyrinth der Straßen der unteren östlichen Stadtviertel zurecht. Ich bezahlte und ging mehrere Blocks weit zu Fuß, suchte Arethas Wohnung.
Es gab die Anschrift nicht. Ich hatte eine falsche Auskunft erhalten. An einer Straßenecke blieb ich stehen, begann mich in meinem Anzug in dieser Gegend allzu auffällig zu fühlen, wo jeder andere Jeans, Drillich, T-Shirts, sogar Umhängetücher trug (bei weichletzteren es sich einmal um Tischdecken gehandelt hatte). Ich sorgte mich nicht, ich könnte ausgeraubt werden; vermutlich hätte ich mir deswegen Sorgen machen sollen, doch ich tat es nicht. Ich konzentrierte mich viel zu intensiv auf die Frage, weshalb man Aretha im Krankenhaus unter falscher Anschrift registriert hatte. Ich hegte die Überzeugung, dass die Schwester ehrlich gewesen war; Aretha selbst musste eine unrichtige Anschrift angegeben haben.
Untergrund. Was meinte sie damit? Untergrund … Ich blickte auf die Armbanduhr. Sie hatte das Hospital vor fast einer Stunde verlassen. Innerhalb einer Stunde konnte sie in dieser riesigen, gedrängt vollen Stadt überall abgeblieben sein.
»He, das is 'ne dufte Uhr, die du da has, Mann.« Ich spürte das Pieksen einer Messerspitze an meinem Rücken, während der stinkige Atem des Burschen, der es in der Hand hielt, mir den Nacken wärmte. »Die Uhr gefällt mir echt, Mann«, sagte er gequetscht, gab sich redlich Mühe, seiner Stimme einen bedrohlichen Klang zu verleihen. Ich hatte allerdings keine Lust, mich am hellen Tag berauben zu lassen. Der Blödian stand dicht hinter mir und drückte mir das Messer ins Kreuz, um mich nötigenfalls abzustechen, ohne dass irgendein Vorübergehender es bemerkte. »Du hältst die Fress un gibs mich jetz die Uhr, Pissgesicht.«
Ich hob die Hände, als hätte ich vor, die Armbanduhr vom Handgelenk zu streifen, dann fuhr ich herum, rammte ihm den Ellbogen in den Leib und drosch ihm mit dem Handrücken auf die Nase. Das Messer klirrte aufs Pflaster. Der Hieb in den Bauch hatte dem Gauner die Luft genommen, so dass er keinen Laut hervorbrachte. Er sackte mit gebrochener Nase zusammen, Blut sprudelte auf seine zerlumpten Klamotten, troff auf den Beton. Ich griff mir eine Handvoll seines dreckigen Haars, bog ihm den Kopf zurück. Sein Gesicht war blutbesudelt. »Verschwinde, bevor ich die Geduld verliere«, empfahl ich ihm. Mit dem linken Fuß versetzte ich dem Messer einen Tritt, so dass es in den Rinnstein schlitterte.
Während er röchelte, die Augen vor Schmerz und Schrecken weit aufgerissen, torkelte er auf die Beine und hinkte davon. Ein paar Passanten schauten mich an, aber niemand äußerte ein Wort oder rührte einen Finger. Die Stadt von ihrer besten Seite.
Untergrund … Ich hörte, wie unter meinen Füßen eine U-Bahn dahinbrauste, ihre Räder auf den Eisenschienen kreischten. Untergrund mochte ein Hinweis auf die Untergrundbahn sein; vielleicht hatte Aretha das Wort nicht beenden können. Gleich vor dem Haupteingang des Heilig-Geist-Hospitals befand sich eine U-Bahnstation. Ich warf einen Blick über die Straße und sah auf der anderen Seite ebenfalls eine U-Bahnstation. Ich lief hinüber, verursachte ein vielfaches Hupkonzert und Geschimpfe von Autofahrern, hastete die Treppe hinab. In der U-Bahnstation, die von Schmutz starrte und nach Urin stank, stapfte ich von einer Karte des U-Bahnnetzes zur anderen, bis ich eine fand, die sich unter den aufgesprühten Graffiti noch einigermaßen erkennen ließ. Tatsächlich verband eine rote Linie die Haltestelle vor dem Heilig-Geist-Hospital mit der hiesigen Station.
Untergrundbahn. Aretha und der Mann waren mit der U-Bahn gefahren und an dieser Station ausgestiegen. Dessen war ich sicher. Das musste der Sinn von Arethas überstürzt hingekritzelter Mitteilung sein.
Und jetzt? Wohin waren sie von hier aus gegangen? Eine vier Waggons lange U-Bahn kam, ratterte und quietschte, bis sie zum Stehen gelangte. Die Waggons strotzten von Graffiti, Karikaturen und den Namen der ›Künstler‹, alles in den grellsten Farben. Ich las die Wörter an den Seiten der Waggons, forschte nach irgendeiner Botschaft. Die Närrischkeit eines Verzweifelten. Mit Gefauche öffneten sich die Türen, und sämtliche Fahrgäste stiegen aus. Ich näherte mich dem vordersten Waggon, aber ein Schwarzer in der Dienstkleidung der städtischen Verkehrsbetriebe winkte ab.
»Endstation!«, rief er mir entgegen. »Dieser Zug fährt ins Depot. Die nächste Bahn Richtung Stadtrand geht in fünf Minuten ab, die nächste Bahn über die Brücke hält auf'm Nachbargleis.«
Mit erneutem Fauchen schlossen sich die Türen, und die U-Bahn entfernte sich langsam – ohne einen Passagier – vom Bahnsteig, rollte zum Gequietsche ihrer Räder in eine Biegung. Ich lauschte so aufmerksam, wie ich dazu imstande war, hörte auf die anderen Geräusche, die durchs Innere der Station hallten: Gespräche, Dröhnen von Rockmusik aus dem Kofferradio einiger Jüngelchen, schrilles Gelächter eines Trios weiblicher Teenager. Die U-Bahn verschwand in der Kurve außer Sicht, hielt irgendwo. ›Ins Depot‹, hatte der Fahrer gesagt. Dort stellte man auf Abstellgleisen Züge ab, die gerade nicht verkehrten, bis der Fahrplan wieder ihren Einsatz vorsah.
Ich schaute mich um. Niemand beachtete mich. Ich schlenderte ans Ende des Bahnsteigs, schwang mich mühelos über das mit einem Vorhängeschloss gesicherte schwere Tor aus Maschendraht, das den Zugang zu den Gleisen versperrte, und stieg die Treppe in den Tunnel hinab. Die Stufen und Tunnelwände, das Geländer, das ich berührte, waren mit dem angesammelten, abgelagerten Dreck, dem Schmutz und der Schmiere von Jahren bedeckt. Die Sohle des Tunnels ähnelte einem Abwässerkanal mit Schienen. In der trüben Beleuchtung sah ich, dass das elektrisch geladene dritte Gleis, das genug Strom führte, um die Bahnen anzutreiben und jeden zu töten, der damit in Kontakt kam, mit Holzbrettern abgedeckt war; ich betrat die Planken, weil die übelriechende Feuchtigkeit des Bodens mir bereits die Schuhe durchnässt hatte.
Ich hörte, wie sich von fern eine U-Bahn näherte. In den Wänden befanden sich in gewissen Abständen Nischen, in die sich die Streckenarbeiter vor U-Bahnen zurückziehen konnten, und als das Scheinwerferlicht des Triebwagens mich erfasste, das Signalhorn gellte, presste ich mich an die dreckige Wand und ließ das Ungetüm vorüberrauschen. Es war unvermeidbar, dass es mir den Atem verschlug, als der Zug nur ein paar Zentimeter von mir entfernt vorbeidröhnte.
Sobald die Bahn vorüber war, nahm ich mich resolut zusammen und folgte dem Verlauf der Schienen. Tatsächlich fand ich hinter der Kurve ein Dutzend oder mehr Züge vor, die still und leer nebeneinander standen. Jeder war von vorn bis hinten mit Graffiti besprüht. Die Lampen an der Decke des Depots hingen weit auseinander; sie verströmten lediglich unzulängliche Kegel schwacher Helligkeit in die schmutzige Dunkelheit, die im Depot herrschte.
Sie sind hier, sagte ich mir. Irgendwo hier sind sie. Ich verharrte und hielt den Atem an, lauschte. In diesem Dunkel war das Augenlicht wenig von Nutzen.
Ein Geräusch wie von Huschen und Flitzen. Das Scharren von Hartem, das über die eisernen Schienen rutschte. Dann ein Pieps- und Fieplaut. Etwas streifte meinen Fußknöchel; unwillkürlich riss ich den Fuß zurück, verlor auf den durchgesackten Brettern über dem elektrisch geladenen Gleis beinahe das Gleichgewicht. Ratten. Ich spähte ins Düstere und sah böse rote Augen ihrerseits mich anstieren. Ratten. Viele Ratten.
Dann jedoch vernahm ich Stimmen. Zuerst konnte ich die Worte nicht verstehen, aber eindeutig gehörte eine Stimme einer Frau, während die andere die barsche, abstoßende, feindselige Art von Stimme war, wie ich sie sofort mit dem Finsterling in Verbindung brachte, den ich flüchtig im Restaurant gesehen hatte.
Ich strebte in die Richtung der Stimmen, bewegte mich so lautlos wie ein Geist, missachtete die bösartigen rötlichen Äuglein der Ratten, die ringsum in der Düsternis lauerten.
»Was hast du ihm verraten?«, fragte die Männerstimme im Tonfall äußerster Hartnäckigkeit.
»Nichts.«
»Ich will wissen, wie viel du ihm verraten hast.«
»Ich habe ihm nichts erzählt.« Die Frauenstimme gehörte zweifelsfrei Aretha. Da keuchte sie, stieß ein Schluchzen der Pein und Furcht aus.
»Sprich!«
Ich verzichtete auf alle Bemühungen, mich unbemerkt anzunähern, rannte über die verzogenen losen Bretter auf die Stimmen zu. Aretha schrie, gab einen erstickten Schmerzensschrei von sich, gerade als ich zwischen zwei abgestellte U-Bahn-Züge stürmte und die beiden schließlich in einem Lichtkegel sah. Sie hielten sich am Ende des Tunnels auf. Aretha kauerte im Unrat des Bodens, die Arme auf den Rücken gefesselt, das Pflaster noch an der Stirn. Der Dunkle stand neben ihr, halb im Schatten, betrachtete sie. Dutzende von Ratten umringten Aretha. Ihre Beine und Füße waren nackt und bluteten. Ihre Bluse war aufgerissen, und eine dicke Ratte, so boshaft, als wäre sie geradewegs der Hölle entsprungen, hockte auf den Hinterbeinen, schnappte nach Arethas schönem Gesicht.
Mir entfuhr ein unartikuliertes Aufbrüllen, indem ich schnurstracks hinüberstürzte. Ich sah, wie der Dunkle sich zu mir umdrehte; seine Augen waren so rot und maliziös wie die Äuglein der Ratten. Anscheinend erkannte er mich, während ich durch den Tunnel auf ihn zusprang, und er wich zurück in die Schatten.
Da ich unbewaffnet war, trat ich wild auf den Schwarm von Ratten rings um Aretha ein, ich bückte mich, packte mit jeder Hand so ein Vieh und schmiss beide mit aller Gewalt gegen die Wände. Während ich nach allen Seiten trat und schlug, scheuchte ich die Tiere in sämtliche Richtungen davon. Mit lautem Pfeifen flohen sie in den Schutz der Finsternis.
Mit einem Mal waren sie alle weg, und ebenso war der Mann fort. Mein Blick fiel auf Aretha. Ihre Augen starrten blicklos zu mir auf. Die Kehle war ihr durchgebissen worden. Helles Blut hatte meine dreckigen Schuhe und die Hose bespritzt. Ich kniete nieder und hob Aretha aus dem Schmutz. Aber es war zu spät. Sie war tot.
4
Die folgenden zwei Tage brachte ich in einer Art von wutbedingtem Schockzustand zu, unterdrückte meine Empfindungen so stark, dass ich nichts fühlte. Polizeiliche Vernehmungen, Lügendetektor-Befragungen, ärztliche Untersuchungen, psychiatrische Tests das alles ließ ich über mich ergehen wie ein Roboter, beantwortete Fragen, reagierte auf Reize, ohne äußerlich nur eine Andeutung von Gefühl zu zeigen.
Aus irgendeinem Grund erzählte ich niemandem von dem Finsterling, der Arethas Tod bewirkt hatte. Sie war von ihm ermordet worden, indem er irgendwie Einfluss auf die Ratten ausübte, so dass sie ihr die Halsschlagader aufbissen; er hatte sich der Tiere bedient, wie ein anderer Mensch eine Pistole benutzt hätte. Doch ich erwähnte ihn nicht. Der Polizei und den Ärzten gab ich die Darstellung, ich sei Aretha aus der Klinik gefolgt und hätte sie gerade in dem Moment eingeholt, als im U-Bahn-Depot die Ratten über sie herfielen. Ich sei zu spät gekommen, um sie retten zu können. Zumindest die letztere Aussage stimmte.
Irgendetwas tief im Innern meines Bewusstseins riet mir davon ab, mit irgendwem über den schwärzlichen Schuft zu sprechen. Insgeheim wusste ich ganz tief drinnen, wo die Glut meiner Erbitterung eingedämmt lag und schwelte , dass ich mir, hätte ich seine Existenz erwähnt, bloß noch mehr Ärger mit der Polizei und den Psychiatern eingehandelt hätte. Wichtiger als diese Vorsicht war mir jedoch der Wunsch, ihm selber nachzuspüren und ihn zu finden. Ich wollte ihm mit eigener Hand den Garaus machen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!