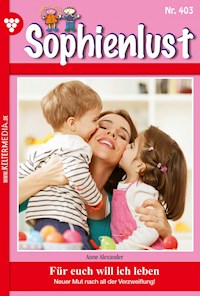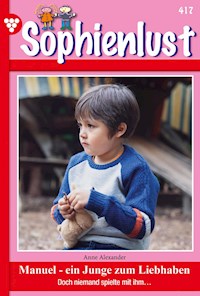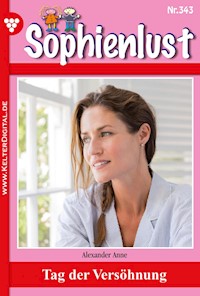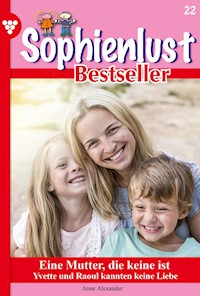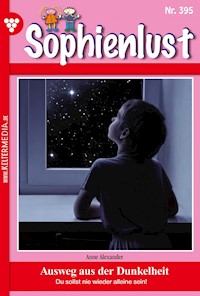
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie wird die von allen bewunderte Denise Schoenecker als Leiterin des Kinderheims noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Neben den alltäglichen Sorgen nimmt sie sich etwa des Schicksals eines blinden Pianisten an, dem geholfen werden muss. Sie hilft in unermüdlichem Einsatz Scheidungskindern, die sich nach Liebe sehnen und selbst fatale Fehler begangen haben. Dann wieder benötigen junge Mütter, die den Kontakt zu ihren Kindern verloren haben, dringend Unterstützung. Denise ist überall im Einsatz, wobei die Fälle langsam die Kräfte dieser großartigen Frau übersteigen. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch auf Denise ist Verlass. Der Sophienlust Bestseller darf als ein Höhepunkt dieser Erfolgsserie angesehen werden. Denise von Schoenecker ist eine Heldinnenfigur, die in diesen schönen Romanen so richtig zum Leben erwacht. Der große Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Zum erstenmal gab der weltbekannte René Monte in Stuttgart einen Konzertabend. Am Flügel saß ein schlanker jüngerer Mann. Eine Strähne seines dunkelblonden Haares fiel ihm in die hohe Stirn. Seine Augen wurden von einer dunklen Brille verdeckt. Trotz seiner Blindheit spielte er die Sonate Es-Dur op. 27 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven mit grandiosem Können und Einfühlungsvermögen. Hingerissen lauschten die Menschen im Saal dem Spiel des Künstlers. Denise von Schoenecker saß mit ihrem Mann Alexander in der ersten Reihe. Überwältigt griff sie nach seiner Hand. Die Finger ineinander verschlungen, saßen sie fast bewegungslos da, bis die letzten Töne verklangen. Kurze Zeit war es so still im Saal, daß man eine Stecknadel hätte fallen hören können, dann brach orkanartig der Beifall los. Der Pianist war aufgestanden und verbeugte sich. Eine junge Frau kam auf die Bühne und führte ihn durch eine Seitentür vom Podium. »Es war einfach wundervoll«, sagte Denise. Sie sah auf ihrem Mann, der noch immer auf das Podium starrte, obwohl dort nur noch der Konzertflügel zu sehen war. »Hallo, Liebster!« sagte sie und stieß ihn an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust (ab 351) – 395–
Ausweg aus der Dunkelheit
Du sollst nie wieder alleine sein!
Anne Alexander
Der große Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Zum erstenmal gab der weltbekannte René Monte in Stuttgart einen Konzertabend.
Am Flügel saß ein schlanker jüngerer Mann. Eine Strähne seines dunkelblonden Haares fiel ihm in die hohe Stirn. Seine Augen wurden von einer dunklen Brille verdeckt. Trotz seiner Blindheit spielte er die Sonate Es-Dur op. 27 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven mit grandiosem Können und Einfühlungsvermögen. Hingerissen lauschten die Menschen im Saal dem Spiel des Künstlers.
Denise von Schoenecker saß mit ihrem Mann Alexander in der ersten Reihe. Überwältigt griff sie nach seiner Hand. Die Finger ineinander verschlungen, saßen sie fast bewegungslos da, bis die letzten Töne verklangen.
Kurze Zeit war es so still im Saal, daß man eine Stecknadel hätte fallen hören können, dann brach orkanartig der Beifall los. Der Pianist war aufgestanden und verbeugte sich. Eine junge Frau kam auf die Bühne und führte ihn durch eine Seitentür vom Podium.
»Es war einfach wundervoll«, sagte Denise. Sie sah auf ihrem Mann, der noch immer auf das Podium starrte, obwohl dort nur noch der Konzertflügel zu sehen war. »Hallo, Liebster!« sagte sie und stieß ihn an. »Du kannst wohl noch nicht abschalten, aber es ist große Pause.« Sie stand auf.
Die meisten der Zuhörer strebten schon den Ausgängen zu, um sich zu erfrischen oder die Füße zu vertreten. Noch immer etwas abwesend hatte sich auch Alexander erhoben und seinen Arm um Denises Taille gelegt. Geschoben von anderen strebten auch sie aus dem Saal. Doch dann führte Alexander seine Frau nicht zur Bar, sondern nur aus dem Gedränge heraus. »Was ist?« fragte Denise leicht beunruhigt. »Du hast doch etwas?«
»Er nennt sich René Monte«, sagte er, »aber er erinnert mich stark an den Sohn Edwin Mosers. Kannst du dich noch auf ihn besinnen?«
»Edwin Moser? Natürlich, das war doch der Architekt, der vor sieben Jahren mit seiner Frau bei einem Schiffsunglück ums Leben kam, während sein Sohn bei uns die Ferien verbrachte. Wie hieß er doch gleich...«
»Reinhard. Obwohl er seitdem nichts mehr von sich hören ließ, habe ich mich noch oft an ihn und sein gutes Klavierspiel erinnert. Er studierte Musik.«
»Reinhard Moser«, sagte Denise nachdenklich, »ich weiß nicht recht... Das Alter könnte zwar stimmen. Soweit ich mich erinnere, war er damals dreiundzwanzig. Aber warum sollte er jetzt blind sein?«
»Wenn das Schicksal es will, kann es einen sehr schnell ins Unglück stürzen«, erwiderte Alexander ernst. »Es ist auch die Brille, die mich so unsicher macht. Eine Brille kann einen Menschen sehr stark verändern. Und doch glaube ich, daß René Monte in Wirklichkeit Reinhard Moser heißt. Es ist sicher auch kein Zufall, daß beide Namen dieselben Anfangsbuchstaben haben.«
»Ich glaube jetzt beinahe auch, daß du recht hast«, sagte Denise. »Ich schlage vor, wir gehen sofort in die Höhle des Löwen, in diesem Fall in seine Garderobe.«
Alexander lachte. »Liebling, du bist immer dieselbe, gleich mit Bravour voran! Aber diesmal geht’s nicht, in...« Er sah auf seine Armbanduhr. »In fünf Minuten ist die Pause zu Ende. Die Leute strömen schon in den Saal zurück. Wir können ihn erst nach der Vorstellung aufsuchen.«
Arm in Arm schlossen sie sich den anderen an. So mancher Blick folgte ihnen. Sie waren auch ein wirklich attraktives Paar. Denise trug ein schwarzes Chiffonkleid, an dessen Ausschnitt eine silberne Rose befestigt war. Ihr schwarzes Haar schimmerte im Licht der Lampen.
Nach dem letzten Teil des Konzertes verließen Denise und Alexander von Schoenecker bereits den Saal, noch ehe der Beifall verklungen war. Draußen bat Alexander einen Angestellten, dem Künstler René Monte seine Visitenkarte zu überreichen, auf die er ein paar Zeilen geschrieben hatte. Zusammen mit der Visitenkarte gab er dem Mann ein gutes Trinkgeld. »Ich bin in der Bar zu erreichen«, sagte er. Während der Angestellte davoneilte, ging Alexander mit seiner Frau zur Bar und bestellte zwei Cocktails.
»Ich bin gespannt, ob er sich noch an uns erinnert«, meinte Denise. »Wenn er es überhaupt ist.«
»Das wird sich bald herausstellen«, entgegnete Alexander.
Es dauerte nur kurze Zeit, da entdeckte Alexander den Boten, wie er sich an der Bar suchend umblickte. Er winkte, und der Mann kam auf ihn zu. »Der Maestro bittet Sie, ihn in seiner Garderobe aufzusuchen«, sagte er mit einer leichten Verbeugung. »Wenn Sie mir folgen würden...«
»Also habe ich recht behalten«, meinte Alexander zu seiner Frau, als sie in einen Gang einbogen, der zu den Räumen hinter der Bühne führte.
»Hier ist die Garderobe des Maestros.« Der Angestellte wies auf eine dunkle Tür.
Alexander bedankte sich. Auf sein Klopfen hörte man von drinnen ein Knurren. »Ruhe, Harras!« befahl eine weibliche Stimme. Die Tür wurde geöffnet. Vor ihnen stand eine junge Frau. »Von Schoenecker?« fragte sie, und, ohne auf Antwort zu warten, fuhr sie lebhaft fort: »Mein Bruder erwartet Sie bereits. Kommen Sie bitte herein!«
Von einer Couch erhob sich ein hagerer Mann. Er griff nach dem Halsband eine großen Labradors, der wieder knurrte. »Ruhig, Harras!« sagte René Monte mit weicher, klangvoller Stimme. »Es sind sehr gute Freunde, die uns besuchen.« Seine Augen blickten in die Richtung seiner Besucher, so daß diese im ersten Moment dachten, er würde sie doch sehen können. Aber als sie mit ausgestreckte Händen auf ihn zugingen, bemerkte er es nicht.
So ergriff Denise resolut seine rechte Hand und drückte sie herzhaft. »Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen«, sagte sie. »Ich wollte es erst gar nicht glauben, als Alexander meinte, Sie müßten mit Reinhard Moser identisch sein.«
»Der Reinhard Moser von damals existiert auch nicht mehr«, sagte der Pianist, und sein sensibler Mund verzog sich bitter. »Dieser Reinhard war voller Lebenslust, und seine Augen sahen alles Schöne in dieser Welt. Aber lassen wir das! Es überrascht mich, daß Sie mich nach all den Jahren wiedererkannt haben. Als mir Bianca Ihre Karte vorlas, habe ich mich sofort an Sie erinnert – und an die herrlichen Ferien, die ich auf Ihrem Gut Schoeneich verbrachte... Ich bin sehr unhöflich«, unterbrach er sich, »ich habe Ihnen noch nicht einmal Platz angeboten. Bitte, setzen Sie sich doch!«
Während sich die von Schoeneckers auf die Couch setzten, nahm er selbst auf dem Hocker Platz, der vor dem Frisierspiegel stand. Harras legte sich zu seinen Füßen, ließ aber kein Auge von den Besuchern.
»Meine Schwester Bianca hatten Sie ja damals nicht kennengelernt«, sagte Reinhard. »Sie lebte bei unserer gelähmten Großmutter. Sonst wäre sie höchstwahrscheinlich mit meinen Eltern gefahren und auch mit...« Er unterbrach sich abrupt und wandte den Kopf seiner um drei Jahre jüngeren Schwester zu, die einige Gegenstände in einen kleinen Koffer packte. »Bianca scheint in der Welt nur dazu bestimmt zu sein, immer wieder Hilfsbedürftigen beizustehen.« Seine Stimme klang wieder überaus bitter. »Ich komme mir oft als krasser Egoist vor, weil ich sie so in Anspruch nehme.«
»Du bist ein großer Dummkopf!« Bianca schloß energisch den Koffer. Sie ging zu ihrem Bruder und legte liebevoll ihren Arm um seinen Hals. Sie trug ihre braunen Haare kurzgeschnitten. Mit ihren blauen lustigen Augen erinnerte sie Alexander an Reinhard, wie er vor sieben Jahren gewesen war.
Lachend wandte sie sich an Denise und Alexander. »Mein Bruder übertreibt wie gewöhnlich. Es macht mir großen Spaß, ihn als Managerin zu betreuen. Das habe ich ihm schon hundertmal gesagt. Trotzdem beklagt er sich immer wieder.« Sie strich ihm zärtlich über das Haar.
»Du bist nicht nur meine Managerin, sondern ersetzt auch meine Augen«, meinte Reinhard, »wenn Harras nicht bei mir sein kann. Aber warum sitzen wir hier noch in der Garderobe? Wenn ich auch die Umgebung nicht sehen kann, so bezweifle ich doch, daß es hier gemütlich ist. Frau von Schoenecker, ich war damals Ihr Gast. Darf ich mich jetzt revanchieren und Sie einladen? Wir wohnen im Hotel ›Graf Zeppelin‹, das Restaurant dort ist ausgezeichnet.«
Alexander lachte. »Ich wollte Sie gerade bitten, unser Gast zu sein, aber wir nehmen auch gern Ihren Vorschlag an.«
Reinhard stand auf. »Dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren.«
Sie verließen die Liederhalle durch einen Seitenausgang, um den Fans auszuweichen, die vor dem Haupttor warteten.
Draußen wehte ein kalter Wind, obwohl es schon Anfang März war. Unwillkürlich zogen sie ihre Mantelkragen hoch, als sie zum Parkplatz gingen.
*
»Gute Nacht, mein Liebling«, sagte Gabriele Wagner am selben Abend und deckte ihren Jungen liebevoll zu, nachdem sie mit ihm gebetet hatte.
Der Siebenjährige richtete sich auf. »Bitte, Mutti, sing noch ein Lied«, bat er. »Das von den wilden Reitern!«
»Du willst doch bloß wieder die Schlafenszeit hinauszögern«, meinte Gabriele und strich sich die langen blonden Haare zurück. »Aber heute geht’s nicht. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Ich habe noch einiges aufzuarbeiten.«
»Seitdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, hast du noch weniger Zeit für mich«, beschwerte sich Manfred.
»Du hast schon recht, Freddy, aber durch deine Krankheit ist so viel liegengeblieben, und wir leben nun mal von meinem Schreibbüro. Ich wünschte, es wäre anders!«
»Immer die blöde Schreiberei!« schimpfte der Junge. »Als Papa noch lebte, war alles viel schöner.«
»Wem sagst du das!« Die junge Frau seufzte. Sie beugte sich über ihren Sohn und drückte ihm einen Kuß auf die Stirn. »Sei jetzt ein braver Junge und schlaf, ja?« Sie stand vom Bett auf, knipste die Nachttischlampe aus und verließ das Zimmer.
Gabriele stieg die Treppe zum Parterre hinunter, wo gegenüber vom Wohnzimmer ihr Arbeitsraum lag. Sie bewohnten in Bachenau ein kleines Haus, das ihnen die Schwiegereltern hinterlassen hatten. Es scheint ein Fluch auf diesem Haus zu liegen, dachte die junge Frau, als sie sich auf den Schreibtischstuhl setzte. Sie starrte auf den Stapel Papiere, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag und auf Erledigung wartete. Sie konnte sich einfach nicht auf die Arbeit konzentrieren.
Sie war nicht gern in dieses Haus gezogen. Ihre Schwiegereltern waren hier innerhalb eines Jahres gestorben. Ihr Mann hatte sie oft wegen ihres Aberglaubens ausgelacht. Und dann hatte er selbst vor drei Jahren einen tödlichen Herzanfall erlitten. Für Gabriele kam zu dem Schmerz um seinen Verlust noch die Sorge um das tägliche Leben. Außer dem Haus besaß sie nichts. Da Manfred von Geburt an ständig kränkelte, konnte sie nicht auswärts arbeiten gehen. So hatte sie sich mit einem Schreibbüro selbständig gemacht, doch der Verdienst war nicht gerade überwältigend.
Gabriele seufzte, während sie nach den Unterlagen griff und sich an die Schreibmaschine setzte. Diese Arbeit war besonders eilig, und sie würde die Hälfte der Nacht damit zu tun haben. An und für sich hatte sie es immer geschafft, auf dem laufenden zu bleiben. Aber dann hatte Manfred die Masern bekommen, und kaum war er wieder auf dem Posten gewesen, hatte er sich ein Bein gebrochen. Wegen seiner ständigen Krankheiten war er schon um ein Jahr von der Schule zurückgestellt worden. Als sie ihn vor zwei Tagen aus dem Krankenhaus abgeholt hatte, war ihr vom Arzt erklärt worden, daß sein Bein zwar gut geheilt wäre, aber seine Gesundheit zu wünschen übrig ließe und er sehr geschont werden müßte.
Und wer schont mich, fragte sich Gabriele, während sie mit der Arbeit anfing.
Sie gab den ständigen Aufregungen die Schuld an ihren Gallensteinen. Der Arzt hatte ihr dringend zu einer Operation geraten.
Sie versuchte, ihre Gedanken abzuschalten und sich aufs Schreiben zu konzentrieren, aber es gelang ihr nicht. Wieder ließ sie ihre Hände in den Schoß sinken. Ich sollte mich operieren lassen, dachte sie, aber ich kann doch den Jungen nicht wildfremden Menschen anvertrauen, und meine Kunden müßte ich mir dann auch wieder von neuem suchen.
Wieder glitten Gabrieles Hände über die Tastatur, als das Telefon klingelte. Die junge Frau sprang erstaunt auf, lief zum Schreibtisch und hob den Hörer ab.
»Klein!« meldete sich ihre Freundin Monika. »Verzeih bitte, Gaby, daß ich dich noch so spät störe, aber ich bin eben erst aus England zurückgekehrt. Und wie ich dich kenne, sitzt du sicherlich noch an deiner Arbeit.«
»Du hast recht. Durch Manfreds letzte Krankheit ist wieder soviel liegengeblieben.«
»Ist er denn noch immer im Krankenhaus?«
»Nein, vorgestern durfte ich ihn nach Hause holen, aber er braucht noch viel Schonung.«
»Das kann ich mir denken, wo er in der letzten Zeit ständig etwas hatte... Und wie geht es dir?«
»Nicht besonders gut. Du weißt, meine Galle. Dr. Schmieder hat mir zu einer Operation geraten, aber dazu habe ich einfach keine Zeit. Dann springen mir wieder die Kunden ab, und meinen Sohn kann ich doch auch nicht allein lassen.«
»Wenn du im Grab liegst, springen die Kunden auch ab«, erwiderte die Freundin sarkastisch, »und deinen Jungen mußt du dann für immer fremden Händen überlassen. Also tu lieber, was Dr. Schmieder sagt, er ist ein guter Arzt.«
»Du hast leicht reden«, meinte Gabriele.
»Ich weiß, daß das für dich ein schwerer Entschluß ist. Wenn ich könnte, würde ich Manfred aufnehmen. Er ist ja schon sieben und ein braver Junge. Aber du weißt, ich bin für meine Firma ständig unterwegs.«
»Auch wenn du das nicht wärst, würde Manfred den ganzen Tag allein sein, und das möchte ich nicht.«
»Dafür habe ich Verständnis. Aber du könntest ihn doch in ein Heim geben.«
»Nein, diese Heime sind doch so unpersönlich, und gerade Manfred braucht viel Liebe.«
»Ich wüßte eins, wo er das hätte«, sagte die Freundin. »Hast du schon einmal von Sophienlust gehört?«
»Natürlich, aber das kommt erst recht nicht in Frage. Soll das nicht ein Schloß sein? Was denkst du, was das kostet! Das kann ich mir nicht leisten.«
»Soviel ich gehört habe, liegt das Kinderheim in einem alten Herrensitz inmitten eines großen Parks. Es soll geradezu ein Paradies für Kinder sein. Wegen der Kosten würde ich mir keine Sorgen machen, schließlich bin ich auch noch da. Außerdem habe ich gehört, daß dort auch mittellose Kinder aufgenommen werden. Fahr doch mal hin und schau dir alles an!«
»Dein Vorschlag ist gar nicht so schlecht«, erwiderte Gabriele. »Aber vorher muß ich noch die Arbeit erledigen, die auf meinem Schreibtisch liegt. Sowie ich mich freimachen kann, werde ich mit Manfred zur Besichtigung nach Sophienlust fahren.«
»Laß dir nicht zuviel Zeit«, warnte die Freundin. »Du weißt, mit Gallensteinen ist nicht zu spaßen. Tschüs – und arbeite nicht wieder bis spät in die Nacht hinein!«
Es war Mitternacht, als Gabriele endlich fertig war. Bevor sie schlafen ging, sah sie noch einmal ins Kinderzimmer.
Bis zur Nasenspitze zugedeckt lag ihr kleiner Sohn im Bett und schlief fest. Zärtlich strich sie ihm über den braunen Schopf. Die Haare und seine blauen Augen hat er von seinem Vater, dachte sie. Gabriele hatte ihren Mann sehr geliebt und nach seinem Tod all ihre Liebe auf Manfred konzentriert. Er war ihr einziger Lebensinhalt. Es bedrückte sie, daß er so kränkelte und sie nicht mehr für ihn tun konnte.
Die junge Frau ging in ihr Schlafzimmer und schaute in den Spiegel. Noch hatte sie trotz ihrer neunundzwanzig Jahre eine schlanke Figur. Sie wußte, daß sie noch immer begehrenswert war, und sie mußte sich bei manchem ihrer Auftraggeber ihrer Haut wehren. Sie sehnte sich zwar wieder nach einem Mann an ihrer Seite, dem sie vertrauen konnte und der ein guter Vater für ihren Sohn wäre. Doch so einen Mann hatte sie noch nicht getroffen, und für banale Flirts hatte sie nichts übrig.
Ich werde wohl immer allein für alles sorgen müssen, dachte sie resignierend.
*
Denise und Alexander von Schoenecker verbrachten mit den Mosers einen überaus vergnügten Abend. Sie hatten im Restaurant des Hotels einen sehr gemütlichen Eckplatz gefunden. Mit Biancas Hilfe hatte Reinhard das Menü zusammengestellt. Zuerst gab es einen Spargelcocktail mit Mandarinen, dann Tomatensuppe, Seezungenröllchen ›Nizza‹ mit Toast, Butter und Kopfsalat auf Feinschmeckerart und zuletzt folgte ein Zimtparfait. Dazu tranken sie samtig roten Bordeaux.
»Ich kann nicht mehr«, verkündete Bianca seufzend. »Morgen muß ich bestimmt wieder einen Hungertag einlegen.«
»Bei mir schlägt ein sündiges Essen nicht so leicht an«, meinte Denise.
»Aber nur, weil du oft keine Zeit findest, regelmäßig zu essen, da dich die Sorge um Sophienlust ständig auf Trab hält«, meinte Alexander schmunzelnd.
»Sophienlust ist das Kinderheim, nicht wahr?« warf Reinhard ein.
»Ja«, erwiderte Denise.
»Frau von Schoenecker, Sie betreuen ein Kinderheim?« fragte Bianca erstaunt.
Denise lächelte. »So kann man es auch nennen«, erwiderte sie. »Eigentlich gehört es meinem Sohn Nick. Sophie von Wellentin, seine Urgroßmutter, hat es ihm hinterlassen. Ich verwalte es nur bis zu seiner Volljährigkeit.«
»Das ist doch auch eine wundervolle Aufgabe, sich um elternlose Kinder zu kümmern«, meinte die junge Frau schwärmerisch.
»Sehen Sie, Frau von Schoenecker, Bianca sucht schon wieder neue Schutzbedürftige«, witzelte ihr Bruder.
Denise lachte. »Das gefällt mir so sehr an Ihnen, Bianca, daß Sie ein Herz für andere haben. Im übrigen werden in unserem Heim nicht nur Waisen, sondern auch Kinder aus zerrütteten Ehe aufgenommen – oder Kinder, deren Eltern sich zur Zeit nicht um sie kümmern können.«
Der Kellner brachte den bestellten Sekt, entkorkte vorsichtig die Flasche und füllte die Kelche. Als er sich entfernt hatte, hob Alexander sein Glas. »Wollen wir auf die Zukunft anstoßen? Vor allem auf Ihre, lieber Reinhard!«
»Auf die Zukunft eines Blinden!« meinte Reinhard verbittert, als die anderen gegen sein Glas stießen.
»Auf die Zukunft eines begnadeten Künstlers«, widersprach Denise. »Außerdem...« Sie zögerte, weil sie den jungen Mann nicht verletzen wollte, dann aber fuhr sie beherzt fort: »Bitte verstehen Sie mich nicht falsch – ich weiß ja nicht, wie das geschehen konnte, aber vielleicht gibt es noch eine Hilfe.«