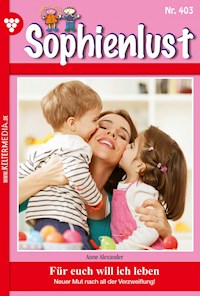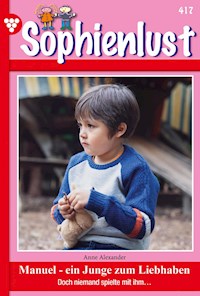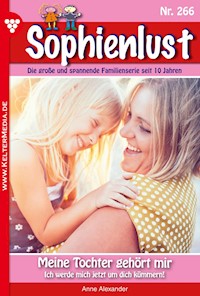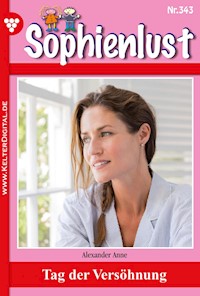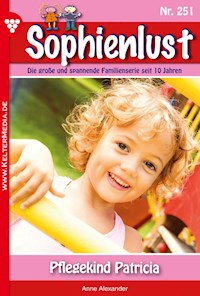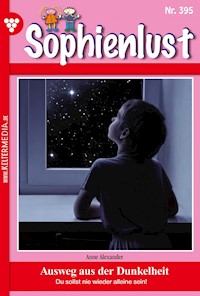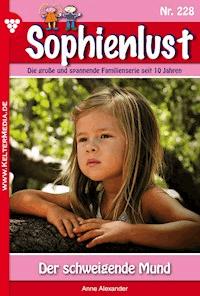Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. Auf Zehenspitzen schlich Viktoria Langenbach ins Zimmer zurück, warf einen kurzen Blick auf ihre schlafende Schwester, legte sich leise ins Bett und deckte sich bis zur Kinnspitze zu. Kurz darauf war auch sie wieder eingeschlafen. Zwei Stunden später war es mit der Ruhe im Kinderheim Sophienlust vorbei. Schwester Regine begann, die Kinder zu wecken. »Guten Morgen!« rief sie gutgelaunt ins Zimmer der Schwestern Langenbach. »Auf mit euch, ihr Langschläfer, sonst müßt ihr ohne Frühstück in die Schule!« Angelika gähnte und drehte sich zu ihrer Schwester um. »Vicky, aufwachen!« Viktoria rührte sich nicht. Noch immer bis zur Kinnspitze zugedeckt, schlief sie den Schlaf der Gerechten. Angelika stand auf. Sie wollte ihrer Schwester die Bettdecke mit einem Ruck herunterziehen. Schon griff sie danach, als sie mitten in der Bewegung erstarrte. Im nächsten Moment rannte sie bereits auf den Gang hinaus. »Was hast du denn?« fragte Angelika Dommin überrascht. Sie war auf dem Weg in den Waschraum. Vicky ist krank!« stieß Angelika hervor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 388 –Das Glück ließ lange auf sich warten
Unveröffentlichter Roman
Anne Alexander
Auf Zehenspitzen schlich Viktoria Langenbach ins Zimmer zurück, warf einen kurzen Blick auf ihre schlafende Schwester, legte sich leise ins Bett und deckte sich bis zur Kinnspitze zu. Kurz darauf war auch sie wieder eingeschlafen.
Zwei Stunden später war es mit der Ruhe im Kinderheim Sophienlust vorbei. Schwester Regine begann, die Kinder zu wecken. »Guten Morgen!« rief sie gutgelaunt ins Zimmer der Schwestern Langenbach. »Auf mit euch, ihr Langschläfer, sonst müßt ihr ohne Frühstück in die Schule!«
Angelika gähnte und drehte sich zu ihrer Schwester um. »Vicky, aufwachen!«
Viktoria rührte sich nicht. Noch immer bis zur Kinnspitze zugedeckt, schlief sie den Schlaf der Gerechten.
Angelika stand auf. Sie wollte ihrer Schwester die Bettdecke mit einem Ruck herunterziehen. Schon griff sie danach, als sie mitten in der Bewegung erstarrte. Im nächsten Moment rannte sie bereits auf den Gang hinaus.
»Was hast du denn?« fragte Angelika Dommin überrascht. Sie war auf dem Weg in den Waschraum.
Vicky ist krank!« stieß Angelika hervor. »Hast du Schwester Regine gesehen?«
»Sie ist bei den Kleinen«, erwiderte Pünktchen. »Gestern abend war Vicky doch noch völlig in Ordnung. Was hat sie denn?«
Angelika zuckte die Schultern. »Masern oder Scharlach oder etwas Ähnliches. Ihr ganzes Gesicht ist jedenfalls voller roter Punkte.«
»Heißt das, wir brauchen nicht zur Schule?« Fabian Schöller schaute das Mädchen fragend an. »Ich meine, wenn es was Ansteckendes ist, werden wir zu Hause bleiben müssen.«
Angelika antwortete nicht. »Schwester Regine!« rief sie und eilte weiter durch den Gang.
Schwester Regine, die neunundzwanzigjährige Krankenschwester des Heims, war gerade dabei, die kleine Karen Baumgartner anzuziehen, die während einer Reise ihrer Eltern in Sophienlust lebte.
»So, und jetzt noch die Söckchen«, sagte Regine und setzte das kleine Mädchen aufs Bett. Liebevoll streifte sie ihr ein Paar Ringelsöckchen über die Füße.
»Ich brauch niemand mehr, der mir beim Anziehen hilft«, erklärte Heidi Holsten stolz. »Ich bin schon groß!« Selbstbewußt streckte sie das Kinn vor.
Schwester Regine kam nicht dazu, ihr zu antworten, weil Angelika die Tür aufriß und rief. »Vicky ist krank!«
Schwester Regine richtete sich auf. »Ich komme gleich!« Sie stellte Karen auf den Boden. »Heidi, paß auf sie auf!« wandte sie sich an die Fünfjährige, bevor sie Angelika folgte.
Inzwischen war Vicky auch aufgewacht, aber nach einem kurzen Blinzeln hatte sie es vorgezogen, sich schlafend zu stellen. An den aufgeregten Stimmen, die vom Gang her zu ihr klangen, merkte sie, daß ihre Krankheit inzwischen entdeckt worden war.
Angelika betrat mit Schwester Regine den Raum. »Sie schläft noch immer«, stellte Angelika nach einem kurzen Blick auf Vickys Bett fest. »Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.«
»Bleib zurück, Kind! Schwester Regine trat an Viktorias Bett. »Sieht nach Röteln aus!« Sie beugte sich über das Mädchen und zog vorsichtig die Bettdecke herunter.
An Viktoria war eine kleine Schauspielerin verlorengegangen. Sie brachte es fertig, ruhig liegenzubleiben und nicht zu lachen, während Schwester Regine sie umdrehte. Plötzlich jedoch schlug sie die Augen auf. »Mir ist so übel«, flüsterte sie.
Schwester Regine legte eine Hand auf die Stirn der Zehnjährigen, im selben Moment fiel ihr Blick aufs Kopfkissen. »Seit wann ist es dir übel, Vicky?« fragte sie.
»Mir war es schon gestern abend nicht gut«, klagte das Mädchen. »Habe ich Fieber?«
»Das kann ich erst sagen, wenn ich deine Temperatur gemessen habe«, erwiderte die Kinderkrankenschwester und wandte sich um, weil jemand das Zimmer betrat. Es war Frau Rennert. »Wahrscheinlich wird man mit Vicky eine Spritzenkur machen müssen«, sagte sie und blinzelte der Heimleiterin zu.
»Warum?« fragte Vicky verwirrt und richtete sich auf.
»Kleine Mädchen, die im Gesicht so viele rote Flecke haben, daß sie sogar aufs Kopfkissen abfärben, kann man nur mit Spritzen kurieren«, antwortete Schwester Regine.
Viktoria starrte auf ihr Kopfkissen. Tatsächlich, es war rotgesprenkelt. Sehr erschrocken griff sie sich ins Gesicht.
»Heißt das, du hast dir die Flecke nur angemalt?« Angelika stürzte em-pört zum Bett ihrer Schwester.
Vicky senkte den Kopf. »Es tut mir leid«, sagte sie. »Es ist nur wegen der blöden Mathearbeit heute.« Sie schob die Unterlippe vor.
Angelika griff nach Vickys Schultern. »Und da machst du uns solche Angst?«
»Au!« schrie das Mädchen auf.
»Angelika, mach dich für die Schule fertig!« sagte Frau Rennert. »Und du, Vicky, ziehst dich jetzt auch an. Wir sprechen nachher darüber.« Sie lächelte Schwester Regine zu. »Kommen Sie, lassen wir unsere Schwerkranke allein.«
Die beiden Frauen verließen das Zimmer. Im Gang standen schon die meisten der Schulkinder und blickten gespannt auf Schwester Regine. »Pech gehabt, ihr müßt zur Schule«, erklärte sie. »Also, ab zum Frühstück!«
»Och!« kam es von Fabian.
»Seit wann gehst du denn nicht gern zur Schule?« erkundigte sich Frau Rennert.
»Wir schreiben heute eine Arbeit«, erwiderte der Elfjährige und zuckte die Schultern. »Da kann man nichts machen! Kommt, Leute!« Entschlossen marschierte er zur Treppe.
»Du bist vielleicht blöd!« schimpfte Angelika mit ihrer Schwester, während sie sich bemühte, ihr die roten Flecke abzureiben. »Malst dich einfach an.«
»Au!« Vicky wandte ihr Gesicht ab.
»Auch noch schreien?« Energisch rieb Angelika an einem Fleck. »Kannst du dir nicht denken, daß wir uns Sorgen machen, wenn du tust, als seist du krank? Du hattest mir einen richtigen Schreck engejagt.«
»Bestimmt kriege ich in Mathe eine Vier«, jammerte Vicky. »Dabei habe ich geübt, aber ich kapier’s nicht.«
»Das bildest du dir nur ein«, meinte Angelika etwas sanfter. »Schau Fabian an, der schreibt heute auch ’ne Arbeit, aber der würde nie auf die Idee kommen, krank zu spielen.«
Vicky grinste. »Es war schon eine blöde Idee«, gab sie zu. »Aber wenn die Flecke nicht abgefärbt hätten, hättet ihr nie was gemerkt.«
»Ganz sicher nicht«, meinte Angelika spöttisch. »Schwester Regine und Tante Ma warten nur darauf, sich von dir reinlegen zu lassen. Und selbst, wenn es dir wirklich gelungen wäre, Frau Dr. Frey hättest du nicht hinters Licht führen können.«
»An sie habe ich überhaupt nicht gedacht«, bekannte Vicky.
»Von Zeit zu Zeit solltest du eben deinen Verstand einsetzen«, erwiderte Angelika trocken. »So, jetzt kannst du dich wenigstens draußen sehen lassen.« Sie gab ihrer Schwester einen freundschaftlichen Klaps. »Geh dich waschen!«
Ohne Widerrede verließ Viktoria das gemeinsame Zimmer. Die Mathearbeit türmte sich wieder haushoch vor dem Kind auf. Sie sagte sich, daß es wohl besser gewesen wäre, nicht so zu übertreiben, sondern nur über Bauchschmerzen zu klagen. Bauchschmerzen waren etwas, was sich schlecht nachprüfen läßt. Seufzend trat sie in den Waschraum.
*
»Mama! Mama!« Rebekka Rhode stürmte im Schlafanzug die Treppe des Einfamilienhauses hinunter. »Mama, wo bist du?«
»In der Küche«, antwortete Gabriele Rhode. Sie war gerade dabei Brot zu schneiden.
»Mama, ich kann meinen Wuschel nicht finden!« Rebekka stieß die Küchentür auf. »Hast du ihn gesehen?«
»Nein, Liebes.«
»Hilfst du mir suchen?«
»Nach dem Frühstück«, erwiderte die Frau. Müde strich sie sich über die Stirn. Sie fühlte sich in den letzten Tagen morgens selten wohl.
»Aber ich brauche ihn doch!« Rebekka zog einen Schmollmund.
»Prinzeßchen, du hast gehört, daß die Mama jetzt keine Zeit hat«, sagte Daniel Rhode, als er die Küche betrat. »Solltest du nicht längst angezogen sein?« Scheinbar streng runzelte der Vater die Stirn. »Kleine Mädchen, die frühmorgens um sieben noch im Schlafanzug herumturnen, dürfen nicht in den Kindergarten.«
Rebekka eilte die Treppe wieder hinauf. Sie ging gern in den Kindergarten. Und an diesem Tag wollte sie auf keinen Fall fehlen. Ihre Freundin Sabine hatte Geburtstatg. »Bin gleich fertig!« rief sie von oben. Blitzschnell drehte sie sich im Kreis.
»Unser kleiner Wirbelwind!« Daniel Rhode ging in die Küche zurück. Besorgt sah er seine Frau an. »Fühlst du dich wieder nicht wohl, Gabi?« fragte er.
»Nur das Übliche.« Gabriele lächelte ihrem Mann zu. »Mache dir keine Sorgen.«
»Wann bist du wieder zum Arzt bestellt?«
»Morgen vormittag.« Gabriele nahm die Eier aus dem Wasser. »Kein Grund, sich aufzuregen, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Nur noch fünf Monate, und dann sind wir zu viert.«
Daniel Rhode stellte Kaffeekanne, Brotkorb, Butter, Honig und Konfitüre auf ein Tablett. »Ich kann es kaum noch erwarten, bis wir endlich unseren kleinen Benjamin haben«, gestand er.
»Und wenn es wieder ein Mädchen wird?« fragte die junge Frau.
Daniel atmete tief ein. »Dann werden wir es auch lieben«, erwiderte er. »Aber ich bin überzeugt, diemal bekommen wir einen Jungen.«
Besorgt blickte Gabriele ihrem Mann nach, als er das Tablett durch die Verbindungstür ins Eßzimmer trug. Daniel hatte sich immer einen Sohn gewünscht. Seine Frau hatte noch nicht seine Enttäuschung vergessen, als statt des erwarteten Stammhalters Rebekka auf die Welt gekommen war. Es hatte Wochen gedauert, bis er bereit gewesen war, die Kleine zu akzeptieren. Heute merkte man zwar nichts mehr davon, Daniel liebte Rebekka über alles, doch sie hatte Angst, ihn erneut zu enttäuschen.
Gabriele wollte gerade nach ihrer Tochter sehen, als das kleine Mädchen in Jeans und einem Sommerpullover die Treppe herunterkam. Unter dem Arm trug es Wuschel, einen schon etwas ramponierten Teddy.
»Na, da hast du ihn ja«, meinte die Mutter und nahm Rebekka am Fuß der Treppe in Empfang. »Wo war er denn?«
»Im Bad, auf der Wäschetruhe!« Rebekka setzte Wuschel auf eine Stufe und streckte die Ärmchen aus. »Trägst du mich, Mama?« fragte sie. »Bitte!«
»Kommt gar nicht in Frage, Prinzeßchen!« rief Daniel vom Eßzimmer her. »Du weißt, daß die Mama sich jetzt sehr schonen muß. Das Brüderchen soll doch gesund zur Welt kommen.«
»Ich will kein Brüderchen!« Rebekka bückte sich nach Wuschel, nahm ihn auf und marschierte an ihrer Mutter vorbei ins Eßzimmer.
»Rebekka, du solltest alt genug sein, um auch einmal an andere zu denken«, sagte der Vater erregt. Gabriele legte beschwichtigend ihre Hand auf seinen Arm, doch er beachtete es nicht. »Mama und ich wünschen uns nun einmal noch einen kleinen Sohn. Denke an Sabines Brüderchen.«
»Er macht immer alles kaputt!« entgegnete Rebekka spontan. »Sie kann den Martin gar nicht leiden… Und ich auch nicht.«
»Sie ist doch erst fünf«, raunte Gabriele ihrem Mann zu, als sie die Zornfalten auf seiner Stirn bemerkte. Sanft strich sie darüber.
»Fünfeinhalb«, erklärte Daniel, dann lachte er. »Da steht uns ja noch ein schweres Stück Arbeit bevor, wenn Rebekka ihren Bruder nicht nur akzeptieren, sondern auch lieben soll.«
»Laß ihn erst mal da sein, vielleicht gibt sich dann alles von selbst«, meinte Gabriele. »Gehen wir frühstücken.«
Daniel legte den Arm um die Taille seiner Frau und führte sie zum Tisch.
Rebekka hatte sich bereits gesetzt. Daniel nahm ein Kissen, hob seine Tochter hoch, und schob es ihr unter. »So ist es besser, Prinzeßchen«, meinte er.
»Danke«, antwortete die Kleine wohlerzogen.
Gabriele schenkte für sich und ihren Mann Kaffee ein. Vor Rebekka stand ein Becher mit Schokolade. »Honig oder Konfitüre, Liebes?« fragte die Mutter.
»Beides!«
»Zusammen schmeckt es nicht, ich werde dir zwei kleine Brote machen«, sagte Gabriele. Sie wandte sich an Daniel, während sie die Schnitten für Rebekka zurechtmachte. »Fährst du heute mittag bei Frau Singer vorbei? Sie hat wieder Arbeit für mich.«
»Es ist durchaus nicht nötig, daß du arbeitest«, erklärte Daniel. »Ich verdiene genug, um uns ein schönes Leben zu ermöglichen. Willst du nicht wenigstens jetzt diese Schreiberei aufgeben?«
»Aber es macht mir doch Spaß, ab und zu auch noch etwas anderes als den Haushalt zu tun«, entgegnete die Schwangere. »Außerdem habe ich gern etwas eigenes Geld.«
»Um uns dann davon zu beschenken.« Daniel blickte erst seine Frau, dann seine Tochter an. Wie ähnlich sich die beiden sahen. Rebekka hatte die braunen Locken und die Augen von Gabriele geerbt. Seine Augen waren zwar auch braun, doch sie hatten einen ganz anderen Ausdruck. Wieder einmal wurde ihm bewußt, wie sehr er Gabriele und das Kind liebte. Manchmal kam es ihm vor, als sei er einer der glücklichsten Menschen auf der Welt.
»An was denkst du?« fragte seine Frau und lächelte. »Du siehst aus wie eine Katze, die gerade am Rahmtopf geschleckt hat.«
Daniel lachte ebenfalls. »Ich dachte über euch nach«, gestand er und sah ihr dabei zärtlich in die Augen. »Ich würde mit keinem Millionär tauschen wollen, Liebling.«
»Ich auch nicht«, erwiderte Gabriele ernst.
»Fertig!« Rebekka rutschte vom Stuhl.
Daniel Rhode blickte auf seine Armbanduhr. »Es wird Zeit, die Arbeit ruft! Um acht Uhr muß ich im Büro sein.« Er stand auf.
»Ich hole nur noch meine Jacke, Papa!« rief Rebekka und rannte aus dem Zimmer.
Auch die Mutter stand auf, ging in die Küche und kam Minuten später mit Rebekkas Kindergartentäschchen zurück. »Hoffentlich bringt sie das Brot nicht wieder mit nach Hause«, sagte sie zu ihrem Mann. »Fräulein Wolters sollte mehr darauf achten, daß die Kinder ihr Vesper auch essen.«
»Beim nächsten Elternabend könnten wir es ja zur Sprache bringen.« Daniel griff zu seiner Aktenmappe. »Rebekka, wo bleibst du denn?« Er ging mit seiner Frau zur Haustür.
»Komme schon!« Das kleine Mädchen rannte die Treppe hinunter und merkte nicht, wie aus der Jacke, die es unter den Arm geklemmt hatte, eine Glaskugel fiel und auf dem Läufer liegenblieb.
»Wiedersehn, ihr beiden«, sagte Gabriele und küßte erst ihren Mann, dann Rebekka.
»Bis heute mittag.« Daniel berührte Gabrieles Wange.
»Tschüs, Mama.« Die Tochter stürzte aus dem Haus.
Gabriele wartete, bis beide im Wagen saßen, dann erst schloß sie die Haustür und kehrte ins Eßzimmer zurück. Bevor sie mit der Hausarbeit begann, wollte sie noch die Zeitung lesen.
*
»Und dann kam der große böse Wolf und fraß die Großmutter auf«, erzählte Anna ihrer Lieblingspuppe. »Und die Großmutter konnte das arme Rotkäppchen nie mehr hauen und auch nie mehr mit ihr schimpfen!«
»Sag’ mal, was erzählst du denn da, Anna?« fragte Sylvia Beck. Die Stimme ihrer vierjährigen Tochter war so laut gewesen, daß die Mutter in das Kinderzimmer gegangen war.
»Tina wollte ein Märchen hören«, erwiderte die Kleine und drückte ihre Puppe an sich. »Tina hört gerne Märchen.«
»Vor allen Dingen wahrscheinlich solche«, meinte die Frau spöttisch und strich sich mit einer fahrigen Bewegung durch ihre schulterlangen, blonden Haare. »Laß so etwas nie die Oma hören, Anna.«
»Warum nicht?« Das Mädchen griff in den Bund ihrer blauen Jeans und zog sie hoch.
»Weil sie dann sehr böse wäre«, erwiderte Sylvia.
»Sie ist immer böse«, erklärte die Kleine. »Sie mag mich überhaupt nicht.«
»Ach, das bildest du dir nur ein, Anna«, sagte die Mutter. »Alle Großmütter haben ihre Enkel gern.« Sie wußte zwar nur zu gut, daß ihre Mutter auf keinen Fall zu diesen Großmüttern gehörte, aber sie machte sich selbst gern etwas vor.
»Ich hab’ Hunger, Mutti.« Anna setzte ihre Puppe in den Wagen.
»Die Oma hat das Frühstück noch nicht fertig, wir müssen noch etwas warten.« Sylvia begann, Annas Bett zu machen. »Lauf in den Garten und spiele dort noch etwas.«
»Gut«, antwortete ihre Tochter ergeben und wollte das Zimmer verlassen.
»Halt, ich muß dich ja erst noch kämmen.« Sylvia Beck griff nach einem Kamm. Sorgfältig scheitelte sie Annas kurze, blonde Haare. »Sollen wir deine Haare mal wachsen lassen, was meinst du?«
»Oh, ja.« Anna strahlte. »Aber die Oma wird schimpfen.«
»Lassen wir sie schimpfen, mein Kind, du bist meine Tochter.«
Sylvia nahm das Mädchen von hinten bei den Schultern und schob es durch die Tür. »So, und nun lauf.«
Anna ging sehr leise durch den Korridor und polterte auch nicht die Treppe hinunter. Obwohl sie erst vier war, wußte sie sehr gut, daß es besser war, jeden Krach im Haus zu vermeiden. Von der Küche her hörte sie ihre Großmutter mit den Töpfen klappern. Der appetitliche Duft frischer Brötchen stieg ihr in die Nase.
Vorsichtig schlich das kleine Mädchen an der Küche vorbei zum Eßzimmer. Auf dem Tisch sah sie einen Korb mit Brötchen. Das Wasser lief Anna im Mund zusammen. Das Kind wollte nicht auffallen, wenn es jetzt schon ein Brötchen nahm. Es waren ja so viele im Korb.
Die Kleine blickte sich um. Von ihrer Großmutter war nichts zu sehen. Anna rannte ins Eßzimmer und langte zum Korb. Schon umfaßten ihre Finger ein Brötchen.
»Habe ich dich mal wieder beim Stehlen erwischt.«
Vor Schreck ließ Anna das Brötchen fallen und drehte sich um. »Ich habe solchen Hunger, Oma«, sagte sie und blickte ängstlich zu der Frau auf, die vor ihr stand.
»Gegessen wird, wenn wir alle am Tisch sitzen!« schimpfte Renate Beck. Ihre frühzeitig ergrauten Haare hatte sie zu einem festen Knoten zusammengebunden, der ihre herben Züge noch unterstrich.
Anna wandte sich wieder halb dem Tisch zu und schielte nach dem Brötchen, das jetzt neben dem Brotkorb lag. »Wann essen wir denn?«
»In fünfzehn Minuten«, erwiderte die Großmutter. »Gehe bitte spielen, deine Mutter wird dich dann schon rufen.«
Anna gab keine Antwort. Mit gesenktem Kopf marschierte sie aus dem Eßzimmer, erst im Korridor begann sie zu rennen. Sie riß die Haustür auf und hopste die Eingangstufen hinunter. Als sie den Weg erreicht hatte, fiel ihr Blick auf das Erdbeerbeet mit seinen leuchtend roten Früchten. Ver-gnügt machte sie sich darüber her.
Sylvia Beck hatte inzwischen Annas Zimmer aufgeräumt. Die Frau ging in die Küche hinunter, in der ihre Mutter gerade Kaffee aufbrühte. »Kann ich noch etwas helfen?« fragte sie.
»Danke, ich bin fertig.« Renate Beck reichte ihr die Kaffeekanne. »Als ich vorhin ins Eßzimmer kam, war deine Tochter damit beschäftigt, ein Brötchen zu klauen.«
»Sie hat Hunger, es ist ja auch schon reichlich spät.« Demonstrativ blickte Sylvia auf die Küchenuhr. Es war fast zehn Uhr.