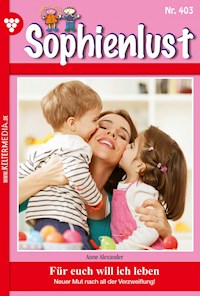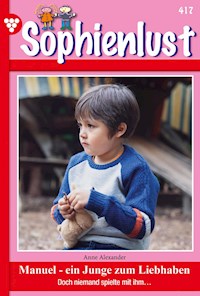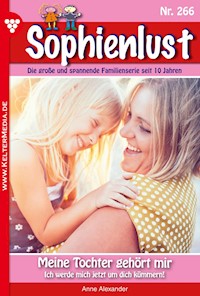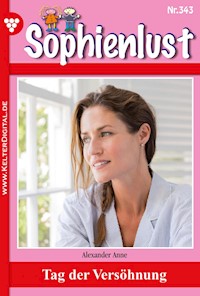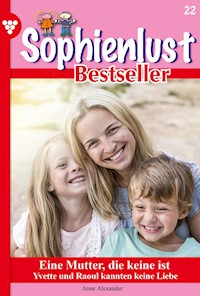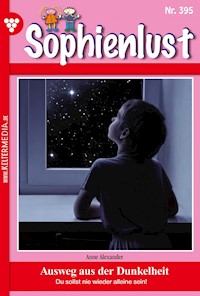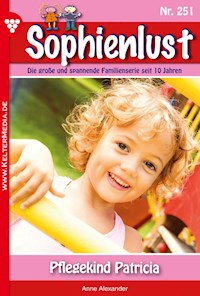
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Du fängst mich doch nicht!«, rief Heidi und rannte vor Pünktchen davon, die gerade aus dem Herrenhaus kam, in dem das Kinderheim Sophienlust untergebracht war. »Ich bin viel schneller als du!« »Na warte!«, rief die dreizehnjährige Angelina Dommin, genannt Pünktchen, der Kleinen nach. Im Laufen strich sie ihre blonden Haare zurück, die ihr immer wieder in die Stirn fielen. »Nein, du fängst mich nicht!« Heidi jagte durch den Park von Sophienlust. Fangen spielte sie für ihr Leben gern, und sie vergaß dabei oft, dass es nur ein Spiel war. »Gleich habe ich dich!« Pünktchen war nur noch wenige Meter von Heidi entfernt, da passierte es. Das fünfjährige Mädchen stolperte plötzlich über eine aus der Erde herausragende Wurzel und fiel der Länge nach hin. »Au!«, schrie Heidi, mehr erschrocken als vor Schmerz, auf. »Heidi, hast du dir wehgetan?« Mit wenigen Schritten war Pünktchen bei der Kleinen und hockte sich neben sie ins Gras. »Kannst du aufstehen?« »Meine Knie«, jammerte Heidi und zeigte mit kläglicher Miene auf ihre aufgeschrammten Knie. »Und meine Hände auch!« Sie verzog ihr Gesicht. Ihre blauen Augen füllten sich jetzt mit Tränen. »Aber wer wird denn weinen, Heidi?«, fragte Pünktchen mitleidig. Sie zog ein sauberes Taschentuch aus ihren abgetragenen Jeans und säuberte Heidis Händchen. »Wetten, dass Magda ein paar Plätzchen darauflegen wird?« Sie lächelte der Kleinen ermutigend zu. »Und meine Knie?«, fragte Heidi. »Wird sie darauf auch Plätzchen legen?« Sie legte das blonde Köpfchen schief. »Ganz sicher«, sagte Pünktchen, »aber Schwester Regine muss auch Hansaplast auf deine Knie kleben.« »Und Jod?«, fragte Heidi ängstlich. »Ich glaube schon«, entgegnete Pünktchen. »Mal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 251 –Pflegekind Patricia
Die kleine Pat wird endlich wieder froh
Anne Alexander
»Du fängst mich doch nicht!«, rief Heidi und rannte vor Pünktchen davon, die gerade aus dem Herrenhaus kam, in dem das Kinderheim Sophienlust untergebracht war. »Ich bin viel schneller als du!«
»Na warte!«, rief die dreizehnjährige Angelina Dommin, genannt Pünktchen, der Kleinen nach. Im Laufen strich sie ihre blonden Haare zurück, die ihr immer wieder in die Stirn fielen.
»Nein, du fängst mich nicht!« Heidi jagte durch den Park von Sophienlust. Fangen spielte sie für ihr Leben gern, und sie vergaß dabei oft, dass es nur ein Spiel war.
»Gleich habe ich dich!«
Pünktchen war nur noch wenige Meter von Heidi entfernt, da passierte es. Das fünfjährige Mädchen stolperte plötzlich über eine aus der Erde herausragende Wurzel und fiel der Länge nach hin.
»Au!«, schrie Heidi, mehr erschrocken als vor Schmerz, auf.
»Heidi, hast du dir wehgetan?« Mit wenigen Schritten war Pünktchen bei der Kleinen und hockte sich neben sie ins Gras. »Kannst du aufstehen?«
»Meine Knie«, jammerte Heidi und zeigte mit kläglicher Miene auf ihre aufgeschrammten Knie. »Und meine Hände auch!« Sie verzog ihr Gesicht. Ihre blauen Augen füllten sich jetzt mit Tränen.
»Aber wer wird denn weinen, Heidi?«, fragte Pünktchen mitleidig. Sie zog ein sauberes Taschentuch aus ihren abgetragenen Jeans und säuberte Heidis Händchen. »Wetten, dass Magda ein paar Plätzchen darauflegen wird?« Sie lächelte der Kleinen ermutigend zu.
»Und meine Knie?«, fragte Heidi. »Wird sie darauf auch Plätzchen legen?« Sie legte das blonde Köpfchen schief.
»Ganz sicher«, sagte Pünktchen, »aber Schwester Regine muss auch Hansaplast auf deine Knie kleben.«
»Und Jod?«, fragte Heidi ängstlich.
»Ich glaube schon«, entgegnete Pünktchen. »Mal sehen, ob du laufen kannst.« Sie stand auf und reichte Heidi ihre Hand. Sanft zog sie die Fünfjährige hoch.
»Laufen kann ich schon«, sagte Heidi und fügte hinzu: »Vielleicht muss gar kein Jod drauf.« An Pünktchens Hand humpelte sie zum Hauptgebäude des Kinderheimes zurück.
»Bist du hingefallen, Heidi?«, fragte Fabian Schöller, der den beiden in der großen Halle begegnete. »Ist es sehr schlimm?«
»Nein, Schwester Regine muss bestimmt kein Jod drauftun«, behauptete Heidi zuerst kopfschüttelnd, dann nickend.
Pünktchen blinzelte Fabian zu. Der schmächtige Junge grinste. »Bis du heiratest, ist schon alles wieder heil«, meinte er.
»Ich heirate aber nicht«, sagte Heidi. »Ich bleibe immer in Sophienlust.«
»Ich bringe Heidi ins Erste-Hilfe-Zimmer, Fabian. Kannst du Schwester Regine rufen?«, bat Pünktchen den Elfjährigen.
»Wird gemacht!« Wie der Wind lief Fabian die Treppe zum ersten Stock empor. Er hatte dort erst vor fünf Minuten die Kinder- und Krankenschwester zum Privatzimmer Denise von Schoeneckers gehen sehen.
»Schwester Regine!«, rief der Junge durch den Gang, von dem rechts und links die Türen zu den Schlafzimmern und Nebenräumen abzweigten. Als die Schwester nicht gleich antwortete, klopfte er an die Tür von Denises Zimmer.
»Bitte!«, rief Denise von Schoenecker.
Fabian trat ein. »Schwester Regine, Heidi ist hingefallen und hat sich die Knie aufgeschlagen. Pünktchen hat sie ins Erste-Hilfe-Zimmer gebracht.«
Schwester Regine, eine hübsche junge Frau, stand auf. Entschuldigend schaute sie Denise von Schoenecker an. »Ich bin gleich wieder da, Frau von Schoenecker«, versprach sie.
»Lassen Sie sich nur Zeit, Schwester Regine«, entgegnete Denise freundlich. »Die Kinder gehen vor. Würde ich nicht auf einen Anruf warten müssen, würde ich mitkommen.«
Gefolgt von Fabian ging Schwester Regine ins Erste-Hilfe-Zimmer. Pünktchen hatte Heidi inzwischen auf die Untersuchungsliege gehoben. Ängstlich schaute das kleine Mädchen der jungen Schwester entgegen.
»Na, was machst du denn für Sachen, Heidi?«, fragte Schwester Regine und strich der Kleinen liebevoll über die blonden Haare. Eines von Heidis Rattenschwänzchen hatte sich gelöst.
»Ich bin hingefallen«, sagte Heidi. Stolz fügte sie hinzu: »Ich kann viel schneller laufen als Pünktchen. Wäre ich nicht hingefallen, dann hätte sie mich in hundert Jahren nicht eingeholt.«
»In hundert Jahren wäre ich hundertdreizehn«, sagte Pünktchen lachend. »Ich glaube nicht, dass ich dir dann noch nachlaufen würde.«
»Und ich wäre hundertfünf Jahre alt«, verkündete Heidi stolz. »Au!«, schrie sie auf, als Schwester Regine ihre Knie säuberte.
»Tut das wirklich weh, Heidi?«, fragte die junge Frau skeptisch, denn sie hatte die Knie kaum berührt.
»Ein ganz kleines bisschen«, sagte das kleine Mädchen. Ängstlich beobachtete es, dass die Kinder- und Krankenschwester die Flasche mit der Jodtinktur vom Regal nahm. »Nicht Jod!«
»Dieses Jod brennt nicht«, versicherte Schwester Regine und betupfte vorsichtig die aufgeschrammten Knie mit einer dunkelroten Flüssigkeit. »Na, was habe ich gesagt?«
»Es brennt nicht«, bestätigte Heidi froh. »Du, Schwester Regine, machst du mir einen richtigen Verband um die Knie, nicht nur ein Pflaster?«
»Wie du willst, Heidi!« Schwester Regine griff nach einem Verbandpäckchen. Geschickt umwickelte sie Heidis Knie. »So, fertig!«, sagte sie, nachdem sie auch das zweite Knie verarztet hatte. Sie hob die Kleine von der Liege.
Etwas steifbeinig machte Heidi einige Schritte. Stolz blickte sie auf ihre verbundenen Knie. »Und jetzt gehe ich zu Magda!«
Heidi kam nicht sehr weit. Gerade als sie durch die Halle zur Küche laufen wollte, sah sie Denise von Schoenecker die Treppe herunterkommen. »Tante Isi, ich bin hingefallen!«, rief sie und blieb am Fuße der Treppe stehen.
Ein Lächeln huschte über Denises Gesicht, als sie Heidis dick verbundene Knie sah. Heidis strahlende Augen verrieten ihr, dass sich die Kleine nicht ernstlich verletzt hatte, sondern nur sehr stolz auf die Verbände war.
»Du bist ein richtiger Wildfang«, sagte Denise.
»Kommst du mit zu Magda, Tante Isi?«, fragte Heidi. »Ich hole mir Plätzchen.«
»Ich habe leider keine Zeit, Heidi.« Denise legte einen Arm um die rundlichen Schultern des kleinen Mädchens. »Ich muss etwas Wichtiges mit Frau Rennert besprechen.«
»Kommt ein neues Kind?«, forschte Heidi. »Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ist er älter als ich?«
»So viele Fragen auf einmal!« Denise lachte. Zärtlich drückte sie Heidi an sich. »Ja, es kommt ein neues Kind«, sagte sie. »Ein kleiner Junge. Er ist nur ein Jahr älter als du und geht noch nicht zur Schule. Er …«
»Dann kann er immer mit mir spielen«, unterbrach Heidi sie eifrig.
»Ich wollte dich gerade bitten, dich seiner etwas anzunehmen, Heidi«, sagte Denise. »Schau, seine Mutter muss ins Krankenhaus, und er ist darüber sehr traurig. Er kommt nicht gern nach Sophienlust.«
»Hier wird er bestimmt fröhlich werden, Tante Isi«, meinte Fabian zuversichtlich, der sich mit Pünktchen zu den beiden gesellt hatte. »In Sophienlust wird jedes Kind fröhlich.«
»Ich möchte auch nie woanders sein«, versicherte Pünktchen. Sie ergriff Heidis Hand. »Jetzt gehen wir alle in die Küche.«
»Ihr dürft auch ein paar Plätzchen haben«, erklärte Heidi großzügig, »auch wenn ihr nicht hingefallen seid.«
Sinnend schaute Denise von Schoenecker den drei Kindern nach. Jedes von ihnen hatte Schweres mitmachen müssen, bevor es nach Sophienlust gekommen war. Alle drei Kinder waren Vollwaisen. Heidi Holsten, das jüngste der Dauerkinder von Sophienlust, hatte ihre Eltern auf eine besonders tragische Weise verloren.
Ihr Vater war Morphinist gewesen und hatte seine Frau erschossen, als diese sich geweigert hatte, ihm aus ihrer Apotheke Morphium zu geben. Er selbst war dann bei seiner Flucht von der Polizei tödlich verunglückt. Pünktchen hatte ihre Eltern bei einem Zirkusbrand verloren, und Fabians Eltern waren bei einem Zugunglück ums Leben gekommen.
Leise seufzte Denise von Schoenecker auf, bevor sie in das Empfangszimmer ging, in dem Frau Rennert, die mütterliche Heimleiterin von Sophienlust, ihr Büro hatte.
*
»Mutti, Mutti, ein Telegramm!«, rief Henrik von Schoenecker, Denise und Alexander von Schoeneckers neunjähriger Sohn. Aufgeregt schwenkte er den gelblichbraunen Umschlag in seiner rechten Hand. »Der Postbote hat es mir gerade gegeben.«
Denise runzelte die Stirn. Gewöhnlich verhieß ein Telegramm nichts Gutes. Sie nahm ihrem Sohn den Umschlag ab.
»Was steht in dem Telegramm?«, fragte Henrik neugierig.
»Ich muss es erst einmal öffnen«, sagte die Gutsbesitzerin und griff nach dem Brieföffner.
»Vielleicht bekommen wir Besuch«, überlegte Henrik laut. Er warf sich in einen Sessel. »Lies schon vor, Mutti!«
»Da gibt es nicht viel vorzulesen«, sagte Denise von Schoenecker bestürzt. Noch einmal las sie die wenigen Zeilen. Sie konnte es nicht fassen. Noch vor einer Woche hatten sie einen Brief von den Randows aus Kenia erhalten.
Denise ließ das Telegramm sinken. Verstohlen wischte sie sich über die Augen.
»Mutti, was ist?«, fragte Henrik erschrocken. »Weinst du?« Er sprang auf und lief zu seiner Mutter.
»Nein, ich weine nicht, Henrik«, sagte Denise und schluckte. Sie strich ihrem Sohn über den braunen Schopf. »Wo ist Vati? Weißt du das zufällig?«
»Bei den Pferden«, entgegnete der Junge. »Soll ich ihn holen?«
»Ja, bitte!«
»Gut, Mutti!« Henrik lief zur Tür. Bevor er sie aufklinkte, drehte er sich noch einmal um. »Ist etwas Schlimmes passiert, Mutti? Ich meine, weil du so komisch aussiehst.«
Denise nickte. »Es ist etwas Schlimmes passiert, Henrik«, sagte sie. »Freunde von Vati und mir sind tödlich verunglückt.«
»Oh!«, stieß Henrik hervor. Leise öffnete er die Tür und schlüpfte in die Halle des Gutshauses.
Wieder und wieder las Denise das Telegramm. Alexander und sie hatten Maria und Gerhard Randow vor acht Jahren kennengelernt. Damals hatten die Randows sich gerade darauf vorbereitet, nach Kenia zu gehen, wo Gerhard Randow die Leitung einer Maschinenfabrik übernehmen sollte. In Kenia war auch das jetzt fünfjährige Töchterchen der beiden, Patricia, geboren worden.
Denise stand auf und ging zu einem gegenüber dem Fenster stehenden altdeutschen Schrank. Sie entnahm ihm ein dickes Fotoalbum. Es war etwa ein halbes Jahr her, dass die Randows ihr ein Foto von Patricia geschickt hatten.
Denise legte das Album auf den Schreibtisch und schlug es auf. Lange blickte sie auf das Bild der kleinen Patricia.
Es zeigte ein Mädchen von etwa viereinhalb Jahren mit modisch geschnittenen blonden Haaren. Es trug ein gelbes Kleid mit kurzen Flügelärmeln und darunter einen langärmeligen weißen Pullover. Liebevoll blickte es auf einen weißen Kater, den es in den Armen hielt.
Alexander von Schoenecker und sein Stiefsohn Nick betraten fast gleichzeitig das Zimmer. Beide trugen dunkle Reithosen und graue Pullover. Henrik drängte sich an ihnen vorbei. »Ich habe Vati geholt, Mutti«, sagte er völlig überflüssigerweise.
»Henrik sagte uns, dass Freunde von dir und mir tödlich verunglückt seien«, meinte Alexander mit belegter Stimme. Er sah das aufgeschlagene Fotoalbum vor seiner Frau liegen und warf einen Blick auf Patricias Bild. »Doch nicht etwa die Randows?«
»Doch, die Randows«, erwiderte Denise niedergeschlagen. Sie reichte ihrem Mann das Telegramm.
»Wie ist es denn passiert, Mutti?«, fragte Dominik von Wellentin-Schoenecker, der von allen nur Nick genannt wurde.
»Das geht aus dem Telegramm nicht hervor«, antwortete Alexander anstelle seiner Frau. Er reichte Nick das Telegramm. An seine Frau gewandt, sagte er: »Ich werde mich sofort mit der deutschen Botschaft in Nairobi in Verbindung setzen.«
»Das Telegramm hat ein Herr Kisunu abgeschickt«, sagte Nick. »Hat Herr Randow in seinem letzten Brief nicht von ihm gesprochen?«
»Doch, natürlich, Nick«, meinte Denise. Bewundernd fügte sie hinzu: »Du hast ein Gedächtnis!« Sie überlegte. »Wenn ich mich recht erinnere, ist Herr Kisunu seine rechte Hand.«
»Gut, dann werde ich auch Herrn Kisunu anrufen«, sagte Alexander. »Vor allen Dingen müssen wir wissen, was mit Patricia geschieht.«
»Holst du Patricia nach Sophienlust, Mutti?«, fragte Henrik.
»Wir werden sehen, Henrik«, antwortete Denise. »Wir wissen ja nicht einmal, ob Patricia noch Verwandte hat, die sie bei sich aufnehmen könnten.«
»Ich glaube nicht, dass Verwandte vorhanden sind«, warf Alexander ein. »Maria und Gerhard haben nie von irgendwelchen Verwandten gesprochen.« Er griff zum Telefonhörer und wählte die Nummer der Auslandsvermittlung.
*
Ursula Eschenbach stand in der Tür des Kinderzimmers und blickte in den unbewohnten Raum. Höhnisch schien sie die bunte Märchentapete anzustarren, als sie über den weichen Teppich lief und die weißen Vorhänge beiseite zog, um die Fenster zu öffnen. Jeden Tag ging sie ins Kinderzimmer und lüftete es. Alles war so geblieben, wie es vor einem Jahr gewesen war, vor einem Jahr, als Evchen noch gelebt hatte.
Schluchzend sank Ursula auf das Kinderbett, das sie erst vor zwei Tagen frisch bezogen hatte. Es waren Evchens Lieblingsbezüge, die mit dem Sandmännchen.
Ursula hob den Kopf. Ihr Blick fiel auf den Bücherschrank. In dessen untersten Regalen lagen Evas Bilderbücher, darüber die Bücher, aus denen sie der Kleinen immer vorgelesen hatte. Im obersten Fach stand der Kasettenrekorder, daneben der Kasten mit den Märchenkassetten.
»Uschi, quäle dich doch nicht so«, sagte eine Stimme von der Tür her. Ein Mann von etwa zweiunddreißig Jahren mit braunen Haaren und braunen Augen stand auf der Schwelle und blickte besorgt auf die junge Frau. Das Leben der beiden war wie ein Märchen verlaufen – bis zu dem Tag, an dem Evchen überfahren worden war.
»Ich war es, ich, die Evchen getötet hat«, schluchzte Ursula Eschenbach. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen.
Fürsorglich legte Klaus Eschenbach seinen Arm um die Schultern seiner um zwei Jahre jüngeren Frau. Fest drückte er sie an sich. »Du hast Evchen nicht getötet, Uschi«, sagte er mit sanfter Stimme. »Es war alles eine Verkettung unglücklicher Umstände.«
»Nein, nein, das kannst du mir nicht einreden!« Ursula hob ihren Kopf. »Wäre ich an diesem Tag nicht zum Friseur gegangen, hätte ich Evchen rechtzeitig vom Kindergarten abholen können. Dann würde sie heute noch leben.«
»Wie hättest du wissen sollen, dass deine Uhr stehen bleiben würde?«, fragte Klaus. »Nein, Uschi, dich trifft keine Schuld.« Er küsste sie auf die Stirn. »Komm, Uschi, gehen wir hinüber!«
»Gut!« Schwerfällig erhob sich Ursula. Ein letztes Mal strich sie über die Bettdecke, dann ließ sie sich von ihrem Mann willig ins Wohnzimmer führen.
Klaus schaute auf das riesige Foto, das über einer Vitrine im Wohnzimmer hing. Es zeigte Evchen, seine kleine Tochter. Das Bild war kurz vor ihrem Tod aufgenommen worden. Lachend drückte Eva eine Puppe an sich. Unterhalb des Bildes stand eine Vase mit Vergissmeinnicht.
»Setz dich, Uschi«, sagte Klaus und zeigte auf das helle Sofa. »Ich möchte dir nicht wehtun, aber wir müssen trotzdem noch einmal darüber sprechen.«
»Worüber müssen wir sprechen?«, fragte Ursula misstrauisch.
»Setz dich erst!« Sanft und doch energisch drückte Klaus seine Frau auf das Sofa.
»Du willst also wieder damit anfangen, dass wir ein Kind adoptieren sollten«, meinte Ursula. Sie schüttelte den Kopf. »Ich will kein Adoptivkind haben. Ich will Eva, unsere Eva!«
»Uschi, Eva ist tot. Kein Gebet der Welt kann sie uns zurückgeben«, entgegnete Klaus geduldig. Er nahm die Hände seiner Frau und hielt sie fest. »Es wird für uns beide besser sein, wenn wir wieder ein Kind haben.«
»Nein!« Ursula entzog ihm ihre Hände. »Ich will kein fremdes Kind haben. Ich könnte es nicht ertragen.« Sie sprang auf und lief an ihrem Mann vorbei. Unter dem Bild ihrer Tochter blieb sie stehen. »Willst du Evchen verraten, Klaus? Willst du sie tatsächlich mithilfe eines anderen Kindes vergessen?«
»Wir werden Evchen niemals vergessen, Uschi«, versicherte Klaus. »Sie wird immer ihren Platz in unseren Herzen behalten.«
»Ich will kein Adoptivkind, Klaus, ich will keins!« Ursula Eschenbach zitterte am ganzen Körper. Sie fühlte, dass ihre Knie unter ihr nachzugeben drohten. Taumelnd hielt sie sich an der Vitrine fest.
»Uschi!«, schrie Klaus auf und war mit wenigen Schritten bei seiner Frau. Fest nahm er sie in seine Arme. »Sei ruhig, Liebes, sei ruhig«, sprach er auf sie ein. »Gegen deinen Willen werden wir kein Kind annehmen. Das verspreche ich dir.«
*
»Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir in Nairobi landen. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen!« Monoton drang die Stimme der Stewardess auf englisch und kisuaheli aus dem Lautsprecher.
Denise von Schoenecker hatte schon bei den ersten Worten der Durchsage nach ihrem Gurt gegriffen und sich angeschnallt. Etwas aufgeregt sah sie aus dem Fenster. Sie war noch nie in Kenia gewesen.
Weit unter ihr tauchten viele Lichter auf. Ruhig glitt das Flugzeug der Erde zu. In einer weiten Kurve flog es über Nairobi hinweg.
Der Blick auf die abendlich beleuchtete Stadt war wundervoll, aber Denise dachte an die schwere Aufgabe, die vor ihr lag. Wie sie und Alexander vermutet hatten, stand Patricia Randow nun völlig allein da. Sie hatte keine Verwandten, die sie hätten aufnehmen können. Im Moment wohnte sie bei Josef Kisunu.
Denise hatte vor zwei Tagen kurz mit ihm telefoniert.
Patricia glaubte, dass ihre Eltern verreist seien. Keiner hatte es gewagt, ihr zu sagen, dass die Eltern niemals zurückkehren würden.
»Mrs von Schoenecker, bitte, kommen Sie zum Informationsschalter«, tönte es durch den Lautsprecher, als Denise gerade die Passkontrolle hinter sich gebracht hatte.
Denise steckte ihren Pass in die Schultertasche und fragte sich zum Informationsschalter durch.
»Mrs von Schoenecker?« Ein hochaufgeschossener, dunkelhäutiger Mann in einem hellen Straßenanzug kam auf Denise zu. Sie schätzte ihn auf etwa vierzig Jahre.
»Ja«, sagte sie und blieb stehen.
»Ich bin Josef Kisunu«, stellte sich der Kenianer vor. »Willkommen in Nairobi!«
»Danke, Mr Kisunu«, erwiderte Denise und reichte ihm die Hand. Sie fand Josef Kisunu auf Anhieb sympathisch.
»Ich habe schon von Ihrem Kinderheim gehört«, erzählte Josef Kisunu auf dem Weg zur Gepäckausgabe. »Gerhard Randow hat des Öfteren von Sophienlust gesprochen. Er war sehr beeindruckt.«
»Er wollte im nächsten Sommer mit seiner Familie nach Deutschland kommen und einige Wochen bei uns wohnen«, erzählte Denise.
»Er sprach davon«, bestätigte Mr Kisunu. »Ein tragischer Unfall, und so unnötig!«
Wenig später fuhren sie im Wagen von Mr Kisunu nach Nairobi. In der Dunkelheit konnte Denise nur wenig von der Landschaft erkennen, durch die sie kamen. Nach einigen Minuten gab sie es auf, aus dem Fenster zu blicken.
»Hat man den Schuldigen inzwischen gefunden?«, fragte sie.
»Nein, und ich glaube, dass man ihn auch nicht mehr finden wird«, entgegnete Josef Kisunu. Etwas ausführlicher berichtete er jetzt noch einmal das, was er schon am Telefon erzählt hatte. »Gerhard und seine Frau befanden sich auf der Rückfahrt von Mombasa, wo sie eine neue Maschinenfabrik besichtigt hatten. Patty hatten sie bei uns gelassen. Die Fahrt wäre für die Kleine zu weit gewesen, und ihr wird beim Autofahren gewöhnlich immer übel. Etwa hundert Kilometer vor Nairobi passierte es. Ein Lastwagen fuhr voll in Gerhards Wagen hinein. Dr. Zouar vom Zentralkrankenhaus meinte, dass beide wohl noch zu retten gewesen wären, wenn der Fahrer des Lastwagens nicht Fahrerflucht ergriffen hätte. So lagen die beiden Verletzten mindestens fünf Stunden eingeklemmt in ihrem Wagen. Auf dem Weg zum Krankenhaus starben sie dann leider.«
»Schrecklich!«, sagte Denise.