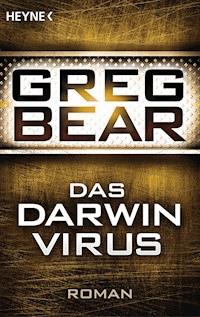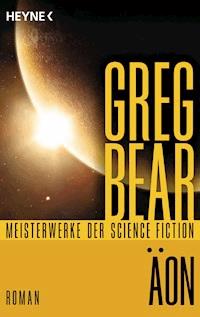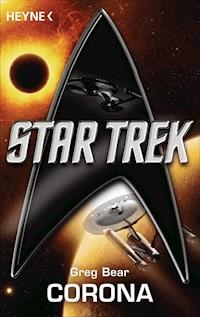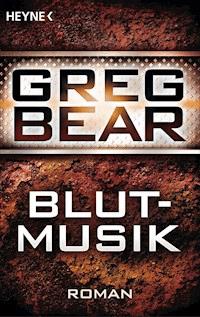
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn intelligente Einzeller existierten?
Vergil Ulam, ein einsamer, kauziger Wissenschaftler, steht kurz davor, das herauszufinden, als er seinen Job und damit auch sein Labor verliert. Nachdem er die Schwelle ethischer und legaler Methoden ohnehin längst überschritten hat, injiziert er sich seine „Forschungsergebnisse“ – und löst damit Veränderungen auf der ganzen Welt aus, denn die winzigen Lebewesen denken nicht daran, sich nur auf Ulams Körper zu beschränken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
MEISTERWERKE DER
SCIENCE FICTION
Das Buch
Vergil Ulam, ein einsamer, kauziger Wissenschaftler, arbeitet in der ultramodernen Biochip-Forschung. Längst hat er die Schwelle ethischer und legaler Methoden überschritten und widmet sich geheimen Experimenten: der Erzeugung intelligenter Lebensformen aus Bakterien. Sein Ehrgeiz grenzt an Besessenheit. Als ihn sein Chef aus firmenpolitischen Gründen zur Räson ruft und zwingt, die Bakterienkulturen zu vernichten, greift Ulam zum Äußersten und injiziert sich selbst eine Versuchsprobe. Schon nach wenigen Tagen stellt er erschreckende Veränderungen an sich fest: In seinem Blut rauscht die Musik intelligenter Lebensformen, die seinen Körper und seinen Geist Stück für Stück ihren eigenen Plänen unterwerfen. Ulam stürzt in einen veränderten Bewusstseinszustand, der zwischen Wahnsinn und Genie changiert. Doch damit nicht genug: Unwissentlich überträgt er die Lebensformen auf seinen einzigen Freund. Einer Seuche gleich breiten sie sich weiter aus – und beginnen, die Welt, wie wir sie kennen, von Grund auf zu verändern …
Das Meisterwerk des modernen Wissenschaftsthrillers: Mit »Blutmusik« thematisierte Greg Bear erstmals die möglichen Folgen einer außer Kontrolle geratenen Nano- und Biotechnologie. Ein faszinierender und bis heute erschreckend aktueller Roman.
Der Autor
Greg Bear wurde 1951 in San Diego geboren und studierte dort englische Literatur. Seit 1975 als freier Schriftsteller tätig, gilt er heute als einer der ideenreichsten wissenschaftlich orientierten Autoren der Gegenwart. Seine zuletzt veröffentlichten Romane »Das Darwin-Virus«, »Die Darwin-Kinder«, »Jäger« sowie »Quantico« wurden zu internationalen Bestsellern.
Mehr zu Greg Bear unter: www.gregbear.com
Vorwort
von Charles Stross
Hin und wieder liest man ein Buch, das den persönlichen Blick auf die Welt verändert. Oder eines, bei dem einem das Blut gefriert. Doch nur äußerst selten stößt man auf einen Roman, der beides bewirkt. Deshalb möchte ich Sie warnen: Sobald Sie diese Einführung hinter sich haben, werden bei Ihnen beide Reaktionen einsetzen. Wäre »Blutmusik« eine Sinfonie, hätte sie die Tonalität von »Frankenstein«.
Ich weiß noch, dass ich »Blutmusik« zum ersten Mal im Jahre 1988 las; damals arbeitete ich als Pharmazeut, befasste mich in Abendkursen mit Informatik und nutzte die übrige Zeit zum Schreiben. Der gelassene, kühle Ton, in dem Greg Bear die Entwicklung einer biologischen Katastrophe schildert, löste bei mir solche Höllenangst aus, wie es die Horrorgeschichten von Stephen King nie ganz vermocht haben. Doch wie kann ein Roman, in dem ein kurzsichtiger Biotech-Nerd ständig nur Mist baut, bis die Situation eskaliert, einem so schreckliche Angst einjagen? Mal sehen, ob es mir gelingt, das Rätsel zu lösen.
Zunächst ein paar trockene Fakten zur Entstehungsgeschichte: Ursprünglich war »Blutmusik« ein Kurzroman. Bear verfasste ihn 1982 und verkaufte ihn anschließend an das SF-Magazin Analog. Nach der Veröffentlichung erhielt »Blutmusik« als »bester Kurzroman des Jahres 1983« die wichtigsten Auszeichnungen, die für englischsprachige Science Fiction vergeben werden: den Nebula Award und den Hugo Award. Von Stanley Schmidt, Redakteur bei Analog, ermutigt, baute Bear das ursprüngliche Manuskript dann zu einem Roman aus, in dem er den entsetzlichen Folgen der Ausgangssituation – eines biotechnologischen Selbstexperiments – nachspürt. Dieser (längere) Roman erschien 1985 und wurde 1986 erneut für den Nebula und den Hugo nominiert.
Etwa zur selben Zeit überlegte Eric Drexler, Postgraduierter am Massachusetts Institute of Technology, ob er seine radikalen molekulargenetischen Ideen publik machen sollte. In dem populären Sachbuch »Engines of Creation«, veröffentlicht im Jahre 1986, taufte er das neue Wissenschaftsgebiet schließlich Nanotechnologie. Heute begegnen wir den Folgen dieser Forschung in Form von Konzernen mit Milliardenumsätzen, aber auch der weit verbreiteten Angst vor »Grey Goo« – außer Kontrolle geratenen mikrobiologischen Maschinen, die sich alles ringsum einverleiben, um für ihre Selbstreplikation zu sorgen.
Wiederum fast gleichzeitig beackerte der Informatikprofessor und Science-Fiction-Autor Vernor Vinge ein anderes Feld. Seine kühnen Spekulationen tauchten erstmals 1986 in der Science Fiction auf, allerdings wurde »Marooned in Realtime« (deutsch: »Gestrandet in der Realität«) anfangs nur wenig beachtet. (Den Durchbruch schaffte Vinge dann 1991 mit dem Roman »A Fire Upon the Deep«, deutsch: »Ein Feuer auf der Tiefe«.) Doch Anfang der 1990er Jahre schlug sein Konzept der »Singularität« nachhaltig ein und stellte eindeutig den wichtigsten Beitrag zur wissenschaftsorientierten SF der Dekade dar. Vinge entwickelte das Thema Künstliche Intelligenz schlüssig weiter – was passiert, wenn man eine K.I. schafft, die entweder viel schneller oder viel schlauer agiert als jeder Mensch? – und zeigte eine Reihe beunruhigender Möglichkeiten auf. (Bei Vinge ist die »Singularität« ein Ereignis, das den Zukunftsforschern jede Möglichkeit nimmt, aus der Gegenwart zu extrapolieren und Vorhersagen zu treffen. Kennzeichnend für dieses Ereignis ist die Emergenz einer künstlichen oder menschlichen Intelligenz, die unser heutiges Niveau so in den Schatten stellt, dass wir jämmerlichen Wesen jeden Einfluss auf das Tempo des Fortschritts verlieren.)
Und jetzt komme ich endlich zu dem Teil, auf den Sie gewartet haben: »Blutmusik« war der allererste Roman, der solche Themen behandelte.
Zwar benutzte Greg Bear nicht die später von Drexler und Vinge entwickelte Terminologie, dennoch schrieb er den ersten – und grundlegenden – SF-Roman, der Nanotechnologie und die Singularität in den Mittelpunkt rückte. Und das 1983/84! Noch ehe Drexler mit »Engines of Creations« den Begriff »Grey Goo« einführte und verbreitete, malte Bear das düstere Bild einer außer Kontrolle geratenen Nanotechnologie. Noch ehe Vinge in seinem Roman »Marooned in Realtime« die »Singularität« in Worte fasste, beschrieb Bear das Phänomen in »Blutmusik«. Mehr noch: Als einer der Ersten sondierte er aus nüchtern-mathematischer, materialistischer Sicht die Möglichkeit des »Mind Uploading«, eines Abspeicherns von Gedankenprozessen und Erinnerungen, das mit »Seelenwanderung« nichts gemein hat. Frühere Autoren hatten hier obskure Spekulationen als Kunstgriff benutzt, um die Romanhandlung voranzutreiben, doch Bear gelang es, eine plausible Übertragungstechnik zu entwickeln.
Was »Blutmusik« auszeichnet, ist nicht zuletzt Bears Herangehensweise an Genetik und Informatik: Sie basiert nicht auf unbekümmerter vager Spekulation, sondern auf unserem aktuellen Wissensstand. Zwar ist die Entwicklung seit 1983 vorangeschritten und inzwischen steht – im Gegensatz zu damals weit verbreiteten Ansichten – fest, dass das Genom den Bauplan lebender Organismen umfasst. Doch 1983 bedeutete der wissenschaftliche Ansatz, Gene als Elemente eines organischen Computerprogramms zu betrachten, einen radikalen Bruch mit früheren Theorien; die Idee, DNA dazu zu nutzen, Programme in einem Organismus gezielt zu verändern, tauchte erst gegen Ende der 1980er Jahre in den Fachzeitschriften auf. »Blutmusik« jedoch entwickelte solche Konzepte noch weiter und warf Fragen auf, die seltsamerweise noch kein SF-Autor gestellt hatte – etwa die Frage: Was würde passieren, wenn wir ein K.I.-Programm auf DNA umschreiben und in lebende Zellen einschleusen? Und die Antworten, die Bear lieferte, waren mindestens so erschreckend wie irgendein Bioterror-Roman von Michael Crichton, wenn nicht gar erschreckender.
Als ich »Blutmusik« nach zwanzig Jahren ein zweites Mal las, fand ich den Roman noch genauso beängstigend wie in den 1980er Jahren. Die Zeiten haben sich gewandelt, so wie unsere Kenntnisse dessen, was mit Hilfe der Bio- und Nanotechnologien jetzt schon machbar ist. Doch Bears Roman wirkt so frisch und neu wie eh und je. Leider neigt Science Fiction, die in der nahen Zukunft angesiedelt ist, oft dazu, schnell zu veralten, weil die Realität sie einholt oder überholt – an »Blutmusik« hat der Zahn der Zeit kaum genagt. Falls überhaupt, dann nur in der Hinsicht, dass die kühnsten Hypothesen zum Potenzial der Genetik mittlerweile zum Kanon der Lehrmeinungen zählen, so dass der Roman die Kraft zu schockieren ein wenig eingebüßt hat. Dennoch weckt er beim Leser auch heute noch Angstgefühle.
Nur selten kann ein SF-Autor für sich in Anspruch nehmen, mit seinen Büchern auch nur ein einziges neues Konzept in die Science Fiction eingeführt zu haben. Dass Greg Bear gleich vier innovative Konzepte in einem Roman vereint, kommt einem kleinen Wunder gleich. »Blutmusik« ist im Bereich der wissenschaftsorientierten Science Fiction der bedeutendste Roman der 1980er Jahre – und vermutlich auch das Werk, das so erschreckend glaubhaft ist wie kein anderes jener Zeit.
Charles Stross ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren der Gegenwart, der sich ebenfalls immer wieder mit dem Thema Singularität befasst. Zuletzt sind von ihm die Romane »Accelerando« und »Glashaus« erschienen.
Für Astrid –Glanz, Unabdingbarkeit undLeidenschaft meines Lebens.Mit all meiner Liebe.
Inhaltsverzeichnis
INTERPHASE
Stündlich entstehen und sterben unzählige Billionen winziger Lebewesen: Mikroben, Bakterien – die Kleinbauern der Natur. Sie zählen nicht viel, es sei denn als Summe betrachtet, sofern sie in sehr großer Anzahl auftreten. Weder verfügen sie über eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, noch können sie Leid empfinden. Selbst wenn hundert Billionen dieser Lebewesen sterben, hat das nicht annähernd ein solches Gewicht wie der Tod eines einzigen Menschen.
Alle Geschöpfe, seien sie so winzig wie Mikroben oder so groß wie Menschen, haben innerhalb ihrer unterschiedlichen Größenordnungen eine vergleichbare »Wirkungskraft«, wie ja auch die Zweige eines hohen Baums in ihrer Gesamtheit der Masse der Äste entsprechen und die Gesamtheit der Äste der Masse des Stammes.
Davon sind wir genauso fest überzeugt, wie die Könige Frankreichs seinerzeit von der Rechtmäßigkeit ihres naturgegebenen Amtes überzeugt waren. Wann wird eine Generation zur Welt kommen, die konträre Einschätzungen entwickelt?
ANAPHASE
Juni bis September
1
La Jolla, Kalifornien
Das rechteckige schiefergraue Schild stand inmitten hellgrüner Grasbüschel auf einem niedrigen Hügel. Ringsum wuchsen Schwertlilien. Seitlich davon floss in einem künstlich angelegten Bett aus Zement ein Bach, in dessen trübem Wasser es von Zierkarpfen wimmelte. Auf der Seite des Schildes, die der Straße zugekehrt war, prangte in knallroten Druckbuchstaben der Name GENETRON, darunter der Werbespruch Wo kleine Dinge große Veränderungen bewirken.
Die Labors und Geschäftsräume von Genetron waren rings um einen begrünten Innenhof in einem hufeisenförmigen, schmucklosen Betonbau im Bauhausstil untergebracht. Der Hauptkomplex bestand aus zwei Ebenen, die über im Freien liegende Korridore zugänglich waren. Jenseits des Innenhofs, unmittelbar hinter einem künstlich angelegten Erdhügel, der noch nicht bepflanzt war, stach ein vierstöckiger Kubus mit eingeschwärzten Glasfassaden ins Auge, der mit einem elektrischen Stacheldrahtzaun gesichert war.
Denn Genetron hatte zwei Seiten: einerseits die offenen Labors, in denen an Biochips geforscht wurde, andererseits das düstere Gebäude, wo im Auftrag des Verteidigungsministeriums militärische Nutzungsmöglichkeiten neuer Entwicklungen untersucht wurden.
Doch selbst in den offenen Labors galten strenge Sicherheitsbestimmungen. Alle Angestellten hatten Dienstmarken mit Laserkennung zu tragen, und der Besucherverkehr in den Labors wurde sorgfältig überwacht. Der Geschäftsführung von Genetron – fünf Absolventen der Stanford-Universität hatten das Unternehmen drei Jahre nach Studienabschluss gegründet – war schließlich klar, dass es nicht nur um mögliche Sicherheitslecks im schwarzen Kubus ging, sondern ein weit größeres Risiko in der Industriespionage lag. Dennoch wirkte die Atmosphäre nach außen hin locker. Die Leitung verwendete viel Mühe darauf, die Sicherheitsmaßnahmen unauffällig durchzuführen.
Ein großer Mann mit gebeugten Schultern und wirrem schwarzem Haar wand sich aus einem roten Sportwagen der Marke Volvo und nieste zweimal, ehe er den Mitarbeiterparkplatz überquerte. Mit ihrem frühsommerlichen Pollenflug sorgten die Gräser derzeit dafür, dass die Schleimhäute allergischer Menschen ständig gereizt waren.
Beiläufig begrüßte er Walter, einen Wachmann mittleren Alters, der dennoch drahtig wirkte. Ebenso beiläufig überprüfte Walter die Dienstmarke des Angestellten, indem er sie durch den Laserscanner laufen ließ. »Sie haben letzte Nacht wohl nicht viel Schlaf abbekommen, wie?«, fragte er dabei.
Vergil Ulam schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Partys, Walter.« Seine Augen waren gerötet. Außerdem war seine Nase inzwischen stark angeschwollen, da er sie ständig mit dem Taschentuch bearbeitet hatte, das jetzt durchfeuchtet und griffbereit in der Hosentasche steckte.
»Wie arbeitende Menschen wie Sie unter der Woche auch noch Partys feiern können, wird mir ewig ein Rätsel bleiben.«
»Die Damenwelt verlangt’s, Walter«, erwiderte Vergil im Vorbeigehen. Walter grinste und nickte, obwohl er ernsthafte Zweifel daran hegte, dass Vergil in dieser Hinsicht viel erlebte – ob mit oder ohne Partys. Keine Frau gab sich gern mit einem Mann ab, der sich eine Woche lang nicht rasiert hatte, es sei denn, die Maßstäbe waren seit Walters Glanzzeiten merklich gesunken.
Ulam zählte nicht gerade zu den attraktivsten Menschen bei Genetron. Seine riesigen Plattfüße hatten einen Körper von knapp einem Meter neunzig und ein Übergewicht von fünfundzwanzig Pfund zu tragen. Er war zwar erst zweiunddreißig Jahre alt, litt aber bereits unter Rückenschmerzen und zu hohem Blutdruck. Außerdem gelang es ihm nie, sich so gründlich zu rasieren, dass er die bläulichen Schatten loswurde, die an die Clownsmaske des berühmten Emmett Kelly erinnerten.
Auch seine Stimme war kaum dazu geeignet, Sympathie zu wecken: Sie klang rau, leicht kratzend und wurde schnell laut. Zwanzig Jahre Kalifornien hatten seinen texanischen Akzent zwar abgeschliffen, doch wenn er sich ereiferte oder wütend wurde, machte sich seine Herkunft wieder so stark bemerkbar, dass seine Stimme den Ohren der Zuhörer fast wehtat.
Das Einzige, was ihn auszeichnete, waren ungewöhnliche smaragdgrüne Augen, die groß und ausdrucksvoll wirkten und von langen Wimpern beschattet wurden. Allerdings waren diese Augen zwar schön, aber nicht sonderlich leistungsstark: Vergil verbarg sie meistens hinter einer riesigen schwarz gerahmten Brille, denn er war kurzsichtig.
Jeweils zwei, drei Stufen auf einmal nehmend, eilte er die Treppe hinauf. Seine langen, kräftigen Beine erschütterten die Konstruktion aus Beton und Stahl so sehr, dass ein lauter Widerhall zu hören war. Im zweiten Stock ging er den offenen Korridor entlang, der zur gemeinsamen Betriebsanlage der Forschungsabteilung Biochips führte, kurz Gemeinschaftslabor genannt. Normalerweise überprüfte er morgens als Erstes die Proben in einer der fünf Ultrazentrifugen. Sein jüngster Ansatz hatte sechzig Stunden lang bei einer Geschwindigkeit von zweihunderttausend g rotiert und war jetzt so weit, dass er mit der Analyse beginnen konnte.
Für einen Mann seiner Größe hatte Vergil verblüffend zarte und sensible Hände. Nachdem er den teuren Rotor aus schwarzem Titan aus der Ultrazentrifuge gehoben hatte, schloss er die stählerne Vakuumverriegelung wieder. Gleich darauf legte er den Rotor auf einen Labortisch, kniff die Augen zusammen und befreite nacheinander alle fünf Glasröhren aus den Halterungen, in denen sie unter der pilzförmigen Kappe aufgehängt waren. In jeder Röhre hatten sich deutlich abgegrenzte eierschalfarbene Schichten gebildet.
Hinter dem dicken Brillenrand schnellten Vergils Augenbrauen erst hoch und zogen sich dann zusammen. Als er lächelte, enthüllte er bräunlich gefleckte Zähne – Folge einer Kindheit, in der er regelmäßig Wasser getrunken hatte, das mit natürlichem Fluor angereichert war. Gerade wollte er die Pufferlösung und die unerwünschten Schichten absaugen, da meldete sich das Labortelefon. Also verstaute er die Röhre, die er in Arbeit hatte, in einem Ständer und nahm ab. »Gemeinschaftslabor, Ulam am Apparat.«
»Vergil, ich bin’s, Rita. Hab Sie hereinkommen sehen, aber in Ihrem Labor nicht erreicht …«
»Bin wie üblich in meinem zweiten Zuhause, Rita. Worum geht’s?«
»Sie hatten mich doch gebeten – mir aufgetragen –, Ihnen Bescheid zu sagen, wenn hier ein gewisser Herr auftaucht. Ich meine, er ist jetzt da.«
»Michael Bernard?«
»Ich glaube, er ist es, Vergil. Aber …«
»Bin gleich unten.«
»Vergil …«
Er legte auf und überlegte kurz, wie er mit den Glasröhren verfahren sollte, ließ sie dann aber an Ort und Stelle.
Genetrons kreisförmiger Empfangsbereich, ringsum von Panoramafenstern eingefasst und großzügig mit Schusterpalmen in verchromten Übertöpfen ausgestattet, grenzte an den Ostflügel des Erdgeschosses. Als Vergil von der Laborseite her eintrat, blendete ihn das grelle, weiße Morgenlicht, das schräge Streifen auf den himmelblauen Teppich warf. Während er am Empfangstresen vorbeiging, erhob sich Rita von ihrem Platz.
»Vergil …«
»Danke«, erwiderte er flüchtig und blickte zu dem distinguiert wirkenden grauhaarigen Mann hinüber, der neben der einzigen Couch in der Lobby stand. Zweifellos war das Michael Bernard. Vergil erkannte ihn von Abbildungen wieder. Und vom Titelfoto, das das Time Magazine vor drei Jahren von ihm gebracht hatte. Breit lächelnd, streckte Vergil die Hand aus. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Bernard.«
Zwar erwiderte Bernard den Händedruck, doch er wirkte verunsichert.
In der breiten Doppeltür des schicken Eingangsbüros von Genetron, das hauptsächlich dazu diente, Besucher zu beeindrucken, tauchte Gerald T. Harrison auf, den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Hilfe suchend sah Bernard zu ihm hinüber.
»Ich bin sehr froh, dass Sie meine Nachricht erhalten haben«, fuhr Vergil fort, ehe er Harrison bemerkte.
Unverzüglich verabschiedete sich Harrison von seinem Gesprächspartner am Telefon und legte unwirsch auf. »Der Rang eines Vorgesetzten bringt nun mal gewisse Privilegien mit sich, Vergil.« Mit falschem Lächeln baute er sich neben Bernard auf.
»Entschuldigung, aber um welche Nachricht geht’s denn überhaupt?«, fragte Bernard.
»Das hier ist Vergil Ulam, einer unserer Spitzenforscher«, erklärte Harrison in schleimigem Ton. »Wir alle freuen uns sehr über Ihren Besuch, Mr. Bernard. – Vergil, wir reden später über die Sache, die Sie erörtern wollten. «
Vergil hatte Harrison keineswegs um ein Gespräch gebeten. »Alles klar«, erwiderte er, während das alte, wohlbekannte Gefühl an ihm nagte, wieder einmal umgangen, zur Seite gedrängt worden zu sein.
Bernard hatte keine Ahnung, wer er war.
»Später, Vergil«, wiederholte Harrison nachdrücklich.
»Selbstverständlich, alles klar.« Mit einem flehenden Blick zu Bernard hinüber zog er sich zurück, drehte sich um und schlurfte durch die Hintertür hinaus.
»Wer war das?«, erkundigte sich Bernard bei Harrison.
»Ein äußerst ehrgeiziger Bursche. Aber wir haben ihn im Griff.«
Harrisons Arbeitszimmer lag zu ebener Erde im westlichen Flügel des Laborgebäudes. Ringsum standen Holzregale, in denen die Bücher ordentlich aufgereiht waren. Hinter dem Schreibtisch befand sich auf Augenhöhe ein Regal mit den allseits bekannten Ringbüchern aus schwarzem Kunststoff – Loseblattsammlungen, die aus dem Cold Spring Harbor Laboratory stammten. Die Reihe darunter barg mehrere Telefonbücher – Harrison sammelte uralte Exemplare. Außerdem füllten Handbücher der Informatik mehrere Regale. Eine von Leder eingefasste Schreibunterlage mit Millimeterpapier schützte die schwarze Schreibtischplatte, auf der sich auch eine mit dem Zentralrechner Genetrons verbundene Workstation befand.
Von den Gründern Genetrons waren nur Harrison und William Yng so lange geblieben, dass sie miterlebt hatten, wie die Labors die Arbeit aufnahmen. Beide Gründer waren jedoch mehr an der Vermarktung von Forschungsergebnissen als an der Forschung selbst interessiert, obwohl ihre Promotionsurkunden, die sie als Naturwissenschaftler auswiesen, an der holzgetäfelten Wand hingen.
Mit erhobenen Armen, die Hände im Nacken verschränkt, lehnte Harrison sich im Sessel zurück. Vergil fiel die leichte Andeutung von Schweißflecken in den Achselhöhlen auf.
»Das war sehr peinlich, Vergil«, bemerkte Harrison. Sein weißblondes Haar war sorgfältig so gekämmt, dass es die vorzeitig gelichteten Stellen überdeckte.
»Tut mir leid.«
»Mir mindestens ebenso. Also waren Sie’s, der Mr. Bernard zu einem Besuch in unseren Labors eingeladen hat.«
»Ja.«
»Warum?«
»Ich dachte, er könne sich für unsere Arbeit interessieren. «
»Das haben wir uns auch gedacht, und eben darum haben wir ihn ja eingeladen. Ich glaube nicht, dass er von Ihrer Einladung überhaupt wusste.«
»Anscheinend nicht.«
»Sie haben’s hinter unserem Rücken gemacht.«
Vergil stellte sich vor den Schreibtisch und blickte missmutig auf das Computerterminal.
»Sie haben sehr viel nützliche Arbeit für uns geleistet. Rothwild hat Sie als brillant, vielleicht sogar unersetzlich bezeichnet.« Rothwild überwachte das Biochip-Projekt. »Andere behaupten allerdings, man könne sich nicht auf Sie verlassen. Und jetzt … dies.«
»Bernard …«
»Es geht hier nicht um Mr. Bernard, Vergil, sondern um das hier.« Harrison schwenkte die Workstation herum und drückte auf eine Taste: Vergils geheime, sorgfältig verschlüsselte Computerdatei rollte über den Bildschirm. Vergil riss die Augen auf, und ihm wurde die Kehle eng, allerdings gelang es ihm, sich so weit zu beherrschen, dass er nicht nach Luft rang. »Ich hab noch nicht alles gelesen, aber es klingt so, als hätten Sie einige äußerst verdächtige Dinge vor, die möglicherweise gegen ethische Grundsätze verstoßen. Wir hier bei Genetron halten uns allerdings gern an die Richtlinien, besonders in Anbetracht unserer künftigen Marktposition. Aber nicht nur deswegen. Auch persönlich lege ich großen Wert darauf, dass wir unsere Betriebsführung an ethischen Prinzipien ausrichten.«
»Ich habe nichts unternommen, das gegen ethische Grundsätze verstößt.«
»Ach nein?« Harrison ließ den angezeigten Text auf dem Display erstarren. »Sie entwerfen lediglich neue DNA-Abschnitte für mehrere Mikroorganismen, für die die Bestimmungen der National Institutes of Health gelten. Und Sie arbeiten mit Zellen von Säugetieren, was wir hier grundsätzlich nicht tun, da wir nicht ausreichend vor biologischen Gefahrenstoffen geschützt sind – jedenfalls nicht in den Zentrallabors. Aber bestimmt könnten Sie mir nachweisen, dass Ihre Forschung völlig unschädlich und harmlos ist. Sie sind nicht zufällig dabei, eine neue Seuchenart zu erzeugen, um sie an Revolutionäre in der Dritten Welt zu verscherbeln, oder?«
»Nein«, erwiderte Vergil lahm.
»Gut. Einiges von diesem Material übersteigt mein Begriffsvermögen. Sieht aber so aus, als versuchten Sie unser Projekt – die Erzeugung medizinisch anwendbarer Biochips – in gewisser Hinsicht auszuweiten. Möglicherweise verfügen Sie über wertvolle Erkenntnisse.« Er hielt kurz inne. »Was, zum Teufel, treiben Sie da überhaupt, Vergil?«
Vergil setzte die Brille ab und säuberte die Gläser mit einem Zipfel seines Laborkittels. Plötzlich musste er laut und feucht niesen, was Harrison leicht angewidert zur Kenntnis nahm.
»Wir haben den Code erst gestern geknackt. Fast zufällig. Warum haben Sie die Datei versteckt? Geht’s dabei um Dinge, die Sie uns lieber vorenthalten möchten?«
Ohne die Brille wirkte Vergil hilflos und ähnelte einer Eule. Er stammelte irgendeine Erwiderung, brach jedoch gleich darauf ab, streckte das Kinn vor und runzelte die dicken schwarzen Brauen, so dass sein Gesicht einen ebenso genervten wie verblüfften Ausdruck annahm.
»Mir kommt’s so vor, als hätten Sie unsere Forschungseinrichtungen für eigene genetische Arbeiten genutzt. Selbstverständlich unbefugt, aber Sie haben sich ja nie sonderlich um irgendwelche Hierarchien geschert.«
Mittlerweile war Vergils Gesicht knallrot angelaufen.
»Ist Ihnen nicht gut?« Harrison, der es offensichtlich genoss, Vergil in die Enge zu treiben, bedachte ihn mit einem forschenden Blick, konnte aber nur mit Mühe ein schadenfrohes Grinsen unterdrücken.
»Mir fehlt nichts, keine Sorge. Ich habe … Ich befasse mich derzeit mit Biologik.«
»Mit Biologik? Sagt mir nichts.«
»Ein Ableger der Biochip-Forschung. Es geht dabei um selbstständig arbeitende organische Computer.« Die Vorstellung, noch mehr preiszugeben, bereitete Vergil Höllenqualen. Er hatte Bernard deswegen angeschrieben – offenbar ohne Erfolg –, damit er sich die Arbeiten persönlich ansah. Vergil wollte seine Ergebnisse nicht einfach Genetron überlassen, obwohl eine Klausel in seinem Anstellungsvertrag besagte, dass dem Unternehmen, das ihn beschäftigte und bezahlte, all seine Arbeitsresultate zustanden. Eigentlich war seine Idee recht simpel gewesen, auch wenn deren Umsetzung ihn zwei Jahre Arbeit, heimlicher und mühseliger Arbeit, gekostet hatte.
»Die Sache fasziniert mich.« Harrison drehte das Terminal herum und scrollte durch die Datei. »Wir reden hier nicht nur über Proteine und Aminosäuren. Sie manipulieren Chromosomen, rekombinieren die Gene von Säugetieren. Wie ich sehe, vermischen Sie diese sogar mit den Genen von Viren und Bakterien.« Aus Harrisons Augen wich jeder Glanz. Jetzt wirkten sie so hart wie graues Gestein. »Ihre Arbeit könnte zur Folge haben, dass Genetron sofort, auf der Stelle dichtmachen muss, Vergil. Für derartige Experimente fehlen uns die Schutzvorrichtungen. Sie haben ja nicht mal die P-3-Standards für genetische Forschungen berücksichtigt.«
»Ich hantiere ja auch gar nicht mit reproduktiven Genen herum.«
»Gibt’s auch andere?« Wütend, weil er sich von Vergil auf den Arm genommen fühlte, beugte Harrison sich vor.
»Introns. DNA-Abschnitte, die keine Proteine codieren. «
»Was ist damit?«
»Ich beschränke mich auf diese Gebiete. Und … füge weiteres nicht-reproduktives genetisches Material hinzu.«
»Klingt für mich wie ein Widerspruch in sich selbst, Vergil. Wir haben keinen Beweis dafür, dass Introns nicht doch irgendwas codieren.«
»Ja, aber …«
»Aber …« Harrison streckte abwehrend die Hand hoch. »Das alles ist ziemlich irrelevant. Was immer Sie auch vorhaben mögen: Tatsache ist, dass Sie drauf und dran waren, unseren Vertrag zu brechen. Hinter unserem Rücken haben Sie sich an Bernard gewandt und versucht, seine Unterstützung für ein persönliches Projekt zu gewinnen. Ja oder nein?«
Darauf erwiderte Vergil nichts.
»Ich nehme an, dass es Ihnen schlicht an Welterfahrung mangelt, Vergil. Zumindest kennen Sie sich in der Geschäftswelt nicht gut aus. Vielleicht waren Ihnen die Folgen gar nicht klar.«
Vergil, dessen Gesicht immer noch knallrot war, schluckte heftig. Er spürte starken Blutandrang in den Ohren und ein durch Stress bedingtes Schwindelgefühl. Erneut musste er zweimal niesen.
»Also gut, ich will Ihnen die Konsequenzen aufzeigen. Es fehlt nicht mehr viel dazu, dass wir Hackfleisch aus Ihnen machen und es als Dosenfutter verkaufen.«
Nachdenklich hob Vergil die Augenbrauen.
»Allerdings sind Sie für die MAB-Forschung ein wichtiger Mann. Wenn es nicht so wäre, würden wir Sie sofort rausschmeißen, und ich würde persönlich dafür sorgen, dass Sie nie wieder in einem Labor der Privatwirtschaft arbeiten können. Aber Thornton, Rothwild und die anderen glauben, dass Sie vielleicht doch noch zu retten sind. Ja, Vergil, wir möchten Sie retten, vor sich selbst bewahren. Ich habe mich in dieser Angelegenheit noch nicht mit Yng beraten und werde sie nicht weiterverbreiten, wenn Sie sich künftig nach Vorschrift verhalten.«
Mit gesenkten Brauen fixierte er Vergil. »Brechen Sie die Arbeit an allen außerplanmäßigen Projekten sofort ab. Ihre Datei bewahren wir hier weiter auf, aber ich verlange von Ihnen, dass Sie unverzüglich alle Experimente einstellen, die nicht unmittelbar mit der medizinischen Anwendung von Biochips zu tun haben. Außerdem müssen Sie alle Organismen, mit denen Sie herumexperimentiert haben, vernichten. In zwei Stunden werde ich Ihr Labor persönlich inspizieren. Falls Sie diese Dinge bis dahin nicht erledigt haben, werden wir Sie fristlos entlassen. Zwei Stunden, Vergil. Und wir räumen Ihnen weder Ausnahmen noch Verlängerungen ein.«
»Ja, Sir.«
»Mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen.«
3
In der folgenden Woche wurde er streng überwacht, doch danach nahmen die Abschlussversuche am MAB-Prototyp alle derart in Anspruch, dass die Wachhunde zurückgepfiffen wurden. Vergils Verhalten hatte keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.
Jetzt bereitete er die letzten Schritte für den selbst gewählten Abschied von Genetron vor.
Vergil war nicht der einzige Angestellte, der die Grenzen ideeller Toleranz bei Genetron weit überschritten hatte. Es war erst wenige Wochen her, dass das Management, auch damals vertreten durch Gerald T. Harrison, sich Hazel vorgeknöpft hatte. Hazel hatte sich bei ihren Versuchen mit Kolibakterien auf Nebengeleise begeben. Sie hatte beweisen wollen, dass die geschlechtliche Reproduktion ihren Ursprung im Eindringen einer autonomen DNA-Sequenz in frühe prokaryotische Lebensformen hatte. Diese DNA-Sequenz, einen chemischen Parasiten, bezeichnete sie als Fertilitätsfaktor oder F-Faktor. Bei ihren Versuchen war sie von der Hypothese ausgegangen, dass die zweigeschlechtliche Reproduktion in evolutionärer Hinsicht keineswegs sinnvoll ist – zumindest nicht für Frauen, die sich theoretisch ja auch durch Parthenogenese hätten fortpflanzen können. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass Männer überflüssig waren.
Hazel hatte so viele Beweise für ihre Hypothese zusammengetragen, dass Vergil, der heimlich in ihren Notizbüchern herumgeschnüffelt hatte, ihren Schlussfolgerungen zustimmen musste. Doch diese Forschung passte nicht in den von Genetron abgesteckten Rahmen, denn sie war revolutionär und würde in sozialer Hinsicht heftige Kontroversen hervorrufen. Nachdem Harrison ein Machtwort gesprochen hatte, konnte Hazel die Arbeit auf diesem speziellen Forschungsgebiet in den Wind schreiben.
Genetron wünschte weder öffentliche Aufmerksamkeit noch irgendwelche öffentlichen Kontroversen. Noch nicht. Um später mit der Produktion medizinisch anwendbarer Chips an die Börse gehen zu können, brauchte das Unternehmen eine makellose Reputation. Allerdings hatte man in Hazels Fall die schriftlichen Unterlagen nicht beschlagnahmt. Dass Harrison seine Datei konfisziert hatte, machte Vergil schwer zu schaffen.
Als er sicher war, dass sie ihn nicht mehr überwachten, schritt er zur Tat: Er beantragte Zugang zu den Rechnern, deren Nutzung man ihm auf unbestimmmte Zeit untersagt hatte. Recht nahe an der Wahrheit behauptete er, er müsse seine Unterlagen über die Strukturen denaturierter, nicht funktionsfähiger Proteine überprüfen. Nachdem man ihm die Erlaubnis erteilt hatte, loggte er sich eines Abends nach acht ins System des Gemeinschaftslabors ein.
Vergil war ein bisschen zu früh aufgewachsen, als dass man ihn als Computer-Geek oder Nerd hätte bezeichnen können. Doch in den letzten sieben Jahren war es ihm immerhin gelungen, seine Personalunterlagen bei drei größeren Unternehmen zu frisieren und sich in das Immatrikulationsverzeichnis einer renommierten Universität zu hacken. Dieser Eintrag hatte praktisch dafür gesorgt, dass Genetron ihn einstellte. Seine Manipulationen als Hacker hatten ihm noch nie schlaflose Nächte bereitet.
Nie wieder würde er so schlecht dastehen wie in früheren Zeiten. Und er sah nicht ein, warum er ewig für seine Jugendsünden büßen sollte. Er wusste, dass er für die Arbeit bei Genetron ausreichend qualifiziert war. Die gefälschten Universitätszeugnisse dienten nur dazu, eine Show für die Personalleiter abzuziehen, die diesen Zirkus offenbar brauchten. Außerdem hatte Vergil die Welt bis vor wenigen Wochen als seinen persönlichen Spielplatz betrachtet, und wenn er irgendwelche Lösungen zu vertrackten Rätseln beisteuerte (was seine Aktivitäten als Hacker einschloss), war das schlicht Teil seiner Natur.
Er fand es lächerlich einfach, den Rinaldi-Code zu knacken, den Genetron zur Verschlüsselung vertraulicher Daten benutzte. Für ihn bargen die Goedel’schen Zahlen und die Reihen scheinbar zufällig angeordneter Ziffern auf dem Bildschirm keine Geheimnisse. In diese Informationen tauchte er so geschmeidig ein wie eine Robbe ins Wasser.
Als er seine persönliche Datei, die konfiszierte Datei, im System gefunden hatte, gab er einen raffinierten Nutzercode für sie ein, beschloss aber gleich darauf, lieber auf Nummer sicher zu gehen. Es bestand ja immerhin die – wenn auch unwahrscheinliche – Möglichkeit, dass jemand genauso einfallsreich war wie er. Also löschte er die Datei vollständig.
Als Nächstes suchte er die Dateien, in denen die Krankenversicherungen der Angestellten festgehalten waren. Er änderte seine eigenen Versicherungsbedingungen so geschickt ab, dass ihm niemand draufkommen würde. Nachforschungen von außen würden ergeben, dass er auch nach Ausscheiden aus der Firma in vollem Umfang weiterversichert war. Dass er keine Beiträge zahlte, würde nicht auffallen.
Da er sich nie richtig gesund fühlte, war ihm die Krankenversicherung wichtig.
Er dachte kurz darüber nach, auf welche Weise er Genetron sonst noch schädigen konnte, entschied sich aber gegen weitere Eingriffe, denn er war nicht auf Rache aus. Schließlich schaltete er das Gerät ab.
Nur zwei Tage, verblüffend wenig Zeit, vergingen, bis jemand die Löschung der Datei bemerkte. Früh am Morgen stellte Rothwild ihn auf dem Gang zur Rede und teilte ihm mit, er dürfe sein Labor nicht mehr betreten. Vergil protestierte halbherzig dagegen und sagte, er wolle wenigstens den Karton mit persönlichen Dingen an sich nehmen.
»Also gut, aber nichts sonst. Keine biologischen Substanzen. Und ich will alles sehen.«
Gelassen erklärte Vergil sich einverstanden. »Was ist denn überhaupt los?«, fragte er.
»Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht genau«, erwiderte Rothwild. »Und ich will’s auch gar nicht wissen. Ich hab mich für Sie verbürgt, genau wie Thornton. Sie haben uns alle sehr enttäuscht.«
Vergil dachte fieberhaft nach. Er hatte die Lymphozyten noch nicht beseitigt, da er angenommen hatte, sie würden, durch ein falsches Etikett getarnt, im Kühlschrank des Labors nicht weiter auffallen. Nie hätte er gedacht, dass der Schlag ihn so schnell treffen würde. »Ich bin also entlassen?«
»Ja, Sie sind entlassen. Und ich fürchte, es wird Ihnen auch schwer fallen, irgendwo sonst in der Privatwirtschaft eine Anstellung im Labor zu finden. Harrison ist stinksauer auf Sie.«
Als sie das Labor betraten, war Hazel schon an der Arbeit. Vergil holte den Karton aus der gemeinsam genutzten Zone unterhalb der Spüle heraus, wobei er das Etikett mit der Hand verdeckte. Während er die Schachtel anhob, riss er den Aufkleber unauffällig ab, knüllte ihn zusammen und warf ihn in den Abfalleimer. »Noch eine Sache«, sagte er. »Da sind noch einige fehlgeschlagene Proben, die mit Tracern versehen sind. Die müssen entsorgt werden. Ordnungsgemäß, schließlich sind es Radionuklide. «
»Oh Scheiße«, fuhr es Hazel heraus. »Wo sind die denn?«
»Im Gefrierschrank. Keine Sorge, ist nur Kohlenstoff 14. Darf ich?« Er sah Rothwild an, der ihm bedeutete, er möge den Karton zur Inspektion auf einen Arbeitstisch legen. »Darf ich?«, wiederholte Vergil. »Möchte doch nichts herumliegen lassen, das sich als schädlich erweisen könnte.«
Nachdem Rothwild widerwillig zugestimmt hatte, ging Vergil zum Gefrierschrank hinüber, legte seinen Laborkittel über einen Arbeitstisch, ließ die Hand über eine Schachtel mit Injektionsspritzen gleiten und nahm heimlich eine heraus.
Der Ständer mit den Lymphozyten befand sich im untersten Fach. Vergil kniete sich hin, holte eines der Reagenzgläser heraus, führte die Kanüle hastig ein und zog zwanzig Kubikzentimeter des Serums auf. Da die Spritze noch nie benutzt worden war, hielt er sie für einigermaßen steril. Er hatte keine Zeit, sie mit Alkohol abzureiben. Dieses Risiko musste er eingehen.
Ehe er sich die Nadel injizierte, fragte er sich kurz, was er da überhaupt tat und was er sich davon erwartete. Schließlich bestand nur eine winzige Chance, dass die Lymphozyten überleben würden. Möglicherweise hatte er sie durch seine Eingriffe so verändert, dass sie, unfähig zur Anpassung, in seiner Blutbahn absterben würden. Oder sie würden völlig aus der Art schlagen: Dann würde sein Immunsystem sie für Fremdkörper halten und vernichten.
So oder so konnten aktive Lymphozyten im menschlichen Körper nur Wochen überleben. Für die Polizisten des Körpers war das Leben hart.
Als die Nadel unter die Haut drang, spürte er ein sanftes Brennen und einen kurzen Stich. Gleich darauf merkte er, wie sich die kalte Flüssigkeit mit dem Blut vermischte. Er zog die Nadel heraus und verstaute die Spritze unten im Gefrierschrank. Danach griff er nach den Reagenzgläsern und der Spinnerflasche, blieb kurz stehen und schob die Kühlschranktür zu.
Nervös sah Rothwild zu, wie Vergil sich Gummihandschuhe überstreifte und ein Reagenzglas nach dem anderen in einen halb mit Äthanol gefüllten Laborbecher leerte. Als Letztes goss er die Flüssigkeit aus der Spinnerflasche hinein, verschloss den Laborbecher mit leichtem Grinsen, schwenkte ihn so, dass der Inhalt sich vermischte, und verfrachtete ihn in einen Abfalleimer für biologische Gefahrenstoffe. Den Eimer schob er mit dem Fuß auf Rothwild zu. »Hier haben Sie’s.«
Inzwischen hatte Rothwild die Notizhefte durchgesehen. »Eigentlich bin ich fast der Meinung, dass wir diese Aufzeichnungen behalten sollten«, bemerkte er. »Schließlich haben Sie jede Menge regulärer Arbeitszeit dazu benutzt. «
»Dann werde ich Genetron verklagen und in jeder Fachzeitschrift, die mir einfällt, mit Dreck bewerfen«, erwiderte Vergil, immer noch dämlich grinsend. »Nicht gerade gut für die Marktposition eines aufstrebenden Unternehmens, oder?«
Rothwild, dessen Hals und Wangen rot angelaufen waren, musterte ihn mit gesenkten Lidern. »Raus hier!«, sagte er. »Den restlichen Kram schicken wir Ihnen nach.«
Vergil griff nach dem Karton. Das kalte Gefühl im Unterarm war verschwunden. Rothwild eskortierte ihn die Treppe hinunter und den Fußgängerweg entlang bis zum Werkstor, wo Walter Vergils Dienstmarke mit unbewegter Miene entgegennahm. Rothwild folgte Vergil sogar noch auf den Parkplatz.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: