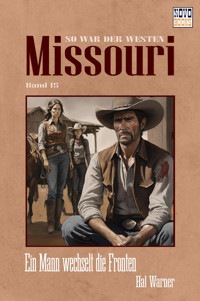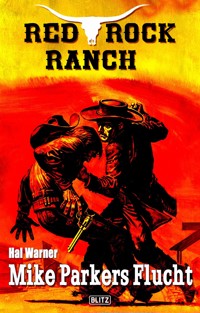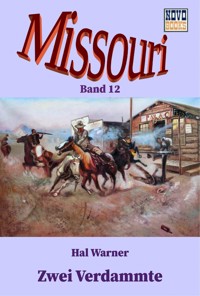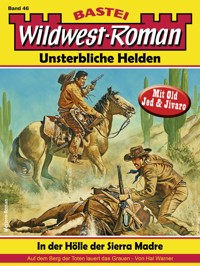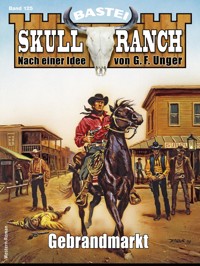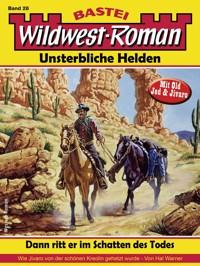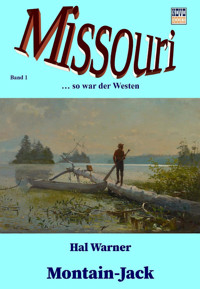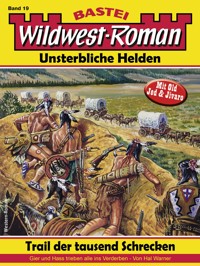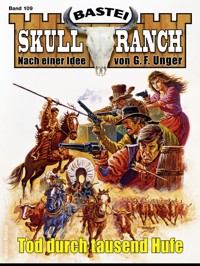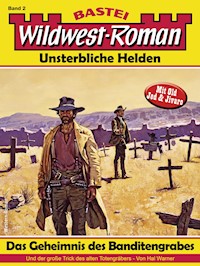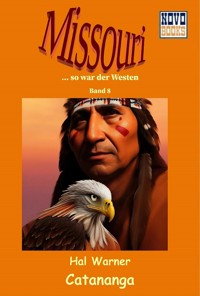
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Missouri
- Sprache: Deutsch
Entsetzen packte die Bewohner von Adobe Walls, der kleinen Stadt im Panhandle von Texas. Soeben hatten sie erfahren, dass die Kiowas das Kriegsbeil ausgegraben hatten. Eine ganze Büffeljäger-Mannschaft war von ihnen draußen auf den Plains massakriert worden. Das gab ihnen die Zuversicht, auch Adobe Walls, den Hauptstützpunkt aller Büffeljäger, anzugreifen und zu vernichten. Und über der ganzen grausigen Szenerie stand ein Name wie ein Fluch: CATANANGA! Angst und Schrecken verknüften sich mit diesem Namen. Wer war dieser neue junge Häuptling der Kiowas, der so auffallend hellhäutig war? Ein deutscher Western in Ebook-Erstauflage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hal Warner
Catananga
Inhaltsverzeichnis
Catananga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bisher bei Novo-Books erschienen
Catananga
Hal Warner
Impressum
Copyright: Novo-Books im vss-verlag
Jahr: 2024
Lektorat/ Korrektorat: Franz Groß
Covergestaltung: Hermann Schladt
Verlagsportal: www.novobooks.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
1
„ Indianer...!“ Dieser Schrei gellte über die Prärie, und schon war die Hölle los.
Es waren mindestens vierzig Kiowas. Wie aus dem Boden gewachsen tauchten sie zwischen den Bäumen auf und jagten auf flinken Mustangs auf die Gruppe der Büffeljäger zu.
McLean und Jefferson hatten nur ihre Revolver bei sich. Fluchend rissen sie sie heraus, warfen sich hinter erlegte Bisons in Deckung und feuerten auf die anstürmenden Indianer.
Doch ihre Schüsse waren in der Aufregung schlecht gezielt. Ehe sie einen der Kiowas trafen, waren die halbnackten Reiter schon heran und warfen sich auf die verhassten Gegner. Auch O’Connor schoss mehrmals daneben. Betroffen sah er, wie Jefferson von einer Lanze am Boden festgenagelt wurde. Im nächsten Moment schrie McLean markerschütternd auf. Eine Streitaxt hatte sich in seine Schulter gegraben.
O’Connor holte mit seinem Blei einen Kiowa vom Pferd. Dann warf er sich herum und rannte Richtung Lager. Aber er kam nur wenige Schritte weit. Etwas bohrte sich in seinen Rücken und erzeugte dabei einen glühenden Schmerz. Dass es ein Pfeil war, wusste er nicht mehr. Er stürzte aufs Gesicht, grub die Hände in die Erde und starrte mit glasig werdenden Augen ins Leere.
Die anderen zogen sich kämpfend zu den Wagen zurück.
Sie waren noch sieben. Doch nur fünf von ihnen erreichten das Camp. Dort scharten sie sich bei den Wagen zusammen und schossen auf die Kiowas, was ihre Läufe hergeben konnten.
Zwei, drei der wilden Reiter kippten getroffen von den Pferden. Die anderen jagten schreiend weiter und überschütteten die Weißen mit einem Hagel aus Pfeilen. Mehrere Kiowas schossen auch mit Gewehren.
Craig brüllte auf. Er ließ sein Gewehr fallen, umklammerte einen aus seiner Brust ragenden Pfeilschaft und torkelte zwei Schritte rückwärts, ehe er zusammenbrach.
Sekunden später erwischte es auch Meece Callahan. Von einer Lanze durchbohrt, fiel er auf die Knie und drückte noch im Sterben seinen Revolver ab.
Roy Tamblin und die beiden anderen noch lebenden Büffeljäger wurden mit den Roten in ein Handgemenge verwickelt. Die Übermacht war erdrückend. Mindestens vier Indianer warfen sich auf Roy und versuchten, ihn zu Boden zu reißen. Aber Roy entwickelte übermenschliche Kräfte. Er schleuderte zwei der Gegner von sich, schmetterte dem dritten seinen leer geschossenen Colt ins Gesicht und griff den vierten mit bloßen Fäusten an. Mit einem harten Schlag schickte er auch ihn auf die Erde.
Im nächsten Moment wurde Roy von rückwärts angesprungen. Er stürzte mit dem Angreifer zu Boden und prallte hart auf. Die Luft blieb ihm weg. Gerade noch rechtzeitig sah er das Messer kommen und warf sich zur Seite, entging der Klinge knapp und umspannte verzweifelt das Handgelenk des wütend knurrenden Indianers.
Sie wälzten sich über den Boden, kämpften um das Messer, und jeder versuchte, den anderen unter sich zu bekommen. Dabei gerieten sie über den Rand der Uferböschung und rollten den Steilhang hinab. Eng umschlungen stürzten sie in das aufspritzende Wasser.
Roy schlug gegen einen aus dem Fluss ragenden Felsen und verlor fast die Besinnung. Er war auf das Ende gefasst, erwartete den tödlichen Stich. Doch sein Gegner hatte bei dem Sturz das Messer verloren und hatte selbst gegen die Strömung zu kämpfen, die sie beide fortriss. Während sich der Indianer mit der einen Hand über Wasser hielt, versuchte er mit der anderen, Roy Tamblin unter die Oberfläche zu drücken.
Sie stießen gegen Treibholz. Roy klammerte sich fest und holte tief Luft. Dann schlug er mit der Rechten nach dem Kiowa und traf dessen hassverzerrtes Gesicht.
Der Indianer lockerte seinen Griff. Roy nutzte das sofort aus und schlug noch einmal zu. Diesmal mit aller Kraft, die er noch besaß. Der Kiowa vergaß zu schwimmen und sackte ab, kam ein Stück flussabwärts noch einmal hoch, prallte aber mit dem Kopf gegen eine von weißer Gischt umschäumte Klippe und versank gänzlich in den Fluten.
Roy kam nicht zum Verschnaufen. Am Uferrand krachten Schüsse und schnellten Pfeile von zähen Bogensehnen. Mehrere Kiowas hatten die Szene im Wasser verfolgt und bemühten sich nun, dem jungen Büffeljäger den Garaus zu machen.
Die Kugeln wühlten rings um Roy das Wasser auf. Er tauchte unter und spürte im nächsten Moment einen harten Schlag an den Rippen. Vor seinen Augen wurde es schwarz. Rauschend schlugen die Fluten über ihm zusammen.
Die Indianer sahen, wie sich das Wasser rot färbte, und heulten triumphierend auf. Sie hielten ihren Feind für erledigt. So machten sie sich nicht die Mühe, nach ihm zu suchen, sondern kehrten auf die Uferlichtung zurück, um ihren Sieg über die Büffeljäger zu feiern.
*
Das kalte Wasser brachte Roy wieder zu sich. Er spürte, wie er gegen etwas stieß, griff instinktiv danach, fand aber keinen Halt. Ein dumpfer Schmerz durchzog seine linke Seite und lähmte den Arm. Gleichzeitig überkam ihn panische Angst.
Diese Angst war es, die seinen Selbsterhaltungstrieb wieder zum Vorschein treten ließ. Er war kurze Zeit bewusstlos gewesen, und jetzt drohte ihm der Tod durch Ertrinken.
Er hatte bereits eine Menge Wasser geschluckt. In seinen Ohren rauschte das Blut. Doch nun nahm er seine letzten Kräfte zusammen und bekämpfte seine Not.
Dem Ersticken nahe, gelang es ihm, die Oberfläche zu erreichen. Dicht vor ihm befand sich ein treibender Baumstamm. Er klammerte sich an einen geborstenen Ast und spie einen Schwall schlammiges Wasser aus. Dann ließ er sich einfach treiben.
Nichts wies mehr auf die Nähe von Indianern hin, Er hörte keine Schüsse mehr, kein Geheul. Nur der reißende, brüllende Fluss war um ihn, der hier ziemlich breit war und viele Strudel aufwies. Schnell glitten die felsigen Steilufer an Roy Tamblin vorüber.
Als er sich etwas erholt hatte, ließ er den Baumstamm los und trachtete mit kräftigen Schwimmstößen das nördliche Ufer zu erreichen. Erleichtert stellte er fest, dass sich die Linke doch gebrauchen ließ, wenn er nur den nötigen Willen aufbrachte und die Schmerzen verbiss.
Langsam kam die Uferbank näher. Er wurde zwar weit abgetrieben, doch er hatte Glück und gelangte in seichtes Wasser, ehe ihn die Kräfte verließen. Keuchend richtete er sich auf.
Er hatte es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wenige Yards flussabwärts ragten gefährlich aussehende Klippen aus der schäumenden Flut und war die Strömung so stark, dass sie Roy Tamblin unweigerlich fortgerissen hätte. Er hätte in seinem Zustand keine Chance mehr gehabt.
Noch immer keuchend, watete er dem Ufer zu, das hier ziemlich dicht mit Büschen bewachsen war. Eine Minute später warf er sich erschöpft auf das sonnenheiße Geröll.
Er begriff, dass er der einzige Überlebende war. Roy verdankte seine Rettung einer glücklichen Schicksalsfügung. Doch in Sicherheit war er lange noch nicht.
Die Indianer kamen ihm in den Sinn. Suchten sie nach ihm? Wussten sie, dass er noch lebte?
2
Die beiden Büffeljäger betraten den Laden und sahen sich um. Beide grinsten, als sie das junge Mädchen erblickten, und der eine von ihnen, ein hünenhafter rotbärtiger Mann, pfiff überrascht durch die tabakbraunen Zähne.
Aber das Mädchen bot auch wirklich ein erfreuliches Bild. Es war neunzehn oder zwanzig Jahre alt, gertenschlank und von einer fremdartigen Schönheit. Mandelförmige Augen beherrschten das dunkelgetönte Gesicht, und die leicht vorstehenden Wangenknochen verrieten einen Schuss indianisches Blut.
„ Was kann ich für Sie tun?“ fragte sie. Ihre Stimme klang dunkel und angenehm.
Der Rotbärtige räusperte sich. „Wir brauchen Vorräte, Miss. Aber wir haben kein Geld. Sie sind doch sicher an einem Tauschgeschäft interessiert?“
„ Kommt ganz darauf an“, entgegnete Quinny Flatbush mit einem freundlichen Lächeln. „Mein Bruder wird darüber entscheiden .., Jim!“
„ Komme schon!“ Ein Vorhang, der den großen, mit Waren aller Art angefüllten Raum von einem zweiten Raum abgrenzte, wurde zur Seite geschoben, und ein junger dunkelhaariger Mann erschien.
Auch Jim Flatbush war sofort als Halbblut zu erkennen, obwohl er ebenfalls wie ein Weißer gekleidet war. Er war wenige Jahre älter als Quinny, schlank, sehnig und ziemlich groß. Auch er sah blendend aus und besaß eine stolze Haltung und gute Manieren. Man hätte ihn ohne weiteres für einen spanischen Grande halten können.
Er grüßte höflich und erkundigte sich nach den Wünschen der beiden Besucher, woraufhin der Rotbärtige sein Anliegen wiederholte.
„ Was wir brauchen, macht ungefähr fünfhundert Dollar aus“, erklärte der schmierig und abgerissen wirkende Büffeljäger. „Aber wir möchten nicht mit Bargeld, sondern mit Büffelhäuten bezahlen. Erstklassige Ware, mein Freund.“
„ Das glaube ich Ihnen“, erwiderte Jim Flatbush. „Aber die Sache hat einen Haken: Ich nehme keine Büffelhäute.“
„ Wieso nicht? Das hier ist doch eine Handelsagentur.“
„ Richtig. Ich kaufe auch alles an Pelzen und Fellen - nur keine Büffelhäute!“
Der Rotbärtige und sein Partner, ein hartäugiger und verwegen aussehender Mann, blickten sich kurz an. Dann fuhr der Rotbärtige, an Jim gewandt, fort: „Überlegen Sie es sich. Die Häute sind von bester Qualität. Vielleicht sehen Sie sie sich einmal an.“
„ Nein.“ Der Mestize schüttelte den Kopf. „Was ich gesagt habe, gilt. Verkaufen Sie Ihre Häute an Hayes, der nimmt sie Ihnen sicher gern ab.“
Der Büffeljäger verzog enttäuscht das grob geschnittene Gesicht. „In Ordnung“, knurrte er. „Aber Sie werden mit uns kein Geschäft mehr machen, Mister. Darauf können Sie wetten!“
Verärgert zogen die beiden Büffeljäger ab. Keiner sagte zum Abschied einen Gruß, doch beide starrten nochmals verlangend auf das Mädchen.
„ Ich denke, das war ein Fehler“, sagte Quinny, als die Tür ins Schloss gefallen war.
„ Warum sollte es ein Fehler gewesen sein?“ erkundigte Jim Flatbush sich ruhig. „Du kennst doch meinen Standpunkt.“
„ Sicher“, meinte Quinny. „Aber ich finde, du solltest ihn ändern. Und zwar bald, Jim.“
Er antwortete nicht, sondern trat zur Tür und blickte durch die bunte Glasscheibe den zwei Männern nach, die nebeneinander über die staubige Straße von Adobe Walls gingen, hinüber zum Konkurrenzbetrieb von Lorne Hayes.
Quinny sprach weiter: „Was macht es schon aus, wenn du Büffelhäute kaufst? Wenn du sie nicht nimmst, dann tut es eben Hayes oder ein anderer Mann.“
„ Ich weiß“, entgegnete Jim. „Aber für mich ändert sich dadurch nichts. Denn ich werde keine Sekunde lang vergessen, dass unsere Mutter eine Indianerin war. Es wäre ein Verbrechen an ihrem Stamm, würde ich mich beteiligen an diesem schändlichen Geschäft.“
Quinny seufzte. „Du hast ja recht, Jim. Die Jägertrupps rotten die Büffelherden aus und liefern damit die Indianer dem Hungertod aus. Du willst das nicht unterstützen. Aber du bedenkst dabei nicht, dass du die Entwicklung der Dinge sowieso nicht aufhalten kannst. Die Büffel werden verschwinden, ganz gleich, ob du von den Jägern Häute kaufst oder nicht. Nein, du kannst durch dein Verhalten wirklich nichts ändern. Du erreichst damit nur, dass wir dem Ruin entgegengehen. Hayes macht schon jetzt den Großteil des Geschäfts.“
„ Und wenn schon“, brummte Jim. „Mir liegt ohnehin nicht viel an dem Laden.“
„ Und an unseren Vater, der uns das alles hinterlassen hat, denkst du wohl überhaupt nicht?“
Jim überhörte nicht den Vorwurf seiner Schwester und wandte sich um, um ihren Blick ernst zu erwidern. „Doch! Was er für uns getan hat, vergesse ich nie. Ich bin überzeugt, er hat für uns nur das Beste gewollt. Aber er hat nicht wissen können, wie sehr sich die Dinge ändern würden.“
„ Alles ändert sich, Jim. Wir gehen einer neuen Zeit entgegen. Und wir müssen froh sein, dass wir wie Weiße leben können. Als Indianer gäbe es keine Zukunft für uns. Wir müssen uns anpassen, Jim.“
„ Wenn du damit den Handel mit Büffelhäuten meinst, dann ist es besser, du verschwendest kein Wort mehr“, versetzte Jim finster. „Hast du mich verstanden?“
Quinny wollte keinen Streit heraufbeschwören und wechselte daher schnell das Thema. „Morgen feiert man in der Stadt den Unabhängigkeitstag. Der Town Mayor veranstaltet ein großes Fest. Gehen wir hin?“
„ Weiß ich noch nicht“, brummte Jim. „Vielleicht.“
Quinny lächelte; weiße Zähne blitzten in dem hübschen Gesicht. „Wenn du vielleicht sagst, dann ist das so gut wie eine Zusage, Jim. Ich wusste ja, dass du mir diesen Wunsch nicht abschlagen wirst.“
Er brummte etwas und ging hinaus, uni vor der Tür auf dem Brettersteig stehenzubleiben.
Drüben, genau gegenüber, befand sich Lome Hayes’ stattlicher Besitz. Er bestand aus mehreren Gebäuden und einem riesigen Frachthof, in dem ständig reger Betrieb herrschte. Hayes besaß Dutzende von Wagen, mit denen er wichtige Frachtgüter ins Land brachte und Büffelhäute zu Tausenden zur Bahnlinie beförderte.
Nachdenklich betrachtete Jim das protzige Schild, auf dem in großen Lettern zu lesen stand: „Lorne Hayes’ Pandandle Cargo, General Store & Pelzhandelsagentur.“
Er machte sich nichts vor. Hayes war drauf und dran, ihn geschäftlich an die Wand zu drücken. Aber Jim Flatbush war nicht der Mann, den das allzu sehr störte. Außerdem wusste er, dass die rückläufige Entwicklung des Unternehmens zum Großteil seine eigene Schuld war.
Jim war der Sohn eines Engländers und einer Kiowa-Squaw. Sein Vater war in dieses Land gekommen, als hier alles noch im Urzustand war. Zusammen mit anderen Pionieren hatte er Adobe Walls gegründet, sich mit den Indianern arrangiert und mit ihnen Tauschhandel betrieben. Dabei hatte Samuel Flatbush es zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Als seine Frau starb, nahm er die Erziehung seiner Kinder selbst in die Hand, lehrte sie Lesen und Schreiben und hatte sie später sogar in eine höhere Schule geschickt.
Aber vor einem halben Jahr hatte auch der alte Flatbush das Zeitliche gesegnet. Jim und Quinny brachen ihr Studium notgedrungen ab und kehrten nach Adobe Walls zurück, um das Geschäft ihres Vaters zu übernehmen.
Bei ihnen im Haus lebte noch Jeremiah Hawkins, ein bärtiger Oldtimer, der Samuel Flatbushs Freund gewesen war.
Hier hatte sich in den letzten Jahren eine Menge verändert. Die Ansiedlung war stark gewachsen und zu einem Stützpunkt für Büffeljäger geworden, die in Feindschaft mit den roten Stämmen lebten, so dass schon lange keine Indianer mehr nach Adobe Walls kamen, um Felle anzubieten und Waren zu erwerben.