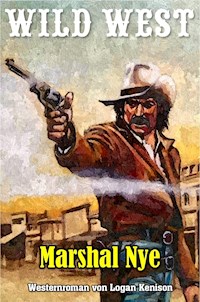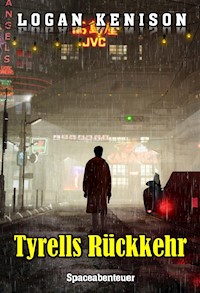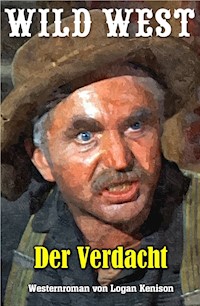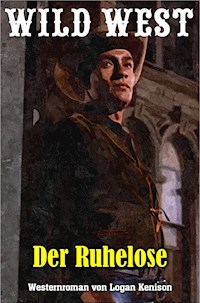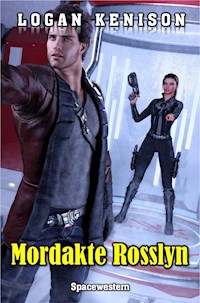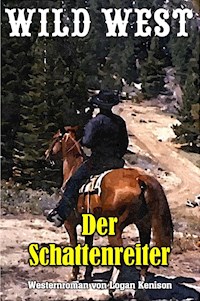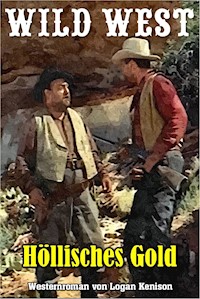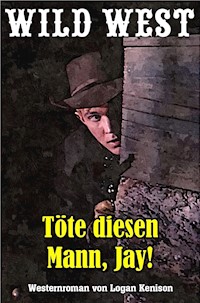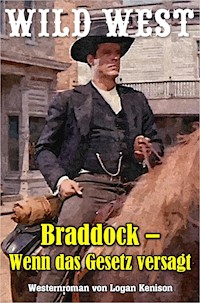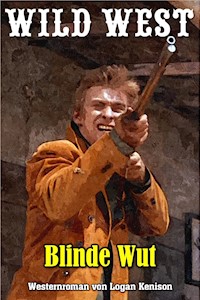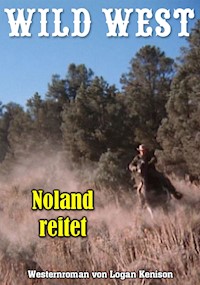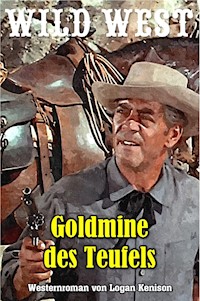Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1870 Ich hatte den halben Vormittag lang die Tiere versorgt, schließlich trat ich aus dem Stall. Da sah ich Pepe Holguin. Er ritt gerade auf seinem Esel über die Hügelkuppe. Am Zügel führte er ein Pferd mit sich. Schließlich kam es ganz in Sicht, und ich erkannte den Toten, der quer über dem Sattel lag. Plötzlich fühlte ich Schwindel aufsteigen. Mir war, als stürzte ich rücklings in einen tiefen Brunnen. Die Kalbslederweste, die abgegriffene Colt im Holster … Der Tote war mein Bruder Jake.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cowboy
am Scheideweg
Westernroman
von Logan Kenison
Das Buch
Die McNally-Brüder kamen aus dem Norden und wollten in Texas eine neue Existenz aufbauen – doch sie gerieten in die Fänge eines raubgierigen Großranchers, und eines Tages stand Zeke McNally am Scheideweg …
Der Autor
Logan Kenison (vormals Joe Tyler) ist Autor von Western-, Abenteuer- und Spacegeschichten. Neben seinen Western, die er mit Leidenschaft verfasst, schreibt er seit 2018 die Reihe Spacewestern.
Inhalt
Impressum
Cowboy am Scheideweg (Roman)
Weitere Werke von Logan Kenison
Copyright © 05/2015 by Logan Kenison
Lektorat: Carola Lee-Altrichter
Abdruck auch auszugsweise
nur mit Genehmigung des Autors.
Das Cover wurde gestaltet nach Motiven der Episode "Gefährliche Freundschaft" (Orig.: "Showdown", USA, 1960) der Bonanza-Komplettbox. Im Handel auf DVD erhältlich. Mit freundlicher Genehmigung von www.fernsehjuwelen.de
Kontakt: [email protected]
Joe Tyler
Cowboy am Scheideweg
Western
1870
Ich hatte den halben Vormittag lang die Tiere versorgt, schließlich trat ich aus dem Stall. Da sah ich Pepe Holguin. Er ritt gerade auf seinem Esel über die Hügelkuppe. Am Zügel führte er ein Pferd mit sich. Schließlich kam es ganz in Sicht, und ich erkannte den Toten, der quer über dem Sattel lag.
Plötzlich fühlte ich Schwindel aufsteigen. Mir war, als stürzte ich rücklings in einen tiefen Brunnen.
Die Kalbslederweste, die abgegriffene Colt im Holster …
Der Tote war mein Bruder Jake.
*
Pepe Holguin war der mexikanische Helfer, den wir auf der Ranch angestellt hatten. Unsere Ranch – das war der kleine Flecken Land, den wir gemäß dem Homestead Act abgesteckt hatten und großspurig die McNally-Ranch nannten.
Mit reichlich Illusionen beladen waren wir vor fünf Jahren ins Rio Grande Valley gekommen. Aufgebrochen waren wir von Massachusetts, meine Brüder William und Jacob sowie ich, Ezekiel McNally. Nach dem Tod unserer Eltern verließen wir sozusagen die Zivilisation und zogen westwärts. Es war uns zu eng geworden in Neuengland, wo unser Pa – Amerikaner der zweiten Generation und geboren 1821 in den kleinen Ort Plimsoll – sein Auskommen mehr schlecht als recht als Kesselflicker und Scherenschleifer gehabt hatte.
In Kindertagen hatten wir eine gewisse Schulausbildung erhalten. Wir konnten Lesen, Schreiben und Rechnen. Mein ältester Bruder Will war während des Sezessionskriegs ein Jahr lang zur See gefahren, danach hatte er die Nase von schaukelnden Planken voll gehabt. Er arbeitete danach als Rausschmeißer in McKenny’s Beer-Bar, später holte er Jake nach.
Schließlich war auch ich alt genug geworden, und wir überlegten, was wir tun konnten.
Unser Pa lauschte mit mürrischer Miene unseren Gesprächen, die mehr und mehr mit Begeisterung durchwachsen waren. Für uns stand außer Frage, dass er mit uns kam. Doch er wollte nicht. Er hatte nach Ma’s Tod eine nette Dame kennengelernt, Mrs Gertrude Montag, eine deutsche Witwe aus der Chumshag Road, mit der er oft und gern zusammen war. Vielleicht hätte er ihr in Kürze einen Antrag gemacht, doch da raffte ihn die Diphterie im Alter von achtundvierzig dahin. Wir begruben ihn auf dem Cemetery neben unserer Ma und zogen fort.
Fast waren wir so blauäugig wie die Auswanderer, deren Eintreffen wir wöchentlich am Hafen beobachten konnten. Sie besorgten sich Wagen und Ausrüstung und brachen auf nach Westen. Grüne Täler, Weide-, Farm- und Ackerland warteten auf alle, die sich ihren Teil davon nehmen wollten. So hieß es in den Zeitungen und Magazinen. Gesellschaften, die den Siedlern halfen, Fuß zu fassen, schossen wie Pilze aus dem Boden. Es kursierten die tollsten Geschichten. Viele Iren, die 1859 aufgrund der Hungersnot in die Staaten ausgewandert sind, seien heute reiche und wohlhabende Farmer, Rancher und Handwerker. Weit drüben im Westen, so hieß es.
Andere hatten ihr Glück in den Goldfeldern gemacht. 1848 war in Kalifornien auf Sutter’s Mill Gold entdeckt worden. Die Zeitungen berichteten von Nuggets in der Größe von Taubeneiern. Nachdem sich dies herumgesprochen hatte, waren 1849 Tausende dorthin gepilgert in der Hoffnung, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden.
Wieder andere machten Ihr Glück beim Eisenbahnbau, welcher sich über Jahre erstreckte und den Westen mit dem Osten verband. Der neue Handelsweg erschloss ungeahnte Möglichkeiten für alle, die etwas produzierten. Handelsvertreter schwärmten aus und kauften Ernten auf.
Die Fackel unserer Begeisterung brannte längst schon lichterloh. Egal, was man anfasste, alles schien sich in Gold zu verwandeln. Unsere Unzufriedenheit in New England wuchs von Tag zu Tag. Kein Wunder, dass wir die Gelegenheit beim Schopf griffen und mit Sack und Pack nach Westen zogen.
Was die Berichte allerdings verschwiegen hatten, waren das Blut, die Tränen und den Schweiß, den die Menschen vergossen, bevor sie dem Land auch nur ihren Lebensunterhalt abzuringen vermochten.
Viele Trecks waren von habgierigen Händlern, inkompetenten Führern und Banditen ausgenommen worden. Auch die Indianer waren ein ständiges Problem. Selbst relativ häufig befahrene Wege und Forts boten keine Sicherheit. Immer wieder kam es zu Hinterhalten, Überfällen, gar Massakern. Jedem Siedler wurde geraten, sich bis an die Zähne zu bewaffnen, wenn er durch Indianerland fuhr.
Inzwischen waren einige Verrückte dazu übergegangen, im Indianerland zu siedeln. Voraussetzung war, dass es fruchtbar war und reiche Ernte versprach. Die US Army hatte sich nach dem Sezessionskrieg auf einen neuen Gegner eingestimmt: Die Rothäute. Diese galt es nun zu vertreiben. Washington gab dafür nur allzu oft und allzu bereitwillig grünes Licht. Stämme wurden dörferweise umgesiedelt. Jene, die sich weigerten, wurden massakriert.
Wir McNally-Brüder waren im Frühjahr 1870 mit einem Wagenzug nach Südwesttexas gezogen und hatten uns bei passender Gelegenheit nach Süden verabschiedet. Unser Ziel war das Rio Grande Valley. Hier gab es gewaltige Flächen freien Landes. Der Westen von Texas war dünn besiedelt und bot uns Platz zum Ausbreiten – genau das, was unsere nach Freiheit schreienden Seelen suchten.
Während wir allein unterwegs waren, bekamen wir es mit Indianern zu tun. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Wir fuhren mit unserem Conestoga-Schoner durch die menschenleere Prärie und wirbelten eine Menge Staub auf. Noch nie, so schien es, war hier ein Wagen gefahren. Es gab keine Spuren, keinen Weg. In alle Himmelsrichtungen dehnte sich die Prärie als gewaltige Ebene. Der Himmel spannte sich tiefblau über uns, durchzogen von watteweißen Wolken von Horizont bis Horizont. Keine Lufttrübung erschwerte die Sicht, wir sahen gewiss dreißig oder vierzig Meilen weit.
Plötzlich sausten Pfeile und Kugeln auf uns zu, zerschnitten die Wagenplane, fauchten an uns vorüber. Als wir uns erschreckt umsahen, tauchten wie Gespenster sieben oder acht Indianer auf ihren Ponys aus der Staubwolke auf, griffen uns mit verbissenen Mienen an. Wir wussten nicht, wo sie hergekommen waren und wie es ihnen gelungen war, sich uns unbemerkt zu nähern.
Jedenfalls waren sie da. Wir erwiderten das Feuer. Als Nachkommen irischer Einwanderer wussten wir, was es bedeutete zu kämpfen. Wir gaben ihnen zurück, was wir konnten. Während Jake die Pferde wild schreiend vorwärtsjagte, schossen Will und ich in die Indianer hinein.
Damals tötete ich zum ersten Mal einen Menschen.
Er war nahe herangekommen, schwang sein Tomahawk, um mich auf dem Wagen zurückzudrängen. Dann streckte er die Hand aus, wollte das Gestänge ergreifen, über das die Plane gespannt war, um sich auf den Schoner zu schwingen. Ich hielt Pa’s alten 1851er Navy-Colt in der Hand und drückte den Abzug. Es gab einen Blitz und ein gewaltiges Krachen. Der Rückstoß war furchtbar, mir tat das Handgelenk so sehr weh, dass ich den Colt beinahe fallengelassen hätte.
Ich sah, wie auf seiner Brust ein Loch entstanden war, aus dem stoßweiße Blut auf die Mähne seines Mustangs spritzte.
Er zuckte nicht zusammen, zog nur die ausgestreckte Hand langsam zurück. Blickte zu mir hoch, mir direkt in die Augen, ein junger Bursche von vielleicht zwanzig Jahren. Er wusste, was geschehen war. Ich wusste es auch. Wir beide wussten, dass es unumkehrbar war. Was jetzt folgte, musste mit aller Bitterkeit ertragen werden – von ihm wie von mir. Es gab keine Hoffnung, keinen Rückzug mehr.
Plötzlich war in meinen Ohren ein Rauschen, das alle anderen Geräusche ausblendete. Ich bekam nicht mit, wie wir weiterjagten, über Steine und Unebenheiten holpernd.
Der Indianer blieb mehr und mehr zurück. Im wehenden Staub sah ich, wie sein Tier stehenblieb. Viele Sekunden lang hielt er sich auf dem Pferderücken, versuchte, die Balance zu halten. Ich war wie versteinert, konnte den Blick nicht von ihm nehmen.
Dann kippte er um.
Mit dem Oberkörper prallte er auf den harten Wüstenboden.
Ich war so gelähmt, dass mich ein anderer Krieger beinahe erwischt hätte. Will schlug mir mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf und schrie etwas, und es war, als erwachte ich aus einer Trance.
Ich begriff, dass ich es mir nicht leisten konnte, mich meinen Gefühlen hinzugeben, mochten sie noch so furchtbar, noch so gewaltig sein. Nicht jetzt, wo uns die Indianer immer heftiger bedrängten.
Ich hob die schmerzende Hand und feuerte. Die ganze Trommel leerte ich in die angreifenden Indianer hinein. Will tat dasselbe mit der Winchester. Danach ergriff ich Jakes Henry Rifle und legte bereits erneut an, als sich der Abstand zwischen ihnen und uns plötzlich vergrößerte.
Sie ließen sich zurückfallen.
»Die haben genug!«, brüllte Will. Er jagte eine letzte Kugel in ihre Richtung, traf jedoch keinen mehr.
In einem Kampf um Leben und Tod hatten wir den Sieg errungen, aber in uns war keine Freude. Eine gewaltige Aufregung hatte uns gepackt. Wir waren nicht mehr in der Lage, weiterzufahren. Deshalb fuhren wir noch zwei Meilen, dann suchten wir uns einen Lagerplatz, der gut verteidigt werden konnte.
Ich zitterte, als ich vom Wagen stieg.
»Der Kleine war heute ein richtiger Held«, meinte Will. Er hielt mir die Steinflasche mit dem Whisky hin, von der normalerweise nur er und Jake nehmen durften.
Bislang war mir das Getränk streng verboten gewesen. Ich war ja der Jüngste der Brüder, gerade erst siebzehn Jahre alt, während Jake fünf und Will acht Jahre älter waren. Wären unsere anderen Brüder und Schwestern nicht bereits im Säuglingsalter gestorben, hätten wir noch sieben weitere Geschwister. So aber waren wir nur drei.
An jenem Tag hatte Will es für gut befunden, mich mit dem Whisky bekannt zu machen. Nicht nur das Töten, sondern auch der Alkohol war mir von diesem Tag an bekannt. Ich nahm einen Zug aus der Flasche, verschluckte mich und hustete.
»Hey, pass’ auf, dass du nichts verschüttest«, rief Jake und nahm mir die Flasche ab.
Will lachte.
Wie kann er lachen, nachdem wir gerade Menschen getötet hatten?, fragte ich mich.
»Das wird schon wieder«, sagte er und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. Dann nahm er Jake die Whiskyflasche ab und reichte sie mir erneut.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jemals wieder werden würde.
Ich hatte einen Menschen getötet.
»War doch nur ’n Indianer«, versuchte Jake mich zu trösten. Auch Will stimmte in diesen Sermon mit ein. Als ob Indianer keine Menschen wären. Als ob sie Tiere und nicht genauso wichtig wie wir Weißen wären.
Ich weiß, dass manche diese Meinung haben – und sie auch lautstark proklamieren –, doch ich dachte niemals auf diese Weise. Für mich war ein Mensch ein Mensch, ein Mann ein Mann, eine Frau eine Frau – egal, welche Hautfarbe, Nationalität oder Herkunft sie haben mochten.
»Sieh’s mal so, Kleiner: Wenn du ihn nicht abgemurkst hättest, hätte er es mit dir getan. Der war nämlich hinter deinem Skalp her. Und hinter unseren.«
Will hatte natürlich recht. Ich hatte um Leben und Tod gekämpft, und schließlich waren es die Rothäute gewesen, die uns angegriffen hatten. Dennoch konnte ich seinen letzten Blick nicht vergessen. Der Indianer hatte mir so tief in die Augen geblickt, wissend, dass sein Leben zu Ende ging. Was hatte er in meinen Augen gelesen? Zu lesen gehofft? Gnade? Vergebung? Trost?
Ich hatte keinen Hass in seinem Gesicht gelesen. Auch keine Bestürzung oder Verzweiflung. Erst Jahre später begriff ich, dass es die große Erkenntnis gewesen war, die der Indianer, tödlich verwundet, in diesem Moment gewonnen hatte. Nämlich dass all die Geschichten und Tiraden, mit denen man ihn gegen die Weißen aufgehetzt hatte, nicht stimmten. Sie, die Indianer, waren nicht unbesiegbar. Der Mythos vom ›großen Krieger‹ war nur eine Illusion. Sie starben, wie die Weißen auch. Und wir hatten die besseren Waffen.
Das half mir an diesem Abend nicht. Immer wieder trank ich aus der Steingutflasche, bis der Nachthimmel über mir wirbelte und kreiste. Ich war kein bisschen müde. Immer wieder ließ ich den Moonshine-Whisky die Kehle hinunterbrennen, bis mein Körper nicht mehr konnte.
Ich hörte nicht mehr, wie Will und Jake die Nachtwache besprachen, irgendwie war ich weggetreten. Schließlich hörten die Sterne auf, mir vor den Augen zu wirbeln, und ich fiel in eine tiefe Schwärze.
*
Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem gewaltigen Kater. Meine Muskeln schmerzten, mein Kopf dröhnte, als stünde ich in Bull Chaneys Hufschmiede und Bull Chaney selbst dengelte mit sieben Hämmern auf seinem Amboss herum.
Will schüttete mir einen Eimer eiskaltes Flusswasser ins Gesicht.
»Vorwärts, Kleiner, auf die Beine! Wir fahren!«
Von nun an war ich recht schweigsam, in mich gekehrt.
Ich meine nach wie vor, dass man nicht mit siebzehn beginnen sollte, Menschen umzubringen. Genau überlegt, gab es überhaupt kein Alter, in dem man damit beginnen sollte. Ja, man sollte überhaupt nie einen Menschen töten. Das belastet das Gewissen für den Rest des Lebens, und auch der Whisky hilft einem da nicht weiter.
Warum war es nur so schwer für die Menschen, in Frieden miteinander zu leben? Warum hatten uns diese Indianer an jenem Tag angegriffen? Warum hatten sie uns nicht einfach ziehen lassen?
Wir hatten nichts von ihnen gewollt, ihnen nichts getan. Dennoch hatten sie das Feuer auf uns eröffnet. Irgendein Indianer-Hokuspokus, eine seltsame archaische Denkweise und Mentalität, die wir vielleicht niemals völlig verstehen, trieb sie an, uns anzugreifen. Immer wieder hörten und lasen wir von Berichten, wie Indianer Weiße attackierten. Der Indianeragent in Pittula’s Grove war ermordet worden. Ein Major der US Army, der den Auftrag erhalten hatte, einen Friedensvertrag auszuhandeln, war mit dem Messer zuerst bedroht und dann verletzt worden. Nur allzu oft bestand die Verhandlungstaktik der Indianer aus Geschrei, Mord- und Kriegsdrohungen und wilden Gebärden.
Wenn man sich so aufführt, muss man sich nicht wundern, dass man aus allen Rohren unter Feuer genommen wird. So dachte ich damals, und so denke ich noch heute.
Dennoch – die Indianer waren auch Menschen. Wir hätten sie nicht auf so vielfältige Weise vertreiben, massakrieren und ihnen durch Abschlachten gewaltiger Büffelherden die Lebensgrundlage entziehen dürfen.
Doch genug von den Indianern; wir McNallys machten unsere Erfahrungen mit ihnen, danach setzten wir den Weg nach Süden fort, bis wir das Rio Grande Valley erreichten.
Hier gab es jede Menge freies Land.
Die Hänge links und rechts des Flussarms waren bewaldet und bewachsen, viele Flüsse und Bäche mündeten in den Rio Grande und machten ihn zu einem langen, wenn auch über lange Strecken nicht gerade gewaltigen Fluss. Er begann als Bächlein, das in Colorado, in den Rocky Mountains entsprang. Von seinen 3.034 Meilen bilden etwa zweitausend die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Die Mexikaner nennen ihn Rio Bravo del Norte, was so viel heißt wie Wilder Fluss des Nordens, oder kurz: Rio Bravo. Wir Amerikaner nennen ihn schlicht Rio Grande, Großer Fluss. Er ist nach dem Mississippi-Missouri und dem Yukon der drittlängste Fluss des nordamerikanischen Kontinents
Das Rio Grande Valley war ein Glücksgriff für uns McNallys. Hier floss der Rio breit und sanft und nur knietief dahin. Keine Stromschnellen, kaum Bodenerosion. Das bedeutete, wir könnten ihn mit den Pferden überqueren, wenn wir das Bedürfnis hatten – was aber nur äußerst selten der Fall war. Wir könnten auch nach Mexiko hinüberspucken, wenn wir das wollten. Und wir könnten Wasser ableiten, um unsere Weiden und Futterstellen zu bewässern.
Denn wir hatten vor, die McNally-Ranch zu gründen und Rinderzucht zu betreiben. Saftiges Weideland und Wasserstellen waren dafür notwendig.
Als wir im Spätsommer 1870 ankamen, lebten noch keine zweitausend Menschen in der Gegend. Wir konnten das Land aussuchen, das wir besiedeln wollten. Da wir drei Brüder waren, standen uns dreimal 160 Morgen, also 480 Morgen Land zu.
Nachdem wir fündig geworden waren und ein Haus gebaut und die Grenzen abgeritten hatten, wollten wir irgendwann einmal nach Eagle Pass reiten, wo das zuständige Registeramt seinen Sitz hatte, um das Land auf unsere Namen eintragen zu lassen.
Doch Eagle Pass war über siebzig Meilen entfernt, und zuvor stießen wir auf einen Ort namens Alcala. Alcala lag viel näher als Eagle Pass, nur elf Meilen nordwestlich unserer Ranch; dort gab es Stores, eine Säge- und eine Getreidemühle, Lagerhallen und vier Saloons. Dort konnten wir all das beschaffen, was wir für die tägliche Arbeit benötigten.
Nur unser Land konnten wir dort nicht eintragen lassen.
Doch dort kauften wir bei einem Mann namens John Deveraux Rinder.
Deveraux war an die vierzig und von gepflegter Erscheinung. Er trug einen hellblonden Sichelbart und meist einen pflaumfarbenen Anzug. Neben seiner Tätigkeit als Rancher war er der Sheriff des Städtchens. Doch das Sheriffsamt übte er nur im Nebenberuf aus. Hauptsächlich kümmerte er sich um die Belange seiner großen Ranch, die weiter im Landinnern lag.
Ihm gehörten auch drei der hiesigen Saloons sowie ein Store.
John Deveraux war stets umgeben von drei Männern, die Acht gaben, dass ihm nichts zustieß. Er nannte sie »meine Deputys«, doch sie waren nichts anderes als Revolverhelden und seine persönlichen Leibwächter.
Denn John Deveraux hatte hier im Land einen miesen Ruf. Er hatte in seiner Anfangszeit viele Leute schamlos übers Ohr gehauen, sie regelrecht betrogen. Und so war er sehr reich geworden und hatte sich ein Imperium aufgebaut, in dem viele Menschen von ihm abhängig waren. Er fürchtete (vielleicht zu Recht), irgendwann einmal von jemandem aufs Korn genommen zu werden, weswegen er diese drei Burschen anheuerte, die auf ihn zu achten hatten.
Soviel ich weiß, waren diese Drei während des Kriegs ins Land gekommen. Man munkelte, dass sie desertiert waren und den Süden im Stich gelassen hatten. Genaues wusste jedoch keiner, und sie selbst sprachen nie darüber.
Als Siebzehnjähriger hatte ich nur wenig Menschenkenntnis, aber diese Burschen mochte ich von Anfang an nicht. Sie hatten einen stechenden Blick, bei dem es einem eiskalt über den Rücken lief. Sie waren ruppig und unhöflich, und sogar ältere Ladys ließen sie in den Straßenstaub treten, machten ihnen keinen Platz auf dem Plankengehsteig.
Jungen Frauen und Mädchen traten sie schamlos in den Weg und warfen ihnen Anzüglichkeiten und Flegeleien an den Kopf, bis diese mit hochroten Köpfen die Flucht ergriffen.
Es war eine Schweinerei, und der einzige, der ihnen hätte Einhalt gebieten können, war John Deveraux selbst. Doch dieser dachte gar nicht daran. Ihm kam das Klima, das diese drei Revolverschwinger erzeugten, gerade recht. So zementierte er seine Macht. Wenn sich niemand gegen die drei Revolvermänner behaupten konnte, dann konnte sich auch niemand gegen John Deveraux behaupten.