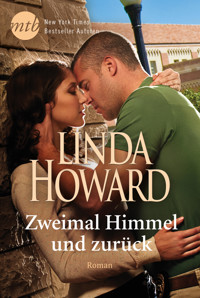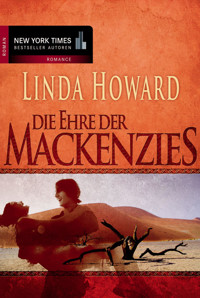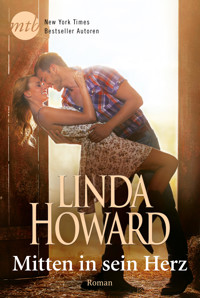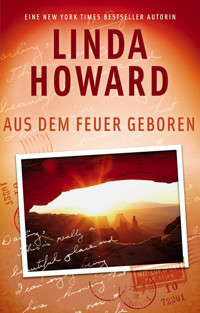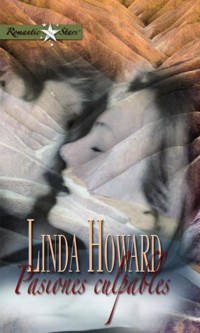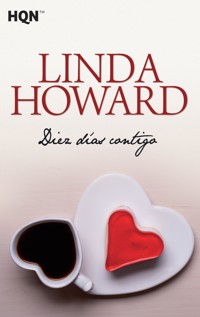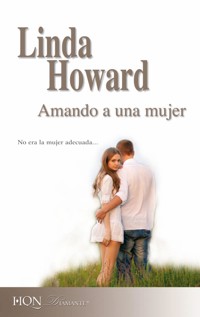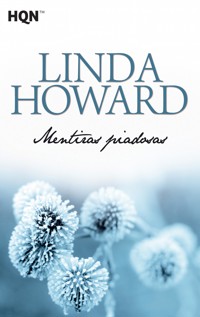5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Ein Absturz in der Wildnis, hitzige Wortgefechte und knisternde Spannung.
Bailey Wingate ist jung, wunderschön - und Witwe. Ihr verstorbener Ehemann hat ihr allein das Familienunternehmen hinterlassen. Damit sind seine Kinder aus erster Ehe allerdings ganz und gar nicht einverstanden. Für sie ist klar: Die Firma und das damit verbundene Vermögen gehören rechtmäßig ihnen.
Als Bailey den Dauerstreit mit ihren Stiefkindern nicht mehr aushält, besteigt sie kurzerhand das nächste Flugzeug. Doch mitten über den Rocky Mountains fallen plötzlich die Motoren aus. Mit Mühe gelingt Cam Justice, dem äußerst attraktiven, aber schroffen Piloten, eine Bruchlandung. Aber war es wirklich nur ein Unfall? Und sind sie außer Gefahr? Fest steht: Gegen ihren Willen sind Bailey und Cam aufeinander angewiesen - und kommen sich beim Überlebenskampf in der Wildnis näher ...
Erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Die Doppelgängerin", "Mitternachtsmorde", "Mister Perfekt".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Danksagungen
Weitere Titel der Autorin
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Mitternachtsmorde
Ein gefährlicher Liebhaber
Ein tödlicher Verehrer
Auch Engel mögen’s heiß
Mister Perfekt
Heißkalte Glut
Über dieses Buch
Bailey Wingate ist jung, wunderschön – und Witwe. Ihr verstorbener Ehemann hat ihr allein das Familienunternehmen hinterlassen. Damit sind seine Kinder aus erster Ehe allerdings ganz und gar nicht einverstanden. Für sie ist klar: Die Firma und das damit verbundene Vermögen gehören rechtmäßig ihnen.
Als Bailey den Dauerstreit mit ihren Stiefkindern nicht mehr aushält, besteigt sie kurzerhand das nächste Flugzeug. Doch mitten über den Rocky Mountains fallen plötzlich die Motoren aus. Mit Mühe gelingt Cam Justice, dem äußerst attraktiven, aber schroffen Piloten, eine Bruchlandung. Aber war es wirklich nur ein Unfall? Und sind sie außer Gefahr? Fest steht: Gegen ihren Willen sind Bailey und Cam aufeinander angewiesen – und kommen sich beim Überlebenskampf in der Wildnis näher …
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Danger – Gefahr
Aus dem Amerikanischen von Leon Mengden
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Up, Close and Dangerous“
Originalverlag: Ballantine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2008 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Blanvalet, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © GettyImages-1097156540; shutterstock_657720454
E-Book-Produktion: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8529-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Bailey Wingate wachte weinend auf. Mal wieder.
Sie hasste das, denn ihr fiel beim besten Willen kein Grund ein, sich wie eine Heulsuse zu benehmen. Wäre sie zutiefst unglücklich, von aller Welt verlassen oder in Trauer, dann wäre es verständlich, dass sie im Schlaf weinte, doch nichts davon traf auf sie zu. Man konnte allenfalls sagen, dass sie ziemlich sauer war.
Sauer zu sein war jedoch keineswegs ihre vorherrschende Gemütsverfassung; dieser Zustand trat nur ein, wenn sie mit ihren Stiefkindern, Seth und Tamzin, zu tun hatte, mit denen sie sich aber Gott sei Dank nur einmal im Monat abgeben musste, nämlich wenn die Auszahlung der Unterhaltsleistung fällig war, die sie aus dem Nachlass ihres Vaters, Baileys verstorbenen Mannes, erhielten. Fast immer nahmen die beiden dann schon vorher Kontakt mit ihr auf, entweder, um mehr Geld zu fordern, wozu sie ihre Zustimmung aber noch nicht gab, oder hinterher, um Bailey auf ihre jeweils eigene Art und Weise wissen zu lassen, was für ein geiziges Miststück sie in ihren Augen war.
Seth ließ sich dabei die weitaus größeren Gemeinheiten einfallen. Bailey mochte gar nicht daran denken, wie viele Male sie zutiefst gekränkt gewesen war, wenn Seth wieder einmal sein Mütchen an ihr gekühlt hatte, aber wenigstens war er offen und geradeheraus in seiner Feindseligkeit ihr gegenüber. Er war ein zäher Brocken, aber Bailey zog es allemal vor, sich mit ihm herumzuzanken, als sich von Tamzin mit hämischen Spitzfindigkeiten überschütten zu lassen.
Heute war der Tag, an dem ihre monatlichen Überweisungen fällig waren, was bedeutete, dass Bailey sich entweder auf einen Telefonanruf oder auf ein persönliches Erscheinen einstellen durfte. Oh, welche Wonne! Vor allem Tamzin piesackte sie bevorzugt mit ihren Besuchen, bei denen sie dann auch noch ihre beiden kleinen Kinder mitbrachte. Tamzin alleine war schon schwer genug zu ertragen, aber wenn dazu noch ihre beiden verzogenen, nörgelnden Kinder kamen, die ständig quengelten, hatte Bailey große Lust, einfach die Tür hinter sich zuzuknallen und aus dem Haus zu laufen.
»Eigentlich müsste ich dafür bezahlt werden«, grummelte sie laut vor sich hin, als sie die Decke beiseitewarf und aus dem Bett stieg.
Aber dann gab sie sich im Geiste einen Ruck. Sie hatte keinen Grund, sich zu beschweren, und erst recht keinen, nachts im Schlaf zu heulen. Sie hatte sich damals darauf eingelassen, James Wingate zu heiraten, obwohl sie wusste, wie seine Kinder waren und wie sie auf die finanziellen Vorkehrungen reagieren würden, die ihr Vater für sie getroffen hatte. James hatte mit dieser Reaktion schon gerechnet und dementsprechend disponiert. Sie selber jedoch war sehenden Auges in ihr Verderben gerannt, also durfte sie sich jetzt auch nicht beklagen, denn auch aus seinem Grab heraus sorgte James dafür, dass es ihr als seiner Nachlassverwalterin an nichts fehlte.
Sie ging in das edel eingerichtete Badezimmer und warf einen Blick auf ihr Spiegelbild – das ließ sich auch kaum vermeiden, wenn man gleich beim Betreten des Bades mit einem von der Decke bis zum Boden reichenden Spiegel konfrontiert wurde. Wenn sie sich darin betrachtete, kam es ihr manchmal so vor, als gäbe es zwischen der Person, die sie darin sah, und dem, was sie tief in ihrem Inneren empfand, nicht den geringsten Zusammenhang.
Das Geld hatte sie verändert – weniger innerlich, sondern eher äußerlich. Sie war schlanker, straffer geworden, denn nun hatte sie sowohl die Zeit als auch das nötige Geld für einen persönlichen Fitnesstrainer, der ins Haus kam, um sie in ihrem privaten Gymnastikraum in die Mangel zu nehmen. Ihr Haar, das vorher von einem schmutzigen Blond gewesen war, war nun so kunstvoll mit Strähnen in den verschiedensten Blondtönen durchsetzt, dass es vollkommen natürlich wirkte. Die teure Frisur schmeichelte ihren Gesichtszügen und ließ ihr Haar so grazil fallen, dass es selbst jetzt, da sie gerade erst aufgestanden war, ziemlich gut aussah.
Sie hatte sich immer schon bemüht, adrett auszusehen, und sich stets so gut gekleidet, wie es ihr von ihrem Gehalt möglich war, aber zwischen »adrett« und »gestylt« gab es einen himmelweiten Unterschied. Sie war nie eine Schönheit gewesen und konnte das auch heute noch keineswegs von sich behaupten, aber sie durfte sich bisweilen durchaus als »hübsch«, manchmal sogar als »attraktiv« betrachten. Geschickte Anwendung der besten Kosmetikprodukte, die man für Geld kaufen konnte, ließ das Grün ihrer Augen intensiver, strahlender wirken. Ihre Kleider waren ihr, und nur ihr, auf den Leib geschnitten. Sie brauchte sich nicht wie Millionen anderer Frauen darauf zu beschränken, sich mit etwas in der mehr oder weniger passenden Größe von der Stange zu bedienen.
Als Jims Witwe stand ihr das volle, uneingeschränkte Nutzungsrecht dieses Hauses in Seattle, eines anderen in Palm Beach und noch eines weiteren in Maine zu. Auf Reisen musste sie nie eine Linienmaschine nehmen, es sei denn, sie wollte es so. Die Wingate Corporation leaste Privatjets für ihre leitenden Angestellten, und ihr stand auch stets einer zur Verfügung. Bezahlen musste sie nur, was sie sich für ihren persönlichen Bedarf kaufte, und das bedeutete, dass sie sich finanziell keine Sorgen zu machen brauchte. Dies war zweifellos der größte Vorteil, den sie aus der Vereinbarung mit dem Mann zog, der sie geheiratet und binnen eines einzigen Jahres schon wieder als Witwe zurückgelassen hatte.
Früher war Bailey arm gewesen, musste sie doch zugeben, dass Geld das Leben um einiges leichter machte. Sie hatte zwar immer noch ein paar Probleme – vor allem mit Seth und Tamzin –, aber mit Problemen ließ es sich einfacher umgehen, wenn das pünktliche Bezahlen von Rechnungen nicht dazugehörte: Jedes Gefühl von Druck war aus ihrem Leben gewichen.
Sie hatte eigentlich nichts anderes zu tun, als das Vermögen ihrer Stiefkinder zu verwalten – eine Pflicht, die sie sehr gewissenhaft erfüllte, obwohl diese ihr das nie glauben würden – und ansonsten irgendwie ihre Tage auszufüllen.
Mein Gott, sie langweilte sich.
Jim hatte, was seine Kinder anging, an alles gedacht, sinnierte sie, als sie die runde Duschkabine aus Milchglas betrat. Er hatte sein Geld für sie zusammengehalten und dafür gesorgt, soweit es ihm möglich war, dass sie finanziell stets abgesichert sein würden. Nur eines hatte er nicht berücksichtigt, nämlich wie es mit ihrem, Baileys, Leben weitergehen würde, wenn er nicht mehr da wäre.
Wahrscheinlich war es ihm gleichgültig gewesen, dachte sie wehmütig. Sie hatte ihm als Mittel zum Zweck gedient, und obwohl er sehr angetan von ihr gewesen war – und sie von ihm –, hatte er niemals vorgegeben, mehr für sie zu empfinden als eben das. Ihre Ehe war eine geschäftliche Vereinbarung gewesen, die er initiiert und kontrolliert hatte. Selbst wenn er es vorher geahnt hätte, wäre es ihm egal gewesen, dass seine Freunde, die seine Gattin zu seinen Lebzeiten pflichtbewusst mit zu ihren Partys und Empfängen eingeladen hatten, diese sofort wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und von ihren Gästelisten streichen würden, sobald er unter der Erde lag. Die meisten von Jims Freunden waren ungefähr in seinem Alter gewesen, und viele von ihnen hatten Lena, seine erste Frau, gekannt und waren mit ihr befreundet gewesen. Einige seiner Bekannten hatten Bailey schon vor ihrer Heirat kennengelernt, als diese noch Jims persönliche Assistentin gewesen war. Sie fühlten sich ihr gegenüber befangen, nachdem sie seine Frau geworden war. Nun, ihr war es ähnlich ergangen; wie konnte sie ihnen also einen Vorwurf daraus machen?
Dies war nicht das Leben, das sie sich für sich vorgestellt hatte. Ja, das Geld war angenehm – äußerst angenehm –, aber sie wollte nicht den Rest ihres Lebens damit verbringen, Geld für zwei Menschen zu vermehren, die sie verachteten. Jim war fest davon ausgegangen, dass die Demütigung, seinen Anteil am Erbe seines Vaters von einer Stiefmutter verwaltet zu sehen, die drei Jahre jünger war als er selber, einen solchen Schock für seinen Sohn bedeuten würde, dass dieser sich am Riemen riss und sich wie ein verantwortungsvoller Erwachsener benahm, anstatt sich wie eine ältere, männliche Ausgabe von Paris Hilton zu gebärden. Aber darin hatte Jim sich geirrt, und Bailey hegte auch keine Hoffnung mehr, dass sich an Seths Haltung je etwas ändern würde. Seth hatte jede Menge Möglichkeiten gehabt, sich einen Ruck zu geben und sich in dem Unternehmen nützlich zu machen, das seinen ausschweifenden Müßiggang finanzierte, doch er hatte keine davon ergriffen. Dabei hatte Jim seine ganze Hoffnung auf Seth gesetzt, denn Tamzin war völlig ungeeignet, die unternehmerischen Entscheidungen zu treffen, die der Umgang mit enormen Geldmengen erforderte. Tamzin interessierte nur, was unterm Strich dabei herauskam – nämlich Geld zu ihrer freien Verfügung, und am liebsten hätte sie ihr gesamtes Erbe auf der Stelle ausbezahlt bekommen, um es nach ihrem Gutdünken auf den Kopf zu hauen.
Bailey zuckte bei dem Gedanken zusammen. Wenn man Tamzin an ihr Erbe heranließ, hätte sie das Geld binnen fünf Jahren verprasst. Wenn Bailey Jims Geld nicht kontrollierte, würde es jemand anderes tun müssen.
Als sie gerade die Dusche abgedreht hatte und nach einem champagnerfarbenen Badelaken griff, um sich darin einzuwickeln, läutete das Telefon. Sie schlang sich rasch ein Handtuch um ihr nasses Haar, trat aus der Duschkabine und nahm das schnurlose Telefon im Ankleidezimmer auf, legte es aber, ohne sich gemeldet zu haben, wieder auf die Basisstation zurück, nachdem sie einen Blick auf das Display geworfen hatte. Die Nummer war unterdrückt gewesen, und da sie ihre sämtlichen Telefonnummern gegen unerwünschte Anrufe hatte sperren lassen, kam der Anruf wohl nicht von irgendeinem Telefonverkäufer. Das bedeutete, dass Seth vermutlich bereits hellwach war und sich neue Beleidigungen für sie hatte einfallen lassen, aber sie wollte sich keinesfalls mit ihm auseinandersetzen, bevor sie ihren Morgenkaffee getrunken hatte. Ihr Pflichtbewusstsein reichte nur bis zu einem bestimmten Punkt, alles hatte seine Grenzen.
Andererseits, was wäre, wenn mit Seth etwas nicht in Ordnung war? Er feierte gerne bis spät in die Nacht und fand selten vor dem Morgengrauen ins Bett – zumindest nicht in sein eigenes. Es sah ihm gar nicht ähnlich, schon so früh bei ihr anzurufen. Grenzen waren manchmal dazu da, übertreten zu werden. Sie nahm das Mobilteil wieder auf und drückte die Verbindungstaste, obwohl sich inzwischen natürlich der Anrufbeantworter eingeschaltet hatte.
»Hallo?«, unterbrach sie den Ansagetext der Mobilbox. Die blecherne männliche Computerstimme, die sich bei ihr meldete, war ein Manko des Geräts, aber sie hatte sie einem selber aufgesprochenen Text vorgezogen, weil sie unverbindlicher war.
Die Ansage verstummte mitten im Satz, und mit einem Piepton schaltete sich der Anrufbeantworter aus.
»Hallo, Mom.«
Seths Stimme triefte vor Sarkasmus. Bailey seufzte innerlich. Alles war in Ordnung. Seth probierte bloß eine neue Art und Weise aus, sie zu ärgern. Es störte sie nicht weiter, von einem Mann, der älter war als sie, »Mom« genannt zu werden. Es ging ihr vielmehr auf die Nerven, sich überhaupt mit ihm abgeben zu müssen.
Am besten kam man Seth bei, indem man überhaupt keine Reaktion zeigte; irgendwann würde er seiner Sticheleien überdrüssig werden und auflegen. »Hallo, Seth. Wie geht es dir?«, fragte sie in dem kühlen, ruhigen Tonfall, den sie sich in der Zeit als Jims persönliche Assistentin angewöhnt hatte. Weder ihre Stimme noch ihre Mimik hatten je etwas durchblicken lassen.
»Ach, ich kann mich keineswegs beklagen«, antwortete er mit aufgesetzter Munterkeit. »Abgesehen davon, dass meine geldgierige Hure von einer Stiefmutter sich von meinem Geld einen schönen Tag macht und ich nichts davon habe. Aber so eine kleine Veruntreuung unter Verwandten ist ja kaum der Rede wert, oder?«
Normalerweise gingen ihr solche Unflätigkeiten zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. »Hure« war eine Beschimpfung, die Seth schon über die Lippen gekommen war, als er die testamentarische Verfügung seines Vaters vernommen hatte. Anschließend hatte er sie beschuldigt, seinen Vater nur des Geldes wegen geheiratet und seine Krankheit ausgenutzt zu haben, um ihn zu überreden, ihr die Verwaltung des Erbes seiner Kinder zu übertragen. Seth hatte auch versprochen, ja sogar gedroht, das Testament gerichtlich anzufechten, bis Jims Anwalt ihm mit einem vernehmlichen Seufzer Einhalt geboten und ihm von einem solchen Schritt als reiner Zeit- und Geldverschwendung abgeraten hatte; Jim hatte die Zügel seines Imperiums noch bis wenige Wochen vor seinem Tod mit fester Hand geführt und sein Testament bereits fast ein Jahr vorher aufgesetzt – am Tag nach seiner Hochzeit mit Bailey, um es genau zu sagen.
Als Seth das erfuhr, war er puterrot geworden und hatte eine derart unflätige Bemerkung von sich gegeben, dass jeder im Raum erschrocken nach Luft geschnappt hatte, dann war er wutentbrannt hinausgestürmt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bailey sich bereits angewöhnt, sich nichts anmerken zu lassen, sodass eine simple Beschimpfung als »Hure« sie jetzt weitgehend kaltließ.
Der Veruntreuung bezichtigt zu werden ging ihr andererseits doch ziemlich unter die Haut.
»Wo wir gerade von deinem Erbe reden – es gibt da eine Investitionsmöglichkeit, die ich gerne näher ins Auge fassen möchte«, erklärte sie gelassen. »Um den bestmöglichen Gewinn herauszuholen, müsste ich jedoch so viel wie nur möglich festlegen. Du hast doch nichts dagegen, wenn deine monatliche Unterhaltszahlung halbiert wird, oder? Natürlich nur vorübergehend, etwa für ein Jahr oder so.«
Auf diesen Vorschlag folgte ein winziger Augenblick des Schweigens, dann knurrte Seth mit zorngeladener Stimme: »Ich bringe dich um, du Biest.«
Dies war das erste Mal, dass sie eine seiner Beleidigungen mit einer Drohung ihrerseits pariert hatte, was ihn natürlich vollkommen aus dem Gleichgewicht brachte. Sein Gerede von Mord beunruhigte sie nicht. Seth war ganz groß darin, wüste Drohungen auszustoßen, die er dann nie wahr machte.
»Falls du aber bessere Vorschläge für eine Geldanlage hast, die du mir unterbreiten möchtest, will ich mich auch damit gerne befassen«, sagte sie so höflich, als hätte er ihr nicht den Tod an den Hals gewünscht, sondern sich nach den näheren Bedingungen für die angesprochene Investition erkundigt. »Mach dich ganz in Ruhe schlau und lass mir dann alles schriftlich zukommen. Ich werde es mir so rasch wie möglich ansehen, aber es kann ein paar Wochen dauern. Übermorgen fahre ich in Urlaub und werde ein paar Wochen fort sein.«
Als Antwort schmiss Seth den Hörer heftig auf die Gabel.
Keine angenehme Art, den Tag zu beginnen, dachte sie. Aber zumindest hatte sie ihre monatliche Auseinandersetzung mit Seth hinter sich gebracht.
Wenn sie nun noch Tamzin aus dem Wege gehen könnte ...
2
Cameron Justice warf einen flüchtigen Blick über den kleinen Flugplatz und die daneben geparkten Autos, als er seinen blauen Suburban in seine Parkbucht lenkte. Obwohl es noch nicht einmal halb sieben Uhr morgens war, war er nicht der Erste, der hier eintraf. Die silberfarbene Corvette sagte ihm, dass sein Freund und Geschäftspartner Bret Larsen – das L in J&L Executive Air Limo – ebenfalls schon da war, und der rote Ford Focus verhieß die Anwesenheit von Karen Kaminski, ihrer Sekretärin. Bret war früh dran, aber Karen hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, als Allererste im Büro zu erscheinen. Dies sei die einzige Zeit des Tages, zu der sie ihre Arbeit erledigen konnte, ohne ständig unterbrochen zu werden, meinte sie.
Es war ein klarer, heller Morgen, obwohl der Wetterbericht für den weiteren Verlauf des Tages zunehmende Bewölkung verhieß. Doch in diesem Augenblick strahlte die Sonne auf die vier glänzenden Maschinen von J & L, und Cameron hielt einen Augenblick lang inne, um sich an dem Anblick zu erfreuen.
Es hatte eine Stange Geld gekostet, die Flugzeuge mit dem Logo und den Farben der Firma zu versehen, aber das war es wert gewesen – der schwarze Rumpf, über dessen Flanken sich vom Cockpit bis zum Heck eine dünne, aufwärts strebende weiße Linie zog, gab ein einprägsames Bild ab. Die beiden Cessnas – eine Skylane und eine Skyhawk – waren bis auf den letzten Heller bezahlt. Er und Bret hatten während der ersten Jahre wie die Wahnsinnigen geschuftet und waren neben ihrer Tätigkeit als Charterpiloten noch Nebenjobs nachgegangen, um die Maschinen so schnell wie möglich abzuzahlen und ihre Verschuldungsrate zu verbessern. Die Piper Mirage gehörte fast ihnen, und nachdem auch sie abbezahlt war, planten sie, die Ratenzahlungen für die achtsitzige Lear 45 XR – Camerons Ein und Alles – zu verdoppeln.
Obwohl die Lear der F-15E Strike Eagle, die Cams Partner während seiner Zeit in der Air Force geflogen hatte, was Rumpflänge und Spannweite betraf, ziemlich nahe kam, hatte Bret inzwischen die wesentlich kleineren Cessnas und die mittelgroße Mirage wegen ihrer Wendigkeit schätzen gelernt. Cam, der während seiner Militärzeit die riesige KC-10 A Extender kommandiert hatte, zog es hingegen vor, ein wenig mehr Flugzeug um sich herum zu haben. Ihre bevorzugten Maschinen spiegelten die grundlegenden Unterschiede zwischen ihnen beiden als Piloten wider. Bret war der draufgängerische Kampfflieger, rotzfrech und mit blitzschnellen Reflexen; Cam war der Bedächtigere von den beiden, die Sorte Flugkapitän, dessen Hände man sich am Ruder wünschte, wenn ein Flugzeug in mehreren tausend Fuß Höhe und bei mehreren hundert Meilen Fluggeschwindigkeit betankt werden musste. Die Lear brauchte zum Start jeden Meter Startbahn, der auf dem kleinen Flugfeld verfügbar war, daher war Bret froh und glücklich, wenn Cam auf den entsprechenden Flügen das Steuer übernahm.
Sie hatten es zu etwas gebracht, sinnierte Cam, und dabei doch nur ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Fliegen lag ihnen im Blut. Sie hatten sich in der Flugakademie der Air Force kennengelernt, und obwohl Bret schon ein Jahr länger dabei war, waren sie gute Kameraden geworden. Ihre Freundschaft hatte die Aufteilung in unterschiedliche Staffeln, getrennte Stationierung und voneinander abweichende Karrierepläne überdauert. Sie hatten sich gegenseitig über drei Scheidungen – zwei bei Bret und eine bei Cam – und auch ein paar Freundinnen hinweggetröstet. Ohne dass sie es je richtig geplant hätten, hatte es sich über Telefongespräche und E-Mails so ergeben, dass sie beschlossen, sich nach ihrem Militärdienst gemeinsam selbständig zu machen. Darüber, um was für eine Firma es sich dabei handeln würde, hatte von Anfang an Einigkeit bestanden. Ein kleines Charterflugunternehmen schien ihnen beiden wie auf den Leib geschnitten.
Das Geschäft hatte sich zu einem Erfolg entwickelt. Inzwischen beschäftigten sie drei Mechaniker, einen Aushilfspiloten und eine Reinigungscrew mit einer Teilzeit- und einer Vollzeitkraft – und natürlich Karen, die Unentbehrliche, die alles mit eiserner Faust regierte und niemandem etwas durchgehen ließ. Die Firma war solvent und bescherte ihm und Bret ein gutes Auskommen. Fliegen als Broterwerb ließ natürlich den Kick und den Thrill eines Kampffliegers vermissen, aber Cam brauchte wirklich keinen Adrenalinstoß, um das Leben zu genießen. Bret war natürlich aus anderem Holz geschnitzt. Kampfpiloten lebten für den Nervenkitzel, aber Bret passte sich den Gegebenheiten an und stillte sein Bedürfnis nach Aufregung als Freiwilliger bei der Civil Air Patrol.
Auch mit ihrem Standort hatten sie Glück gehabt. Der kleine Flugplatz entsprach genau den Erfordernissen ihres Geschäfts. Vor allem, weil er sich in der Nähe des Hauptfirmensitzes der Wingate Group, ihres wichtigsten Kunden, befand. Sechzig Prozent ihrer Aufträge bekamen sie von Wingate. Hauptsächlich flogen sie hochrangige Angehörige der Geschäftsführung in der Gegend herum, aber manchmal charterte Wingate auch eine Maschine für private Flüge. Neben seiner günstigen Lage verfügte der Flugplatz außerdem über gute Sicherheitsvorkehrungen und ein überdurchschnittlich komfortables Terminal, in dem J&L auch seine drei Büroräume unterhielt. Die Geschäftsverbindung zu Wingate hatten sie Brets Beziehungen zu verdanken, und er war es auch, der die Privatflüge durchführte, während Cam die leitenden Firmenangehörigen übernahm. Diese Aufteilung war ihnen beiden recht, denn Bret kam mit der Familie Wingate besser klar als Cam. Der alte Wingate war ein anständiger Kerl gewesen, aber seine Kinder waren mißratene Gören, und die Vorzeigegattin, die er hinterlassen hatte, strahlte ungefähr so viel Wärme und Herzlichkeit aus wie ein Eisberg.
Cam stieg aus dem Auto. Er war ein hoch gewachsener, breitschultriger Mann, und der große Geländewagen passte zu ihm, da er ihm den Fuß- und Kopfraum bot, den er benötigte. Lockeren Schrittes überquerte er den Parkplatz und betrat durch den privaten Seiteneingang das Gebäude, wobei er das Schloss mit seiner Kennkarte öffnete. Ein schmaler Korridor führte zu seinem Büro, in dem Karen bereits fleißig auf der Tastatur ihres Computers tippte. Auf ihrem Schreibtisch standen frische Blumen, deren Duft sich mit dem des Kaffees mischte. Sie hatte stets frische Blumen auf dem Tisch, obwohl Cam sie im Verdacht hatte, dass sie sich diese selber kaufte. Karens Freund, ein in Leder gekleideter, Motorrad fahrender, bärtiger Profiringer schien Cam nicht die Sorte Mann zu sein, der einer Frau Blumen mitbrachte. Cam wusste, dass Karen ungefähr Ende zwanzig war, sich gerne schwarze Strähnen in ihr kurzgeschnittenes rotes Haar färbte und dass dank ihr im Büro alles wie am Schnürchen lief. Aber er hatte es nie gewagt, sich nach näheren Einzelheiten aus ihrem Privatleben zu erkundigen. Bret hingegen sah es als seine Lebensaufgabe an, die unerschütterliche Karen aus der Fassung zu bringen, und zog sie ständig mit irgendwas auf.
»Guten Morgen, Sonnenschein«, begrüßte Cam die Sekretärin. Er durfte sich doch schließlich auch einmal einen Spruch erlauben, zum Kuckuck.
Sie warf ihm über den Rand ihres Monitors hinweg einen schiefen Blick zu und fuhr dann mit ihrer Arbeit fort. Karen war am Morgen ebenso wenig ein Sonnenschein, wie Seattle arm an Niederschlägen war. Bret hatte einmal den Verdacht geäußert, dass sie nebenberuflich als Wachhund auf einem Schrottplatz arbeitete, denn sie konnte so knurrig wie ein Rottweiler sein und fing frühestens gegen neun Uhr morgens an, ein klein wenig aufzutauen. Karen hatte nichts dazu gesagt, aber danach war über einen Monat lang Brets sämtliche private Post verschwunden, bis er endlich den Braten roch und sich bei ihr entschuldigte, woraufhin wieder Briefe für ihn eingingen, er aber mit dem Bezahlen seiner Rechnungen einen Monat im Rückstand war.
Cam ging auf Nummer sicher und verkniff sich jede weitere Bemerkung. Stattdessen nahm er sich einen Kaffee und trat damit an die offene Tür zu Brets Büro. »Du bist ja früh dran«, sagte er und lehnte sich gegen den Türrahmen.
Bret warf ihm einen sauertöpfischen Blick zu. »Nicht freiwillig.«
»Du meinst, Karen hätte dich angerufen und dir gesagt, du sollst gefälligst deinen Arsch hierherbewegen?« Hinter sich vernahm Cam ein Geräusch, das sowohl ein Kichern als auch ein Grollen gewesen sein könnte. Bei Karen konnte man sich des Unterschieds nie so recht sicher sein.
»Fast genauso schlimm. Irgendein Idiot hat bis zur letzten Minute gewartet, um dann für acht Uhr einen Flug zu chartern.«
»Wir nennen sie nicht ›Idioten‹«, hörten sie Karens Stimme. »Wir nennen sie ›Kunden‹.«
Bret, der gerade an seinem Kaffee genippt hatte, verschluckte sich fast vor Lachen. »Kunden«, wiederholte er. »Werd’ ich mir merken.« Er wies auf den Zettel, auf dem er herumgekritzelt hatte. Cam erkannte darin den Flugplan für den Tag. »Ich habe Mike bestellt, damit er heute Nachmittag mit der Skylane den Flug nach Spokane übernimmt. Dann habe ich den Rücken frei, um mit der Mirage nach L.A. zu fliegen, während du mit der Skyhawk die Strecke nach Eugene übernimmst; aber wir können das auch tauschen, falls du lieber nach L.A. möchtest.« Mike war Mike Gardiner, ihr Aushilfspilot.
Wer als Erster ins Büro kam, musste anfangen, den morgendlichen Papierkram zu erledigen, was mit ein Grund dafür war, warum Bret sich selten zu so früher Stunde blicken ließ. Er war gerade dabei, den für heute gebuchten Flügen anhand der jeweiligen Entfernung die entsprechenden Maschinen zuzuordnen, denn sie sparten Zeit, wenn sie sich nicht mit Nachtanken aufhalten mussten. Normalerweise hätte Cam den Flug nach Los Angeles gerne selber übernommen, aber er hatte in dieser Woche bereits ein paar Langstrecken hinter sich und brauchte eine kleine Verschnaufpause. Außerdem musste er auch wieder mal eine der Cessnas steuern; er war so viel mit dem Lear Jet und der Piper Mirage unterwegs, dass er kaum die vorgeschriebenen Flugstunden auf den kleineren Maschinen zusammenbekam. »Nein, das ist schon in Ordnung so. Was liegt für morgen an?«
»Nur zwei Sachen. Morgen muss ich auch wieder früh aus den Federn. Ich fliege Mrs. Wingate nach Denver. Sie will dort Ferien machen, also habe ich zurück einen Leerflug – es sei denn, ich kann etwas aufreißen. Und dann müssen wir ...« Er sprach nicht weiter, sondern suchte zwischen den Papieren auf seinem Schreibtisch nach dem Vertrag, den Karen aufgesetzt hatte.
»Ein Kurierflug nach Sacramento«, ließ sich Karen aus ihrem Büro vernehmen. Sie gab sich keine Mühe zu verhehlen, dass sie belauschte, was die beiden zu bereden hatten.
»Ein Kurierflug nach Sacramento«, wiederholte Bret, als hätte Cam sie nicht gehört. Von nebenan erklang wieder das missbilligende Knurren. Bret kritzelte etwas auf einen Zettel und schob ihn über seinen Schreibtisch. Cam trat vor, legte seinen Finger auf das Stück Papier und drehte es um.
Frag sie, ob sie schon ihre Tollwutimpfung aufgefrischt hat, stand darauf.
»Aber klar doch«, sagte Cam und hob die Stimme. »Karen, Bret bittet mich, dich zu fragen –«
»Halt’s Maul, du Blödmann!« Bret sprang von seinem Sessel hoch und versetzte Cam einen Schlag gegen die Schulter, damit er den Satz nicht beendete. Cam lachte, verließ Brets Büro und ging zu seinem eigenen Schreibtisch.
Karen sah ihn wieder mit zusammengekniffenen Augen an. »Was bittet Bret dich, mich zu fragen?«, verlangte sie zu wissen.
»Schon gut. War nicht weiter wichtig«, sagte Cam mit Unschuldsmiene.
»Ja, das kann ich mir vorstellen«, murmelte sie.
Cam hatte sich gerade hingesetzt, als das Telefon läutete. Obwohl es eigentlich Karens Aufgabe war, Anrufe entgegenzunehmen, nahm er das Gespräch an, denn im Gegensatz zu ihm hatte sie alle Hände voll zu tun.
»Executive Air Limo.«
»Hier spricht Seth Wingate. Hat meine Stiefmutter für morgen einen Flug gebucht?«
Die Stimme des Mannes klang so gebieterisch, dass sich Cam sofort die Nackenhaare sträubten, aber er antwortete in beherrschtem Tonfall, dass dies der Fall wäre.
»Wohin?«
Cam wünschte sich, er könnte diesem Blödmann sagen, dass es ihn nichts anginge, wohin Mrs. Wingate geflogen werden wolle, aber Blödmann oder nicht, er war ein Wingate und hatte wohl ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum ging, ob die Wingate Group weiterhin mit J&L fliegen würde oder nicht. »Denver«, sagte er.
»Und wann kommt sie zurück?«
»Das genaue Rückflugdatum liegt mir nicht vor, aber ich glaube, sie bleibt so um die zwei Wochen.«
Die einzige Antwort bestand aus einem Klicken in der Leitung – ohne dass Seth Wingate sich bedankt oder irgendetwas anderes gesagt hätte.
»Scheißkerl«, murmelte Cam und legte seinerseits auf.
»Wer ist ein Scheißkerl?«, drang Karens Stimme durch die offene Tür zu ihnen. Gab es denn nichts, was sie nicht mitbekam? Komischerweise ließ das Klick-Klack ihrer Tastatur nie nach, wurde nicht für eine Sekunde unterbrochen. Die Frau konnte einem richtig Angst einjagen.
»Seth Wingate«, antwortete Cam.
»Da stimme ich dir zu, Boss. Er verfolgt wohl jeden von Mrs. Wingates Schritten. Ich frage mich, warum. Die beiden sind doch wie Katz und Maus.«
Cam überraschte das nicht. Die erste Mrs. Wingate, die er flüchtig gekannt, aber äußerst sympathisch gefunden hatte, war kaum ein Jahr unter der Erde, als Mr. Wingate seine persönliche Assistentin heiratete, die jünger war als seine beiden Kinder. »Vielleicht will er in ihrem Haus eine wilde Party schmeißen, während sie fort ist.«
»Das ist doch kindisch.«
»Er ist ja auch ein Kindskopf.«
»Deswegen hat der alte Wingate ihr wahrscheinlich die Vermögensverwaltung übertragen.«
Das war Cam neu. Er stand auf und stellte sich an die Bürotür. »Willst du mich auf den Arm nehmen?«, sagte er zu ihrem Rücken.
Sie sah ihn über die Schulter an. Ihre Finger huschten weiter über die Tasten. »Das hast du nicht gewusst?«
»Woher denn?« Keines der Familienmitglieder der Wingates und niemand aus der Führungsetage des Unternehmens sprach je mit ihm über finanzielle Angelegenheiten, und er konnte sich auch nicht vorstellen, dass sie Karen solche Dinge anvertrauten.
»Na, ich weiß es jedenfalls«, betonte sie.
Schön, und genau deswegen bist du mir unheimlich. Doch er schluckte die Bemerkung rasch hinunter, ehe ihm sein loses Mundwerk Riesenscherereien einbrachte. Karen hatte halt ihre Methoden, um hinter gewisse Dinge zu kommen. »Und woher weißt du das?«
»Man hört so dieses und jenes.«
»Wenn das stimmt, begreife ich auch, warum die beiden wie Katz und Maus miteinander sind.« An Seth Wingates Stelle würde er seine Stiefmutter vermutlich auch wie die Pest hassen.
»Du kannst mir ruhig glauben. Der alte Mr. Wingate kannte seine Pappenheimer. Mal ehrlich – hättest du Seth oder Tamzin Wingate Millionen und Abermillionen Dollar überlassen?«
Darüber brauchte Cam nicht den Bruchteil einer Sekunde nachzudenken. »Nie im Leben.«
»Siehst du, ich auch nicht. Und ich mag Mrs. Wingate. Sie hat Köpfchen.«
»Hoffentlich genug, um die Schlösser ausgewechselt zu haben, nachdem ihr Mann gestorben ist«, sagte Cam. Und hoffentlich auch genug, um sich vorzusehen, denn Seth Wingate war es glatt zuzutrauen, dass er ihr bei der ersten Gelegenheit ein Messer in den Rücken stieß.
3
Am nächsten Morgen wurde Cam vom Läuten des Telefons aus dem Schlaf gerissen. Mit geschlossenen Augen tastete er danach. Möglicherweise war es ja nur falsch verbunden; wenn er die Augen zubehielt, konnte er vielleicht weiterschlafen, bis die Weckfunktion seiner Armbanduhr sich meldete. Aus Erfahrung wusste er, dass, sobald er erst die Augen aufmachte, an Schlaf nicht mehr zu denken war und er ebenso gut auch aufstehen konnte. »Ja?«
»Boss, Hosen an und nichts wie her.«
Mist. Karen. Er vergaß seinen Vorsatz, die Augen nicht zu öffnen. Im Nu saß er kerzengerade im Bett. Ein heftiger Adrenalinstoß vertrieb die Spinnweben in seinem Hirn. »Was ist los?«
»Dein Vollidiot von einem Partner ist hier gerade mit zugequollenen Augen aufgekreuzt. Er kann kaum atmen, aber er meint, er wäre in der Lage, heute nach Denver zu fliegen.«
Im Hintergrund hörte Cam eine heisere, belegte Stimme, die sich ganz und gar nicht wie Bret anhörte, etwas Unverständliches grummeln. »Ist er das?«
»Ja. Er will wissen, wieso ich dich mit ›Boss‹ anrede und ihn einen Vollidioten nenne. Weil manche Dinge klar auf der Hand liegen, deshalb«, zischte sie, offenbar als Antwort für Bret. Dann wandte sie sich wieder Cam zu. »Ich habe schon Mike angerufen, aber er schafft es nicht mehr rechtzeitig her, um den Flug nach Denver zu übernehmen, also gebe ich ihm deinen Flug nach Sacramento, und du musst deinen Arsch in Bewegung setzen.«
»Bin schon unterwegs«, sagte er, legte auf und flitzte ins Bad. Binnen vier Minuten und dreiundzwanzig Sekunden hatte er geduscht und sich rasiert; dann warf er sich in einen seiner schwarzen Anzüge und schnappte sich seine Mütze und die kleine Reisetasche, die er immer gepackt hielt, denn solche Sachen konnten eben passieren. Sechs Minuten nach dem Anruf war er zur Tür hinaus, musste dann aber doch noch einmal umkehren, um die Kaffeemaschine auszuschalten, die so programmiert war, dass sie in einer Stunde zu kochen anfing. Da er wahrscheinlich keine Zeit mehr haben würde, um etwas zu frühstücken, nahm er noch ein paar Powerriegel aus dem Küchenschrank und steckte sie in seine Tasche.
Mist, Mist, Mist. Er fluchte in einem fort, während er sich durch den frühmorgendlichen Verkehr schlängelte. Seine Passagierin würde heute die frostige Witwe Wingate sein. Bret kam gut mit ihr aus, aber der kam mit beinahe jedem zurecht. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er das Pech gehabt hatte, ihr zu begegnen, hatte sie sich aufgeführt, als hätte sie einen Besenstiel in ihrem Hintern stecken, und ihn behandelt, als wäre er ein Käfer, der einen blutigen Klecks auf der Windschutzscheibe ihres Lebens hinterlassen hatte. Beim Militär hatte er genug mit solchen Menschen zu tun gehabt. Er hatte es schon damals gehasst, wenn jemand ihm so kam, und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Aber er würde schön den Mund halten, auch wenn es ihn Überwindung kostete, doch falls sie ihm dumm kam, konnte sie sich auf den unangenehmsten Flug ihres Lebens gefasst machen. Er würde sie so durchschütteln, dass sie ihre sämtlichen Eingeweide ausgekotzt hatte, ehe sie Denver erreichten.
Wenigstens kam er einigermaßen zügig voran; er wohnte am Stadtrand von Seattle, und außerdem fuhr er dem Berufsverkehr entgegen. Dementsprechend war seine Spur relativ frei, während sich in der Gegenrichtung ein Auto an das andere reihte. Siebenundzwanzig Minuten nachdem er aufgelegt hatte, bog er in den Parkplatz ein.
»Das ging ja fix«, bemerkte Karen, als er mit seiner Reisetasche in der Hand ins Büro gehetzt kam. »Aber leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten.«
»Nur zu, ich höre.« Er stellte die Tasche ab, um sich einen Becher Kaffee einzuschenken.
»Die Mirage ist zur Reparatur im Hangar, und Dennis meint, sie würde nicht rechtzeitig für den Flug fertig.«
Cam nippte schweigend seinen Kaffee und stellte logistische Erwägungen an. Mit der Mirage hätte er es, ohne nachzutanken, bis nach Denver geschafft; mit dem Lear Jet ging das natürlich auch, aber den nahmen sie eher für Gruppenreisen als für eine einzige Person – und obwohl er ihn auch solo fliegen konnte, hatte er in dem Jet lieber einen Co-Piloten dabei. Keine der beiden Cessnas verfügte über eine solche Reichweite, aber die Skylane hatte eine Dienstgipfelhöhe von achtzehntausend Fuß im Vergleich zu den dreizehntausendfünfhundert der Skyhawk. Einige Bergspitzen in Colorado ragten vierzehntausend Fuß hoch, also gab es bei der Wahl der Maschine nicht viel zu überlegen.
»Die Skylane«, sagte er. »Ich tanke in Salt Lake City nach.«
»Das hatte ich mir auch so vorgestellt«, krächzte Bret und erschien in seiner Bürotür. Seine Stimme klang so heiser wie die eines Frosches mit Mandelentzündung. »Ich habe den Männern gesagt, dass sie sie fertig machen sollen.«
Cam sah ihn an. Karen hatte keineswegs übertrieben, was seinen Zustand betraf; im Gegenteil. Sie hatte es noch milde ausgedrückt. Seine Augen waren rotgerändert und so verquollen, dass die Iris nur als schmaler blauer Schlitz zu erkennen war. Sein Gesicht war rot gefleckt, und er bekam durch die Nase keine Luft. Er sah aus wie das reinste Elend, und sein verhärmter Gesichtsausdruck deutete darauf hin, dass er sich auch so fühlte. Was immer er auch hatte – Cam wollte sich auf keinen Fall damit anstecken.
»Komm mir bloß nicht näher«, sagte er und hielt die Hand hoch wie ein Verkehrspolizist.
»Ich habe ihn schon mit Lysol eingesprüht«, sagte Karen und warf Bret über den Raum hinweg einen verächtlichen Blick zu. »Ein rücksichtsvoller Mensch mit auch nur einem Funken Verstand wäre zu Hause geblieben und hätte angerufen, anstatt auf der Arbeit zu erscheinen und seine Bakterien zu verbreiten.«
»Ich kann fliegen«, versuchte Bret einzuwenden. »Du bist diejenige, die steif und fest behauptet, es ginge nicht.«
»Ja, Mrs. Wingate wird begeistert sein, fünf Stunden mit dir in einem stickigen kleinen Flugzeug zu verbringen«, sagte Karen voller Sarkasmus. »Ich möchte keine fünf Minuten lang mit dir in einem Büro sein. Los! Ab nach Hause!«
»Dem kann ich nur beipflichten«, sagte Cam. »Nichts wie heim mit dir.«
»Ich habe schon ein schleimlösendes Mittel genommen«, schniefte Bret protestierend. »Es wirkt nur noch nicht.«
»Und das wird auch dann noch nicht zu wirken anfangen, wenn es Zeit für dich ist, an Bord zu gehen.«
»Du magst es doch nicht, die Familie Wingate zu fliegen.«
Vor allem nicht Mrs. Wingate, dachte Cam, aber laut meinte er: »Das schaffe ich schon.«
»Aber mich mag sie lieber.«
Nun klang Bret wie ein störrisches Kind, aber er schmollte ja immer, wenn irgendwas in seinem Flugplan dazwischenkam. »Sie wird mich schon fünf Stunden lang ertragen können«, sagte Cam unnachgiebig. Wenn er es schaffte, konnte sie es auch. »Du bist krank. Ich nicht. Ende der Diskussion.«
»Ich habe die Wettervorhersagen für dich zusammengestellt«, sagte Karen. »Sie sind in deinem Computer.«
»Danke.« Er ging in sein Büro, setzte sich an seinen Schreibtisch und begann zu lesen. Bret blieb in der Tür stehen, als wisse er nichts mit sich anzufangen. »Gott im Himmel«, sagte Cam. »Geh zum Arzt. Du siehst ja aus wie durch den Fleischwolf gedreht. Möglicherweise hast du eine Allergie oder so was.«
»Schon gut.« Er musste heftig niesen und bekam dann einen Hustenanfall.
Von seinem Platz aus konnte Cam Karen nicht sehen, aber er hörte ein zischendes Geräusch, und dann war Bret in eine Sprühwolke eingehüllt. »Oh, nicht doch!«, röchelte der Kranke und fuchtelte mit den Armen, um das Desinfektionsmittel zu zerstäuben. »Das kann doch nicht gesund sein, so etwas einzuatmen.«
Sie sprühte unbeirrt weiter. »Ich gebe auf«, murrte Bret, nachdem er sich noch ein paar Sekunden lang gegen die Wolke zur Wehr gesetzt hatte, dann aber einsah, dass er nichts dagegen ausrichten konnte. »Ich geh ja schon, ich geh ja schon. Aber wenn ich ein tödliches Lungenleiden bekomme, weil du mich mit Lysol eingesprüht hast, bist du gefeuert!«
»Wenn du tot bist, kannst du mich ja nicht mehr feuern.« Die letzte Ladung aus der Sprühdose bekam er noch auf den Rücken, ehe er die Bürotür hinter sich zuschlagen konnte.
Nach einem kurzen Moment des Schweigens sagte Cam: »Sprüh noch mehr. Sprüh alles ein, was er angefasst hat.«
»Dann brauche ich eine neue Dose. Die hier ist fast leer.«
»Wenn ich zurück bin, kaufe ich dir einen ganzen Karton.«
»Ich sprühe erst einmal die Türgriffe ein, die er berührt hat. Ansonsten halte ich mich von seinem Büro fern.«
»Was ist mit der Toilette?«
»Ich betrete die Männertoilette nicht. Ich hatte euch Männer immer für halbwegs normale Menschen gehalten, aber einmal habe ich mich auf ein Männerklo verirrt und bin vor Entsetzen fast aus den Latschen gekippt. Wenn ich so etwas noch einmal erleben muss, kriege ich Zustände. Wenn du euer Klo einsprühen willst, kannst du das selber machen.«
Einen Augenblick lang erwog er die unbedeutende Kleinigkeit, dass sie schließlich seine Angestellte war und dann die Aussicht, dass das Büro vollständig im Chaos versinken würde, wenn sie nicht da wäre – und dass sie dabei vermutlich auch noch ein wenig nachhelfen würde. Nachdem er diese beiden Gesichtspunkte gegeneinander abgewogen hatte, beschloss Cam, dass die Desinfizierung der Männertoilette nicht zu Karens Aufgabenbereich gehörte. »Aber im Moment habe ich keine Zeit dafür.«
»Euer Klo läuft schon nicht weg, und ich benutze das für Damen.« Was bedeutete, dass es ihr scheißegal war, ob das Männerklo desinfiziert wurde oder nicht.
Cam stand da und starrte den Türrahmen an. Erst jetzt ging ihm auf, wie viele ihrer Unterhaltungen von Zimmer zu Zimmer durch die geöffneten Bürotüren stattfanden und er sie dabei meistens gar nicht sehen konnte. »Ich werde einen großen runden Spiegel aufhängen«, sagte er. »Gleich hier an die gegenüberliegende Wand.«
»Wozu?«
»Damit ich dich sehen kann, wenn ich mit dir rede.«
»Warum willst du das?«
»Damit ich es weiß, wenn du grinst.«
Cam verstaute seine Reisetasche im Gepäckraum und machte dann eine Inspektionsrunde um die Skylane, um nachzusehen, ob irgendetwas lose oder abgenutzt war. Er zupfte, er drückte, er trat gegen die Reifen. Dann stieg er ins Cockpit und nahm die üblichen Überprüfungen vor dem Start vor, wobei er jeden Punkt seiner Checkliste auf einem Klemmbrett abhakte. Er kannte die Liste auswendig, er hätte dies im Schlaf tun können, aber er verließ sich niemals nur auf sein Gedächtnis – ein Augenblick des Abgelenktseins, und ihm konnte etwas Lebenswichtiges entgehen. Mit Hilfe seiner Liste konnte er sich sicher sein, nichts übersehen zu haben. Wenn man sich in zwei Meilen Höhe befand, war das nicht der geeignetste Zeitpunkt, um festzustellen, dass etwas nicht funktionierte.
Er sah auf die Uhr. Mrs. Wingate konnte jeden Moment eintreffen. Er startete den Motor und lauschte dem Geräusch, das von anfänglichem Spotzen in einen gleichmäßigen Leerlauf überging. Er checkte sämtliche Instrumente, überprüfte noch einmal, ob alle Anzeigen ihren Sollwert hatten, und vergewisserte sich dann, ob das Flugfeld frei war, ehe er die Maschine zu dem Maschendrahttor vor dem Terminal lenkte, wo er seinen Passagier aufsammeln sollte. Aus dem Augenwinkel sah er eine Bewegung auf dem Parkplatz und warf einen kurzen Blick in die Richtung: Ein dunkelgrüner Land Rover wurde gerade in die nächste freie Lücke neben dem Tor rangiert.
Es erstaunte ihn immer wieder, wenn er sie in dem Land Rover vorfahren sah. Mrs. Wingate sah ihm gar nicht so aus wie der Typ Frau, der einen Geländewagen oder einen Van fuhr. Wenn er sie nicht kennen würde, hätte er eher eingeschätzt, dass sie einen großen Luxuswagen bevorzugte, und zwar kein Coupé, sondern eine jener langgestreckten Limousinen, die ein Chauffeur lenkte, während sie selber auf dem Rücksitz saß. Stattdessen fuhr sie immer selbst und schien sich in dem allradgetriebenen Wagen so zu Hause zu fühlen, als wolle sie jeden Augenblick eine Exkursion ins Gelände machen.
Er war zu spät dran. Normalerweise würde Bret jetzt schon am Tor stehen und ihr Gepäck entgegennehmen. Cam sah, wie Mrs. Wingate einen Moment lang neben ihrem Wagen verharrte und beobachtete, wie die Cessna näher kam, dann schloss sie die Tür und ging zum Heck, um ihre Sachen selber auszuladen. Er war noch gut sechzig Yards vom Tor entfernt. Er würde ihr dabei nicht zur Hand gehen können.
Na wunderbar. Sie hatte bestimmt jetzt schon schlechte Laune, weil ihr niemand geholfen hatte. Aber wenigstens hatte sie nicht pikiert dagestanden und die Nase in die Luft gestreckt, bis jemand sie abholen kam.
Als er seine Startposition erreicht hatte, schaltete er den Motor ab und kletterte aus dem Cockpit. Er sah sie aus dem Terminal kommen. Mit der einen Hand zog sie einen Koffer auf Rollen hinter sich her, in der anderen trug sie eine große Handtasche. Begleitet wurde sie ausgerechnet von Karen, die zwei weitere Koffer hinter sich herrollte.
»Ich dachte, Bret sollte mein Pilot sein?«, sagte sie mit kühler Stimme zu Karen.
»Er ist krank«, erklärte Karen. »Glauben Sie mir, Sie würden ihn nicht in Ihrer Nähe haben wollen.«
Mrs. Wingate zuckte weder mit den Schultern, noch verriet ihr Gesichtsausdruck, was sie dachte. »Dann ist es wohl besser so«, sagte sie kurz angebunden. Ihre Augen blieben hinter ihrer großen Sonnenbrille vollkommen verborgen.
»Mrs. Wingate«, sagte Cam zur Begrüßung.
»Captain Justice.« Er hielt ihr das Tor auf, und sie marschierte hindurch.
»Darf ich Ihnen das Gepäck abnehmen?«
Ohne ein Wort zu sagen, stellte sie den Koffer ab, ehe er auch nur den Arm danach ausstrecken konnte. Er folgte ihrem Beispiel und schwieg, als sie die Gepäckstücke einlud, und fragte sich, ob sie ihren kompletten Kleiderschrank mitgenommen hatte. Ihr Gepäck war so oder so schon derart schwer, dass sie bei jeder normalen Fluggesellschaft einen heftigen Aufschlag hätte zahlen müssen.
Wenn er nur mit einem einzigen Passagier flog, nahm der- oder diejenige oft neben ihm im Cockpit Platz anstatt auf einem der vier Flugsessel dahinter. Es war einfacher, sich zu unterhalten, wenn der Reisende den Kopfhörer des Copiloten aufsetzte. Cam half Mrs. Wingate beim Einsteigen. Augenblicklich setzte sie sich auf den Sessel hinter ihm und machte damit deutlich, dass ihr an einem Gespräch mit ihm nicht gelegen war.
»Würden Sie sich auf die andere Seite setzen, bitte«, sagte er und wählte seinen Tonfall dabei so, dass es trotz des angehängten »bitte« wie eine Anweisung klang und nicht wie ein höflich vorgebrachter Wunsch.
Sie rührte sich nicht von der Stelle. »Warum?«
Es war sieben Jahre her, dass er seinen Abschied von der Air Force genommen hatte, aber der militärische Umgangston war noch so tief in ihm verwurzelt, dass er sie beinahe anblaffte, sie solle ihren Hintern hochheben, was vermutlich zur Folge gehabt hätte, dass ihr Vertrag binnen der nächsten Stunde gekündigt worden wäre. Also biss er die Zähne zusammen, und es gelang ihm, in einigermaßen ruhigem Ton zu erklären, dass es für die Gewichtsverteilung besser wäre, wenn sie auf der anderen Seite säße.
Wortlos wechselte sie auf den Sessel rechts neben sich und schnallte sich an. Dann öffnete sie ihre Handtasche, zog ein dickes, gebundenes Buch hervor und vergrub sofort ihre Nase darin. Cam bezweifelte, dass sie mit ihrer tiefdunklen Sonnenbrille ein Wort lesen konnte. Aber jedenfalls hatte sie ihm ihre Botschaft klar und deutlich zu verstehen gegeben: Nicht ansprechen. Alles klar. Er wollte sich ebenso wenig mit ihr unterhalten wie sie mit ihm.
Er setzte sich hinter das Steuerruder, schloss die Tür hinter sich und stülpte sich die Kopfhörer über die Ohren. Karen winkte, ehe sie wieder hineinging. Nachdem er den Motor gestartet und noch einmal alle Instrumente überprüft hatte, rollte er auf die Startbahn zu. Nicht ein einziges Mal blickte sie von ihrem Buch auf, selbst dann nicht, als sie vom Boden abhoben.
Tja, dachte Cam, das würden wohl fünf lange Flugstunden werden.
4
Na großartig, dachte Bailey, als sie Captain Justice aus dem Cockpit der Cessna steigen und auf das Tor zugehen sah. Es war leicht zu erkennen, dass es sich bei diesem großen, schlanken und breitschultrigen Mann nicht um Bret Larsen handelte, den Piloten, mit dem sie für gewöhnlich flog. Bret war stets gut gelaunt und kontaktfreudig, während sein wortkarger Kollege immer nur missbilligend dreinblickte. Seit sie Jim Wingate geheiratet hatte, achtete sie sehr bewusst darauf, wie man ihr gegenübertrat. Obwohl sie sich selber nie als dünnhäutig bezeichnen würde, reagierte sie recht empfindlich auf ein solches Verhalten.
Sie hatte es verdammt satt, immer als Erbschleicherin zu gelten, die einen kranken Mann eiskalt ausgenutzt hatte. Die ganze Idee war auf Jims Mist gewachsen und nicht auf ihrem. Ja, sie machte das alles wegen des Geldes, aber, verdammt noch mal, sie verdiente die Summe, die sie jeden Monat ausbezahlt bekam. Seths und Tamzins Erbanteile waren unter ihrer Ägide nicht nur sicher angelegt, sondern vermehrten sich auch kräftig. Sie war keineswegs ein Finanzgenie, aber sie hatte eine Nase für gute Anlagen und blickte in Bankangelegenheiten durch. Jim hatte immer gemeint, dass sie eine zu konservative Anlegerin war, aber wenn es um die Sicherung des Vermögens ging, hatte er genau das gewollt.
Sie überlegte, ob sie eine Annonce in die Zeitung setzen sollte, um dies zu erklären, aber warum sollte sie sich vor den Leuten rechtfertigen? Sollten sie ihr doch den Buckel runterrutschen.
Das war auch eine gesunde Einstellung Jims alten Freunden gegenüber, die sich nun zu fein waren, um mit ihr zu verkehren. Aber sie war eigentlich ganz froh darüber, sich nicht mit ihnen abgeben zu müssen – sie hatte sie ohnehin nie als ihre Freunde betrachtet. Allerdings kam sie nicht umhin, heute mehrere Stunden mit Mr. Miesmuffel eingepfercht in einem kleinen Flugzeug zu verbringen, es sei denn, sie würde den Flug absagen und warten, bis Bret wieder gesund war. Oder sie buchte einen Linienflug nach Denver.
Der Gedanke schien verlockend. Aber es konnte natürlich sein, dass in der nächsten Maschine gar kein Platz mehr frei war – immer vorausgesetzt, dass sie es überhaupt rechtzeitig zum Flugplatz schaffte –, und ihr Bruder und seine Frau waren schließlich bereits auf dem Flug von Maine nach Denver. Es war so abgesprochen, dass Logan schon den Mietwagen besorgt hatte, wenn Bailey in Denver landete. Heute Abend um acht sollten sie an dem Lagerplatz eintreffen, den sie sich ausgesucht hatten, um von dort aus die nächsten zwei Wochen Wildwasserfahrten auf dem Fluss zu unternehmen. Diese Aussicht fand Bailey geradezu himmlisch – zwei Wochen ohne Telefon, ohne kühle oder missbilligende Blicke und vor allem ohne Seth und Tamzin.
Wildwasserrafting war Logans Hobby. Er und Peaches, seine Frau, hatten sich auf einer Schlauchboottour kennengelernt. Während ihrer Collegezeit hatte Bailey ein paar Raftingtrips unternommen, und es hatte ihr gefallen, also schien dies eine ideale gemeinsame Unternehmung für sie zu sein. Baileys Verwandtschaft war in alle Winde verstreut und hatte nie viel von großen Familienzusammenkünften gehalten, also bekam sie ihre engsten Angehörigen nicht allzu oft zu sehen. Ihr Vater lebte mit seiner zweiten Frau in Ohio. Ihre Mutter, deren dritter Ehemann vor vier Jahren gestorben war, lebte bei der ebenfalls verwitweten Schwester ihres zweiten Ex-Mannes in Florida, und Kennedy, Baileys ältere Schwester, hatte sich nach New Mexico verkrochen. Am nächsten stand Bailey noch ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Logan, aber auch ihn hatte sie seit Jims Beerdigung nicht mehr gesehen. Er und Peaches waren auch ihre einzigen Angehörigen gewesen, die daran teilgenommen hatten. Peaches war ein herzensguter Mensch und ihr die liebste unter all ihren Schwägerinnen und Schwägern und sonstigen angeheirateten Verwandten.
Der gemeinsame Urlaub war Peaches’ Idee gewesen, und während sie die Einzelheiten der Reise ausarbeiteten, waren jede Menge E-Mails hin- und hergegangen. Sie hatten beschlossen, die sperrigen Utensilien – das Zelt, das Kochgeschirr, die Laternen und alles, was man so brauchte, um zwei Wochen lang am Flussufer zu kampieren – vor Ort zu mieten und sich in Denver nur noch mit Lebensmitteln, Wasser und anderen Notwendigkeiten – wie zum Beispiel Klopapier – zu versorgen. Trotzdem waren Baileys Koffer vollgestopft mit Dingen, von denen sie meinte, dass sie sie vielleicht brauchen würde.
Ihre beschränkte Erfahrung mit Wildwassertouren hatte sie gelehrt, dass es besser war, etwas dabeizuhaben und es nicht zu brauchen, als feststellen zu müssen, dass etwas Wichtiges fehlte. Auf der zweiten ihrer früheren Raftingtouren hatte sie ihre Regel ein paar Tage zu früh bekommen und war darauf völlig unvorbereitet gewesen. Was ein fröhliches Abenteuer mit Freunden hatte werden sollen, wurde zur Tortur, denn sie musste ihre Socken als Binden benutzen und litt fast auf der gesamten Fahrt unter kalten und nassen Füßen. Nein, lustig war das nicht gewesen. Diesmal hatte sie rechtzeitig Versandhauskataloge von Outdoorausrüstungen gewälzt und sich alles bestellt, wovon sie glaubte, dass sie es würde gebrauchen können, wie zum Beispiel eine ganze Packung Einwegzahnbürsten, wasserfeste Spielkarten und ein Leselämpchen.
Logan würde sie bestimmt damit aufziehen, dass sie viel zu viel mitgeschleppt hatte, aber er würde sich noch umschauen, wenn er plötzlich irgendwas dringend benötigte und sie es aus ihrem Gepäck hervorzaubern konnte – wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie hatte sogar eine kleine Rolle Klebeband dabei, falls ihr Zelt einen Riss bekäme – auch das war ihr nämlich auf ihrem letzten, beschwerlichen Raftingtrip widerfahren. Sie hatte Spaß am Rafting, selbst wenn sie klatschnass und frierend in dem Boot saß. Das gehörte einfach dazu, doch außerhalb des Bootes wollte sie keine der Bequemlichkeiten missen, die sie von zu Hause gewohnt war. Okay, sie mochte sich wie ein kleines Mädchen anstellen, aber sie war sich sicher, dass auch Peaches die feuchten Reinigungstücher mit Aloe Vera gegenüber der Alternative, sich mit Hilfe eines Eimers voller Flusswasser und einem Stück Seife waschen zu müssen, bevorzugen würde.
Sie hatte sich schon die ganze Zeit so sehr auf diesen Urlaub gefreut, dass sie den Gedanken an eine Verzögerung einfach nicht ertragen konnte, selbst wenn die Gesellschaft von Captain Justice aushalten musste um pünktlich anzukommen. Sooft sie diesen Namen hörte, war ihr danach, verächtlich zu schnauben. Captain Justice. Meine Güte. Das hörte sich an wie der Held einer Comicserie.
Ohne mit der Wimper zu zucken hatte er ihre drei Gepäckstücke ins Flugzeug gewuchtet, aber sie konnte ihm an seinem versteinerten Gesichtsausdruck ansehen, was er dabei dachte – nämlich, dass sie ihren ganzen Kleiderschrank mitgenommen hatte. Jeder normale Mensch hätte wenigstens etwas ungläubig dreingeschaut oder sie gefragt, ob sie Steine in ihren Koffern transportierte. Bret zum Beispiel hätte gegrunzt und zum Spaß so getan, als wären die Koffer noch schwerer als in Wirklichkeit. Nicht aber Mr. Eisbrocken. Ihn hatte sie noch nie lächeln gesehen.
Als er ihr in die Maschine half, hatte er gänzlich unvermutet so fest zugepackt, dass sie beinahe zusammengezuckt wäre. Ihr ging auf, dass Bret ihr nie beim Einsteigen half. Trotz seiner sonst so lässigen, kameradschaftlichen Umgangsformen achtete er taktvoll darauf, ihr nicht zu nahe zu kommen. Sie musste schon zugeben, dass sie seit ihrer Heirat mit Jim eine ziemliche Mauer um sich gezogen hatte. Sie traute den Menschen einfach nicht mehr über den Weg. Das ließ sie steif und unnahbar erscheinen. Captain Justice hatte entweder ihre körperlichen Signale, nicht angefasst werden zu wollen, übersehen, oder er scherte sich nicht darum. Seine Hände waren rauer und kräftiger als die der Geschäftsleute und Bankmenschen, mit denen sie sonst Umgang pflegte, und er packte entsprechend fester damit zu. Der Schock, von ihm berührt zu werden, die rohe Kraft, die von seiner Hand ausging, hätten ihr fast das Herz stillstehen lassen.
Sie war noch so erschrocken gewesen, dass sie es kaum mitbekommen hatte, als er sie aufforderte, sich auf die andere Seite zu setzen. Sowie sie auf dem ihr zugewiesenen Platz saß und angeschnallt war, hatte sie ihr Buch hervorgekramt und so getan, als sei sie vollkommen darin vertieft, aber im Geiste quälte sie sich mit Selbstvorwürfen.
Wie armselig war sie eigentlich, dass sie sich durch die bloße Berührung eines Mannes so aus der Fassung bringen ließ – und nicht einmal irgendeines Mannes, sondern von jemandem, der eine deutliche Abneigung gegen sie zeigte. Gut, so etwas wie ein Liebesleben gab es bei ihr zur Zeit nicht, und das würde auch so bleiben, solange sie mit Jims Kindern zu schaffen hatte, denn sie wollte denen auf keinen Fall Munition liefern und auch noch selbst die Zielscheibe abgeben. Ja, es gab Augenblicke, in denen sich ihre sexuellen Bedürfnisse mit aller Macht meldeten, aber sie hoffte doch, noch genügend Stolz zu besitzen, um das jemandem wie Cameron Justice gegenüber niemals durchblicken zu lassen. Er sollte nicht glauben, ihr wäre jeder Mann recht.
Das Teuflische daran war, dass sie ihn äußerlich durchaus attraktiv fand, wenn auch nicht gut aussehend